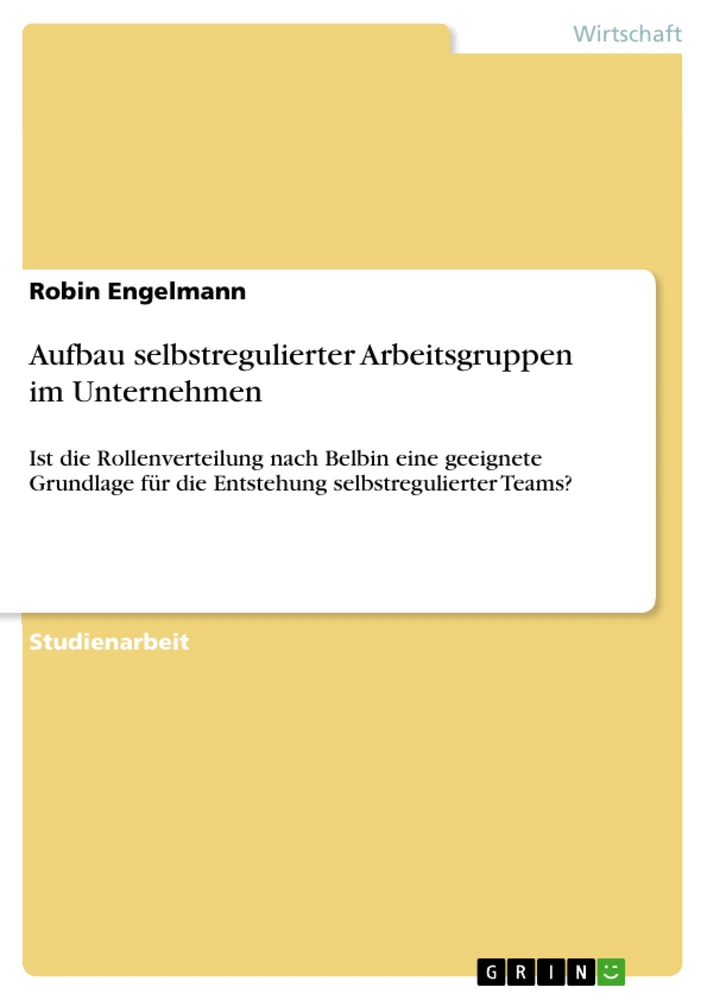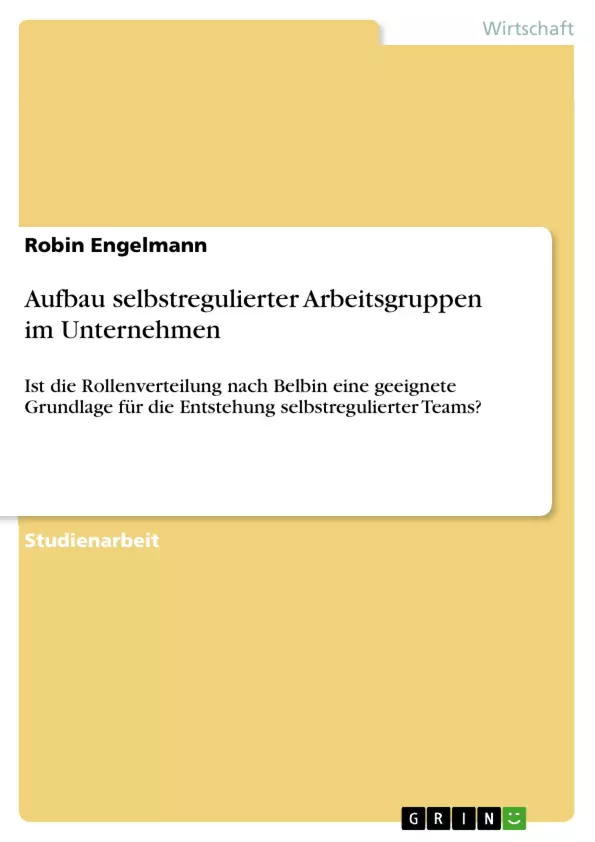Ziel der vorliegenden Seminararbeit ist es herauszufinden ob Führungskräfte mit der Rollenverteilung nach Belbin Teams schaffen können die fähig sind, sich im Verlauf eines Projektes selbst zu regulieren. Dabei stellt sich zunächst die Frage was selbstregulierte oder teilautonome Teams ausmacht, welche Vorteile sie Unternehmen bringen und unter welchen Voraussetzungen sie funktionieren können.
Die beiden aus der Industriellen Revolution entstammenden Konzepte der (a) Notwendigkeit einer hierarchischen Leitstruktur und (b) Notwendigkeit der Arbeitsteilung wurden viele Jahre als Voraussetzung für die erfolgreiche Führung von Unternehmen gesehen. Seit damals hat sich dieser Fokus stark verschoben. Heutzutage stellt die geteilte Arbeit in Teams einen zentralen Bestandteil in Organisationen dar. Spätestens seit den Neunzigerjahren wird die erfolgreiche Gruppenarbeit auch in deutschen Unternehmen als entscheidender Faktor für Innovation und damit verbundene Wettbewerbsfähigkeit angesehen.
Besonders bei modernen, US-amerikanischen Unternehmen kommt im Zusammenhang der Teamarbeit immer öfters das Thema der Selbstregulierung auf. Dabei werden Teams, die fortlaufen an unternehmensinternen Projekten arbeiten, mehr Verantwortung zugesprochen und weniger von außen, wie zum Beispiel durch Führungskräfte kontrolliert. Beim Aufbau solcher Teams kommt den Führungskräften und der gesamten Organisation eine wichtige Rolle zu. Besonders die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen unter denen die Teams gebildet werden, stellen die Verantwortlichen vor große Herausforderungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zielsetzung und Forschungsfragen
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2. Begriffliche Grundlagen
- 2.1 Das Team
- 2.2 Selbstregulierung
- 3. Selbstregulierte Teams
- 3.1 Merkmale Selbstregulierter Teams
- 3.2 Auswirkung selbstregulierter Teams
- 3.3 Perspektive der Führung
- 4. Rollenverteilung in Teams
- 4.1 Bedeutung von Teamrollen
- 4.2 Rollenverteilung nach Belbin
- 5. Anwendung in der Praxis
- 5.1 Das Szenario
- 5.2 Integration der Theorie in die Praxis
- 5.3 Handlungsempfehlung und kritische Würdigung
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Frage, ob Führungskräfte mit Hilfe der Rollenverteilung nach Belbin Teams schaffen können, die sich im Laufe eines Projektes selbst regulieren. Dabei werden die Eigenschaften selbstregulierter Teams, ihre Vorteile für Unternehmen und die notwendigen Voraussetzungen für ihr Funktionieren analysiert. Die Arbeit konzentriert sich auf die Rolle der Rollenverteilung in Teams und die Erkenntnisse der Theorie von Belbin.
- Definition und Merkmale von selbstregulierten Teams
- Vorteile selbstregulierter Teams für Unternehmen
- Bedeutung der Rollenverteilung in Teams
- Die Theorie der Rollenverteilung nach Belbin
- Anwendung der Theorie von Belbin in der Praxis zur Bildung selbstregulierter Teams
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 definiert grundlegende Begriffe wie "Team" und "Selbstregulierung" aus verschiedenen Perspektiven, um ein gemeinsames Verständnis für die Arbeit zu schaffen. Kapitel 3 beleuchtet die Selbstregulierung in Gruppen, beschreibt die Merkmale und Vorteile dieser Teams und geht auf die Perspektive der Führung ein.
Kapitel 4 diskutiert die Wichtigkeit von Rollen in Teams und stellt die Theorie der Rollenverteilung nach Belbin vor. Diese Theorie wird in Kapitel 5 als Grundlage für die Lösung eines fiktiven Managementproblems verwendet und in eine Handlungsempfehlung für die Praxis integriert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Selbstregulierung, Teams, Rollenverteilung, Belbin, Führung, Praxisanwendung. Der Fokus liegt auf der Frage, ob die Theorie von Belbin eine geeignete Grundlage für die Entwicklung selbstregulierter Teams in Unternehmen bietet.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet selbstregulierte Teams aus?
Selbstregulierte (oder teilautonome) Teams übernehmen mehr Eigenverantwortung, kontrollieren ihre Arbeitsprozesse weitgehend selbst und benötigen weniger Steuerung von außen durch Führungskräfte.
Wie hilft die Theorie von Belbin beim Aufbau solcher Teams?
Belbins Rollenmodell identifiziert verschiedene Teamrollen (z.B. Koordinator, Macher, Spezialist). Eine ausgewogene Verteilung dieser Rollen ist entscheidend für die Funktionsfähigkeit und Selbstregulationskraft eines Teams.
Welche Vorteile bieten selbstregulierte Teams für Unternehmen?
Sie fördern Innovationen, erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit und können flexibler auf komplexe Herausforderungen in modernen Projektumgebungen reagieren.
Was ist die Rolle der Führungskraft in einem selbstregulierten Team?
Die Führungskraft agiert weniger als Kontrolleur, sondern eher als Gestalter der Rahmenbedingungen und Unterstützer bei der Teambildung und Rollenklärung.
Welche Voraussetzungen müssen für funktionierende Teamarbeit erfüllt sein?
Notwendig sind klare Zielsetzungen, geeignete Kommunikationsstrukturen, Vertrauen innerhalb der Gruppe und eine passende Zusammensetzung der Teammitglieder nach ihren Stärken.
Wie hat sich das Konzept der Teamarbeit seit der Industriellen Revolution verändert?
Der Fokus verschob sich von starren Hierarchien und strikter Arbeitsteilung hin zu dynamischen, geteilten Verantwortlichkeiten und kollaborativer Problemlösung in Teams.
- Citation du texte
- Robin Engelmann (Auteur), 2016, Aufbau selbstregulierter Arbeitsgruppen im Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/349701