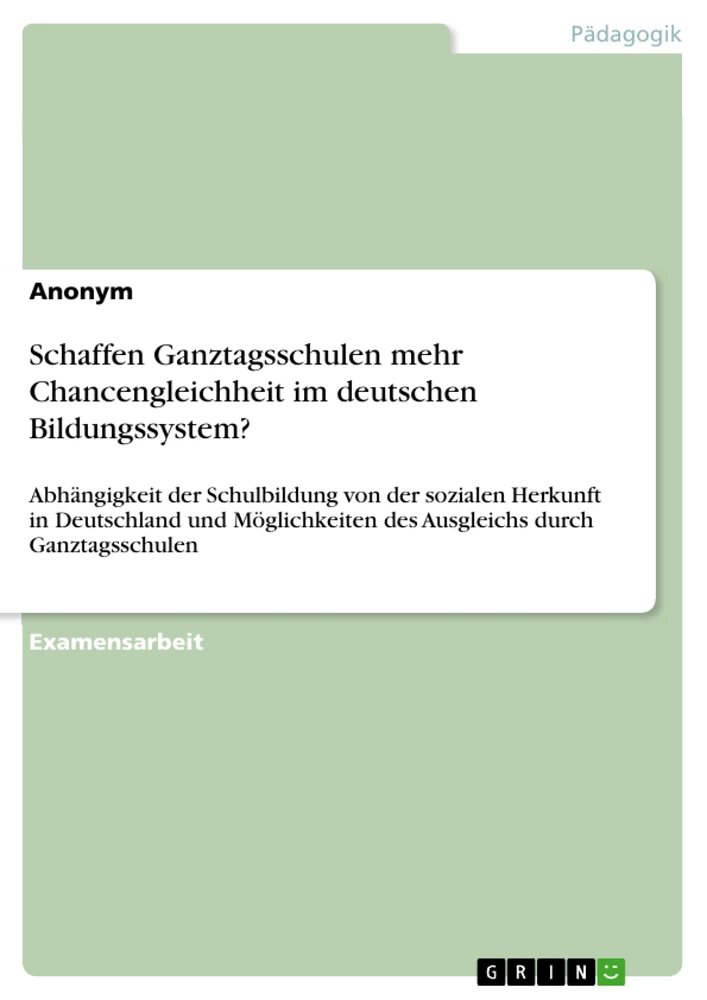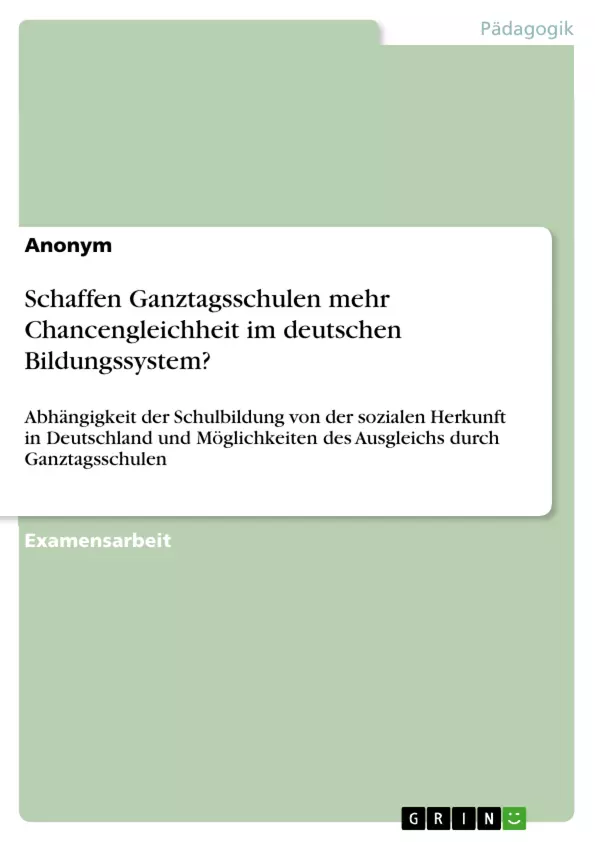Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob durch Ganztagsschulen mehr Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem entsteht. Es soll geklärt werden, ob durch Ganztagsschulen im deutschen Bildungssystem mehr Chancengleichheit für Schülerinnen und Schüler herrscht. Um diese Frage zu diskutieren und anschließend eine Antwort finden zu können, muss zunächst geklärt werden, was unter „Chancengleichheit“ zu verstehen ist. Außerdem soll erläutern werden, in welchem Verhältnis Bildung und Chancengleichheit stehen.
Unter Punkt 3. soll auf die Ungleichheiten der Bildungschancen eingegangen werden. Um die vorangestellte Frage zu klären, ist es außerdem wichtig zu wissen, wie weit und in welchem Ausmaß Ungleichheiten im deutschen Bildungssystem verbreitet sind und welche Erklärungen und Ursachen es dafür gibt. Diesen Fragen wird unter 3.1., 3.2. und 3.3. nachgegangen.
Die wichtigste Frage dieser Arbeit wird unter 4. analysiert. Vorerst soll deutlich gemacht werden, was generell unter Ganztagsschulen zu verstehen ist und welche verschiedenen Formen der Ganztagsschule in der Bundesrepublik Deutschland verbreitet sind (4.1. und 4.1.1.). Im Anschluss daran wird unter 4.2. die bundesweite Entwicklung der Ganztagsschulen dargestellt. Chancen und Probleme von Ganztagsschulen sollen unter 4.3. näher erläutert werden. Hierbei scheint es sinnvoll zu sein, genauer zu unterscheiden. Dieser Punkt wird also des Weiteren in 4.3.1. Entlastung der Familien, 4.3.2. Ganztagsschule als Ort des gemeinsamen Lernens, 4.3.3. Individuelle Förderung, 4.3.4. Unterrichtsveränderungen und 4.3.5 Tatsächlicher Nachteilsausgleich oder halbe Sache?! unterteilt. Unter Punkt 4.3.5. wird sich konkret mit der Frage nach mehr Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem durch Ganztagsschulen beschäftigt. Hier sollen erste Antworten gefunden und diskutiert werden.
Im abschließenden fünften Kapitel werden schließlich die bisher dargestellten Argumente und Antworten zusammengeführt und in einer Diskussion deren Gehalt abgewogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Chancengleichheit und Bildung
- 2.1. Begrifflichkeit „Chancengleichheit“
- 2.2. Bildung als Inbegriff von Chancenungleichheit?
- 3. Ungleichheiten der Bildungschancen
- 3.1. Ausmaß und Verbreitung
- 3.2. Erklärungsansätze
- 3.3. Ursachen
- 3.3.1. Familiäre Aspekte
- 3.3.2. Institutionelle Aspekte
- 4. Ausgleich der Chancenungleicheiten durch Ganztagsschulen?
- 4.1. Was sind Ganztagsschulen? Bedeutung
- 4.1.1. Verschiedene Formen der Ganztagsschule im deutschen Bildungssystem
- 4.2. Entwicklung von Ganztagsschulen
- 4.3. Chancen, Erwartungen und Probleme der Ganztagsschule
- 4.3.1. Entlastung der Familien
- 4.3.2. Ganztagsschule als Ort des gemeinsamen Lernens
- 4.3.3. Individuelle Förderung
- 4.3.4. Unterrichtsveränderungen
- 4.3.5. Tatsächlicher Nachteilsausgleich oder halbe Sache?
- 4.1. Was sind Ganztagsschulen? Bedeutung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Ganztagsschulen zu mehr Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem beitragen können. Sie analysiert die verschiedenen Formen der Ganztagsschule, ihre Entwicklung und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen. Dabei werden die Auswirkungen auf die Bildungschancen von Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen sozialen Schichten und mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen untersucht.
- Begriffliche Klärung von „Chancengleichheit“ im Bildungsbereich
- Analyse der Ursachen für Ungleichheiten in den Bildungschancen
- Bewertung des Potenzials von Ganztagsschulen zur Reduzierung von Chancenungleichheiten
- Untersuchung der Auswirkungen von Ganztagsschulen auf die Lernbedingungen und das soziale Umfeld von Schülerinnen und Schülern
- Diskussion der Rolle von Ganztagsschulen im Kontext der individuellen Förderung und der Entwicklung sozialer Kompetenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der Ganztagsschule und deren Bedeutung im deutschen Bildungssystem ein. Es wird der aktuelle Stand der Diskussion und die Relevanz des Themas im Kontext von Chancengleichheit beleuchtet.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Begriff „Chancengleichheit“ und der Frage, inwiefern Bildung als Inbegriff von Chancenungleichheit betrachtet werden kann. Es werden verschiedene Ansätze zur Definition und Messung von Chancengleichheit im Bildungsbereich vorgestellt.
Kapitel 3 analysiert die Ungleichheiten der Bildungschancen in Deutschland. Es werden Daten zur Verbreitung von Ungleichheiten und verschiedene Erklärungsansätze vorgestellt. Die Ursachen für Ungleichheiten werden in familiäre und institutionelle Faktoren unterteilt.
Kapitel 4 untersucht die Möglichkeiten des Ausgleiches von Chancenungleicheiten durch Ganztagsschulen. Es werden die verschiedenen Formen der Ganztagsschule in Deutschland vorgestellt, ihre Entwicklung und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen analysiert. Die Auswirkungen von Ganztagsschulen auf die Lernbedingungen und das soziale Umfeld von Schülerinnen und Schülern werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Chancengleichheit, Ganztagsschule, Bildungssystem, Bildungschancen, soziale Ungleichheit, familiäre Faktoren, institutionelle Faktoren, individuelle Förderung, Lernen, soziales Umfeld, Unterrichtsveränderungen, Nachteilsausgleich.
Häufig gestellte Fragen
Schaffen Ganztagsschulen tatsächlich mehr Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem?
Die Arbeit untersucht, ob Ganztagsschulen durch individuelle Förderung und Entlastung der Familien Bildungsungleichheiten abbauen können. Es wird kritisch hinterfragt, ob sie einen echten Nachteilsausgleich bieten oder eine "halbe Sache" bleiben.
Wie wird der Begriff „Chancengleichheit“ in dieser Arbeit definiert?
In Kapitel 2 wird die Begrifflichkeit geklärt und analysiert, in welchem Verhältnis Bildung und Chancengleichheit stehen, um eine Basis für die Diskussion der Bildungsgerechtigkeit zu schaffen.
Welche Ursachen für Bildungsungleichheit werden genannt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen familiären Aspekten (soziale Herkunft) und institutionellen Aspekten innerhalb des Schulsystems, die zur Verbreitung von Ungleichheiten beitragen.
Welche Formen der Ganztagsschule gibt es in Deutschland?
Es werden verschiedene verbreitete Formen der Ganztagsschule in der Bundesrepublik Deutschland sowie deren bundesweite Entwicklung dargestellt.
Welche Chancen bietet die Ganztagsschule für Schüler?
Zu den Hauptvorteilen zählen die individuelle Förderung, die Veränderung des Unterrichts und die Funktion der Schule als Ort des gemeinsamen Lernens.
Wird die Entlastung der Familien durch Ganztagsschulen thematisiert?
Ja, unter Punkt 4.3.1 wird explizit auf die Rolle der Ganztagsschule bei der Entlastung von Familien eingegangen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2016, Schaffen Ganztagsschulen mehr Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/349712