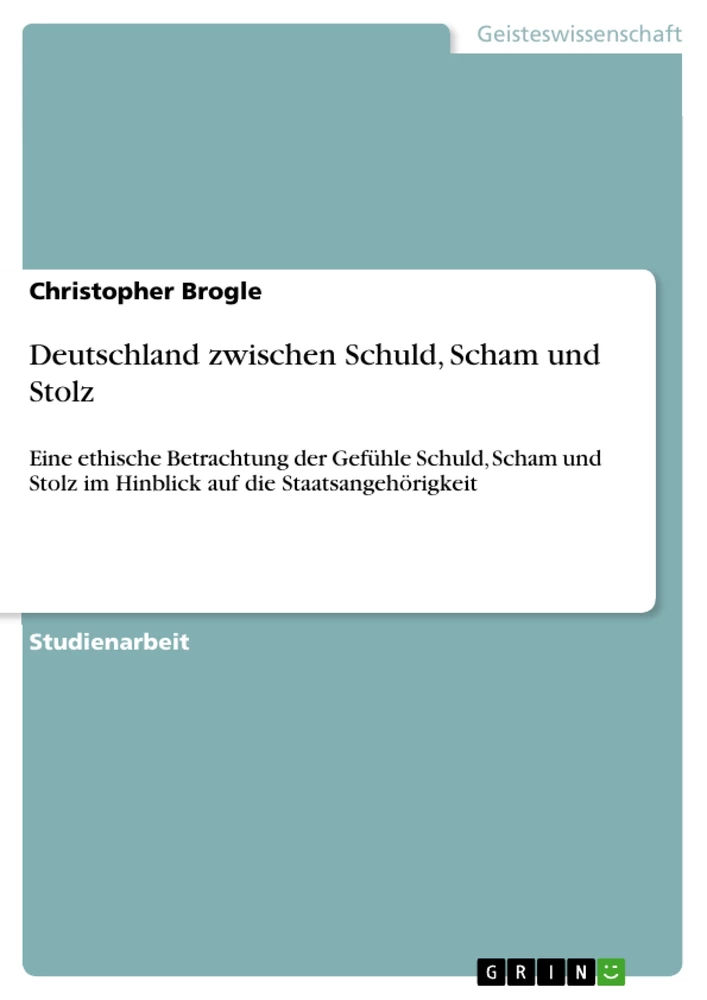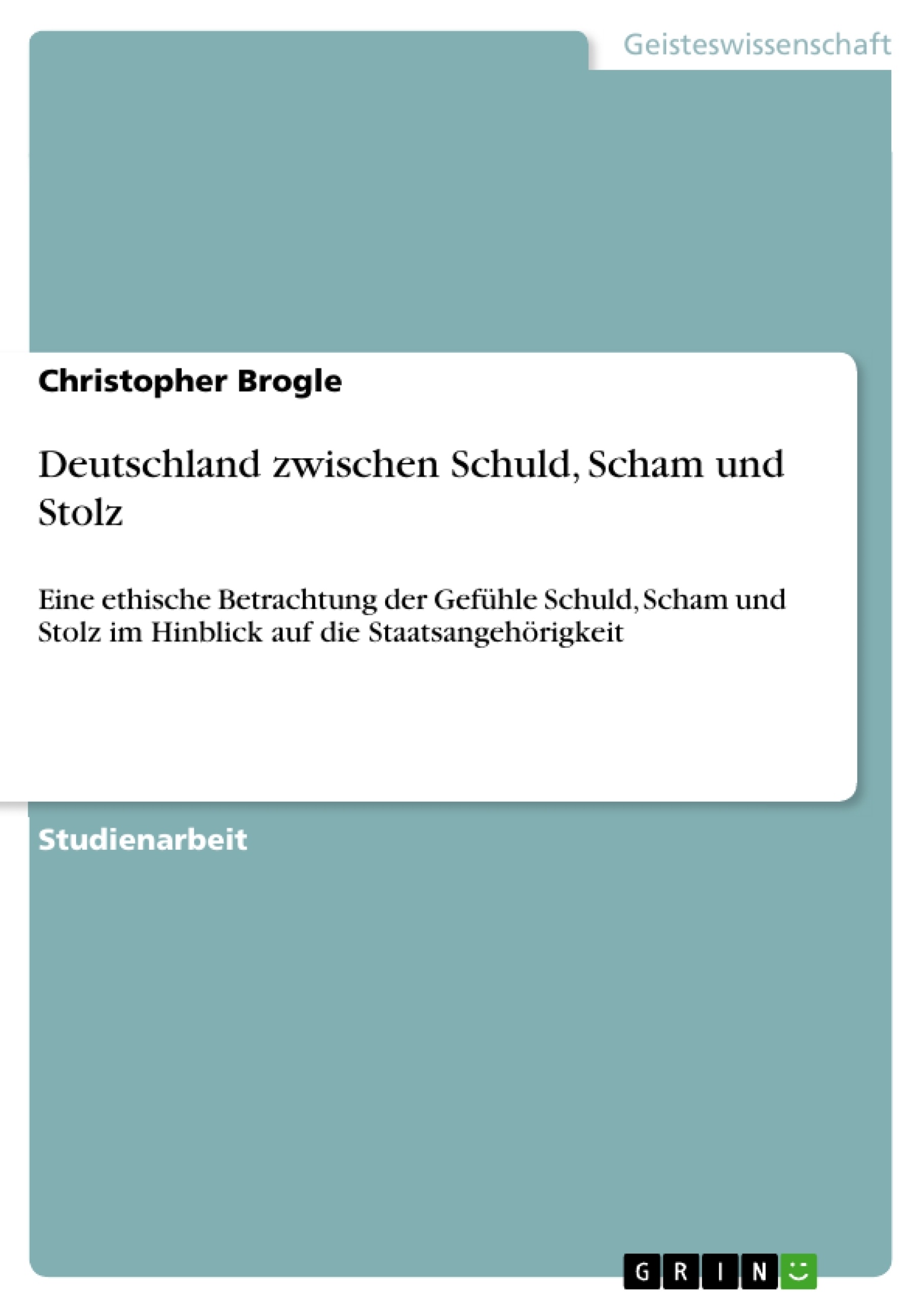Längst sind Diskussionen um „Nationalstolz“ auch außerhalb rechtsextremer Kreise anzutreffen. Spätestens seit der WM 2006 im eigenen Land wehen auch in Deutschland, zumindest im zweijährigen Wechsel, allerorts Deutschlandfahnen. Im Jahr 2014 wurde man außerdem nicht nur erneut Fußball- sondern auch einmal mehr Exportweltmeister. Gründe genug um wieder stolz auf sein Land sein zu dürfen?
Auch die Begriffe Schuld und Scham im Hinblick auf den Nationalsozialismus werden im Angesicht des demographischen Wandels immer wieder hinterfragt. Denn Menschen, die zur besagten Zeit alt genug waren, um sich an den Verbrechen zu beteiligen oder „nur“ tatenlos dabei zuzusehen, werden innerhalb der nächsten Dekaden nicht mehr existieren. Sowohl Schuld, Scham und Stolz im Hinblick auf das Herkunftsland werden also in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte mal mehr, mal weniger intensiv diskutiert. Grund genug, diese Themen einmal philosophisch zu betrachten.
Im Folgenden möchte ich daher zunächst die genannten Gefühle genauer erläutern. Hier möchte ich auf körperliche Äußerungen der Gefühle eingehen und innerliche Vorgänge, Auslöser und Anlässe für das Gefühlserleben beschreiben. Eine philosophiegeschichtliche Betrachtung der jeweiligen Gefühle bietet sich an, um gegebenenfalls kulturelle und zeitliche Unterschiede darzulegen.
Anschließend möchte ich der Frage nachgehen, ob die bloße Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe Stolz überhaupt auslösen kann. Außerdem die Frage, ob sich der Mensch für etwas schämen oder schuldig fühlen kann, das er nicht getan hat. Anders ausgedrückt: Macht die bloße deutsche Staatszugehörigkeit schuldig? Oder ist im Hinblick auf die NS-Verbrechen nicht besser von einer gewissen Verantwortung zu sprechen? Und wenn ja, beschränkt sich diese Verantwortung nur auf die Deutschen?
Neben einer grundsätzlichen Thematisierung der Gefühle Schuld, Scham und Stolz werden diese auf die Staatsangehörigkeit bezogen. Die Thematik wird mit didaktischen Ausführungen abgerundet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist ein Gefühl?
- 3. Schuld und Scham
- 3.1 Leibliche Äußerung der Scham
- 3.2 Leibliche Äußerungen der Schuld
- 3.3 Schuld und Scham in der Philosophiegeschichte
- 3.4 Schuld und Scham in Bezug auf die Nationalität
- 4. Stolz
- 4.1 Leibliche Äußerungen des Stolzes
- 4.2 Stolz in der Philosophiegeschichte
- 4.3 Stolz in Bezug auf die Staatsangehörigkeit
- 5. Schuld, Scham und Stolz im unterrichtlichen Kontext
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gefühle Schuld, Scham und Stolz, insbesondere im Kontext der deutschen Nationalität und der historischen Verantwortung für den Nationalsozialismus. Sie beleuchtet die philosophischen Grundlagen dieser Gefühle, deren körperliche Manifestationen und ihre Rolle in der gesellschaftlichen Debatte.
- Philosophische Definition und Abgrenzung von Schuld, Scham und Stolz
- Körperliche Äußerungen und Auslöser der genannten Gefühle
- Philosophiegeschichtliche Betrachtung von Schuld, Scham und Stolz
- Der Einfluss der Nationalität auf Schuld, Scham und Stolz
- Die Rolle von Schuld, Scham und Stolz im Bildungskontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den gesellschaftlichen Kontext der Arbeit dar, indem sie die Debatte um Nationalstolz in Deutschland im Kontext des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und der PEGIDA-Bewegung beleuchtet. Sie führt die zentralen Themen – Schuld, Scham und Stolz im Bezug auf die deutsche Nationalität – ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Einleitung verweist auf den demografischen Wandel und die damit einhergehende Veränderung der Wahrnehmung dieser Gefühle, wodurch die Notwendigkeit einer philosophischen Auseinandersetzung mit diesen Themen begründet wird.
2. Was ist ein Gefühl?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Gefühl“ aus philosophischer Perspektive. Es werden die Schwierigkeiten bei der klaren Abgrenzung von „Gefühl“, „Emotion“ und „Affekt“ sowie der propositionale Charakter von Gefühlen, die mit körperlichen Empfindungen einhergehen, diskutiert. Der Text erläutert die Intentionalität von Gefühlen und die Unterscheidung zwischen der Perspektive der ersten und dritten Person bei deren Beschreibung. Schließlich wird die enge Verbindung von Gefühlen und moralischen Handlungen hervorgehoben und der Ansatz von Herrmann Schmitz mit den Begriffen „Verdichtungsbereich“ und „Verankerungspunkt“ zur Differenzierung von Gefühlen vorgestellt. Die Kapitel dient als Grundlage für die nachfolgende tiefere Auseinandersetzung mit Schuld, Scham und Stolz.
3. Schuld und Scham: Dieses Kapitel analysiert die Gefühle Schuld und Scham aus aristotelischer Sicht. Es erklärt Scham als Reaktion auf einen Normverstoß, der mit moralischen Aspekten eng verbunden ist, jedoch auch in nicht-moralischen Kontexten auftreten kann. Der Text differenziert zwischen dem akuten Schamgefühl und der Scham als Disposition. Die Vielschichtigkeit des Begriffs „Schuld“ im Deutschen wird herausgestellt, von der Verpflichtung bis hin zur sozialenthischen Komponente mit der Notwendigkeit von Sühne. Der Fokus liegt auf der Verbindung von Schuld und Scham mit der Moral, die aber nicht als ausschließlich moralisch eingestuft werden kann.
Schlüsselwörter
Schuld, Scham, Stolz, Nationalstolz, Nationalsozialismus, Moral, Philosophiegeschichte, Körperliche Äußerungen, Gefühl, Emotion, Verantwortung, Deutschland, Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Schuld, Scham und Stolz im Kontext der deutschen Nationalität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Gefühle Schuld, Scham und Stolz, insbesondere im Kontext der deutschen Nationalität und der historischen Verantwortung für den Nationalsozialismus. Sie untersucht die philosophischen Grundlagen dieser Gefühle, ihre körperlichen Manifestationen und ihre Rolle in der gesellschaftlichen Debatte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: philosophische Definition und Abgrenzung von Schuld, Scham und Stolz; körperliche Äußerungen und Auslöser dieser Gefühle; philosophiegeschichtliche Betrachtung; der Einfluss der Nationalität auf diese Gefühle; und die Rolle von Schuld, Scham und Stolz im Bildungskontext. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich von Schuld und Scham sowie der Diskussion von Stolz im Kontext des deutschen Nationalismus und der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Definition des Begriffs „Gefühl“, Analyse von Schuld und Scham, Analyse von Stolz und Schuld, Scham und Stolz im Bildungskontext. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der zentralen Aussagen.
Wie wird der Begriff „Gefühl“ definiert?
Das zweite Kapitel widmet sich der philosophischen Definition von „Gefühl“, unterscheidet zwischen „Gefühl“, „Emotion“ und „Affekt“ und diskutiert den propositionalen Charakter von Gefühlen sowie deren Intentionalität und die Perspektive der ersten und dritten Person. Der Ansatz von Herrmann Schmitz mit den Begriffen „Verdichtungsbereich“ und „Verankerungspunkt“ wird zur Differenzierung von Gefühlen vorgestellt.
Wie werden Schuld und Scham analysiert?
Das dritte Kapitel analysiert Schuld und Scham aus aristotelischer Sicht. Es betrachtet Scham als Reaktion auf einen Normverstoß, differenziert zwischen akutem Schamgefühl und Scham als Disposition und beleuchtet die Vielschichtigkeit des Begriffs „Schuld“ im Deutschen. Die Verbindung von Schuld und Scham mit der Moral wird hervorgehoben, ohne diese ausschließlich als moralisch einzustufen.
Wie wird Stolz analysiert?
Das vierte Kapitel untersucht den Stolz, seine körperlichen Äußerungen, seine Rolle in der Philosophiegeschichte und seinen Einfluss durch die Staatsangehörigkeit. Es wird im Kontext des Nationalstolzes und der deutschen Geschichte analysiert.
Welche Rolle spielt die deutsche Nationalität?
Die deutsche Nationalität spielt eine zentrale Rolle, indem die Arbeit die Gefühle Schuld, Scham und Stolz im Kontext der historischen Verantwortung Deutschlands für den Nationalsozialismus und der aktuellen gesellschaftlichen Debatte um Nationalstolz (z.B. im Kontext von PEGIDA) untersucht. Der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf die Wahrnehmung dieser Gefühle werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schuld, Scham, Stolz, Nationalstolz, Nationalsozialismus, Moral, Philosophiegeschichte, Körperliche Äußerungen, Gefühl, Emotion, Verantwortung, Deutschland, Identität.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die zentralen Inhalte und Argumentationslinien jedes Abschnitts kurz und prägnant wiedergibt.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit den Themen Schuld, Scham, Stolz und deren gesellschaftlichen und philosophischen Implikationen auseinandersetzt. Sie ist besonders relevant für die Bereiche Philosophie, Pädagogik und Geschichtswissenschaft.
- Citation du texte
- Christopher Brogle (Auteur), 2015, Deutschland zwischen Schuld, Scham und Stolz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/349928