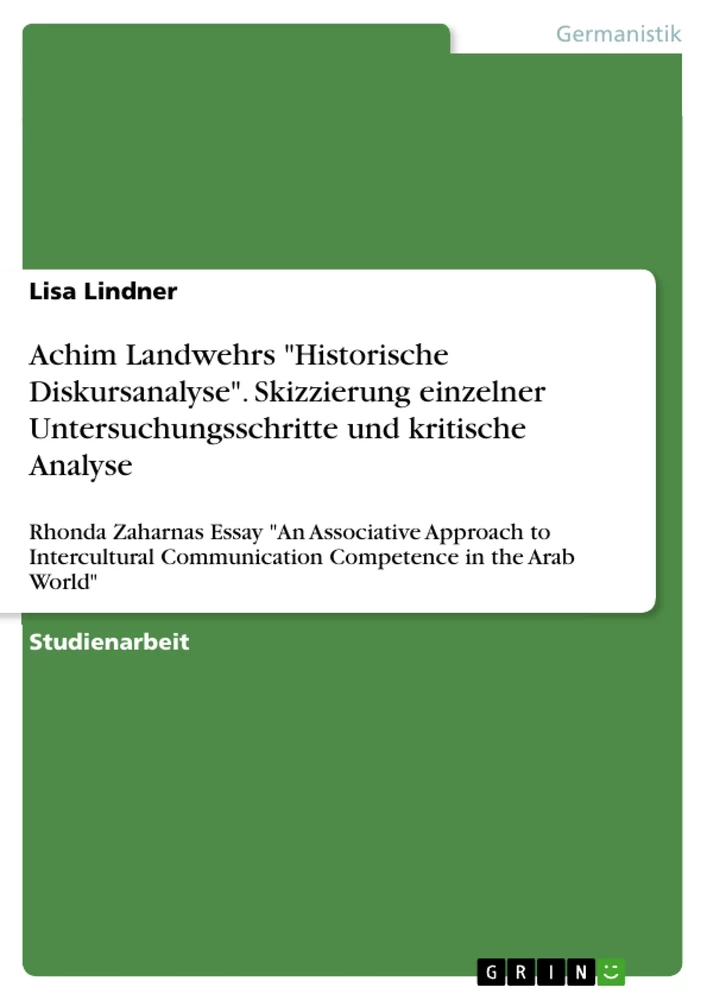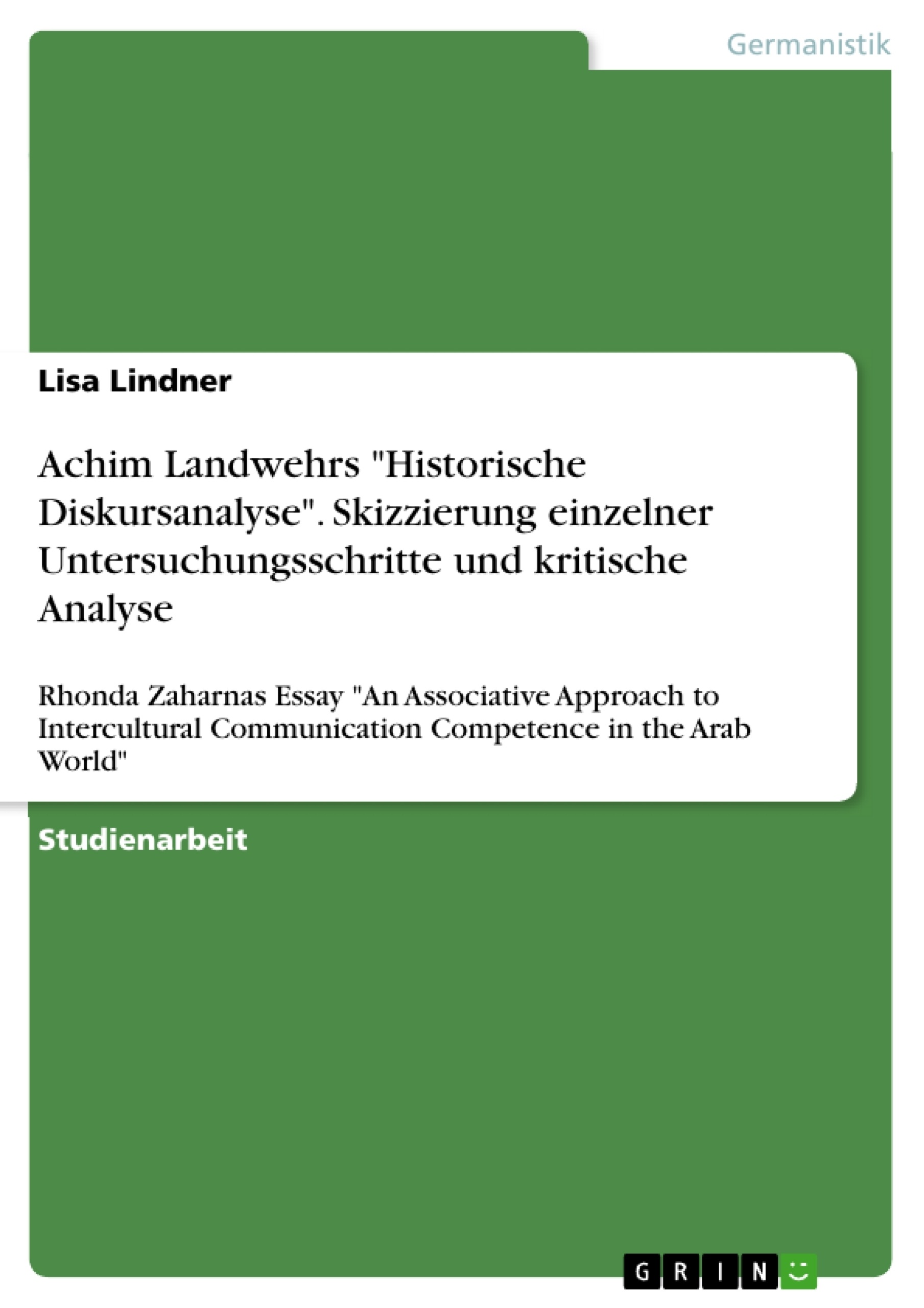In seiner zu einem Standardwerk avancierten "Historischen Diskursanalyse" wagt der deutsche Historiker und Sachautor Achim Landwehr nicht nur den Versuch, eine leicht verständliche Erklärung des Begriffes Diskurs zu formulieren sowie dessen Entstehungsgeschichte des Überblicks halber kurz zu umreißen, sondern er unternimmt in seiner Theorie auch einen Ausflug zu den Wurzeln der historischen Diskursanalyse, die außerhalb der Geschichtswissenschaften angesiedelt sind. Vor allem die Diskurstheorien in der Philosophie und Soziologie jenseits der 1960er Jahre sind Zentrum seiner Untersuchungen und sollen auch im Folgenden kurz umrissen werden.
Besonders spannend und wichtig für die hier vorliegende Arbeit ist jedoch vor allem Landwehrs Versuch, konkrete Untersuchungsschritte im Rahmen einer historischen Diskursanalyse zu formulieren, deren Skizzierung und Erprobung in der Praxis als Exkurs dieses Aufsatzes dienen soll. Indem er die einzelnen Arbeitsschritte zu einer erfolgreichen Diskursanalyse genau erklärt und durchexerziert, hofft er, den Zugang zum Begriff Diskurs zu öffnen und leichter verständlich zu machen.
Da ein solcher Ansatz der hier vorliegenden Arbeit allzu theorielastig erscheinen mag, soll in einem zweiten Teil Achim Landwehrs Formulierung zu einzelnen Untersuchungsschritten einer Diskursanalyse auf die Probe gestellt werden. Anhand eines Fallbeispiels – Rhonda Zaharnas Essay "An Associative Approach to Intercultural Communication Competence in the Arab World" – soll sich zeigen, ob Landwehrs theoretischer Ansatz auch in der Praxis Bestand hat.
Zaharnas Essay eignet sich insofern zur Analyse, als dass die amerikanische Autorin mit palästinensischen Wurzeln ganz im Zeichen der Interkulturalität und kulturellen Diversität den Ansatz vertritt, dass die arabische Welt aufgrund ihrer innerlichen Unterschiede kaum als kulturelle Einheit verstanden werden kann. Dennoch formuliert Zaharna ein Modell, in dem sie die Haltung, Sichtweise und Weltdeutung der Menschen aus der arabischen Welt festhält – auf der Basis eines westlichen Modells. Warum die Autorin derart große Probleme hat, die Entität der arabischen Welt als ein diskursives Konstrukt zu verstehen, das noch dazu durch den Westen generiert worden ist, soll mithilfe von Landwehrs Untersuchungsschritten überprüft werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Sicherheit über die eigene Wirklichkeit - Kurze Begriffserklärung und Begriffsgeschichte von Diskurs
- 2. Der Diskursbegriff und seine Einbindung in unterschiedliche Kontexte - Vier Diskurstheorien im Überblick
- 2.1 Diskursethik nach Jürgen Habermas
- 2.2 Der Diskurs und seine Ordnungsfunktion bei Michel Foucault
- 2.3 Pierre Bourdieu - Sozialbeziehungen als symbolische Machtbeziehungen
- 2.4 Diskurs als strukturierte Totalität bei Ernesto Laclau und Chantal Mouffe
- 2.5 Zusammenfassende Erkenntnisse - Die historische Diskursanalyse als Ergebnis sozialer Kommunikationsprozesse
- 3. Untersuchungsschritte zur Diskursanalyse nach Achim Landwehr
- 3.1 Themenfindung
- 3.2 Korpusbildung
- 3.3 Kontextanalyse
- 3.4 Analyse von Aussagen und Texten
- 3.5 Zusammenfassende Erkenntnisse - Ergebnisse der Diskursanalyse
- 4. Rhonda Zaharna: An Associative Approach to Intercultural Communication Competence in the Arab World
- 4.1 Interkulturalität und kulturelle Diversität in der arabischen Welt
- 4.2 Exkurs Kultur und Kulturwissenschaft - ein Definitionsversuch
- 4.3 Associative View of Communication - Kategorisierung eines arabischen Weltverständnisses
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die historische Diskursanalyse nach Achim Landwehr und erprobt ihren praktischen Einsatz anhand eines Fallbeispiels: Rhonda Zaharnas Essay „An Associative Approach to Intercultural Communication Competence in the Arab World“. Ziel ist es, Landwehrs theoretischen Ansatz zu verstehen, seine Untersuchungsschritte zu erläutern und zu bewerten, ob sich diese in der Praxis bewähren.
- Begriffserklärung und Begriffsgeschichte von Diskurs
- Diskurstheorien verschiedener Autoren wie Jürgen Habermas, Michel Foucault, Pierre Bourdieu und Ernesto Laclau/Chantal Mouffe
- Konkrete Untersuchungsschritte der historischen Diskursanalyse nach Landwehr
- Analyse von Rhonda Zaharnas Essay im Kontext der Interkulturalität und kulturellen Diversität in der arabischen Welt
- Bewertung des Ansatzes von Landwehr und seiner Anwendbarkeit in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der historischen Diskursanalyse. Kapitel 1 definiert den Begriff "Diskurs" und zeichnet seine Begriffsgeschichte nach. Kapitel 2 stellt vier Diskurstheorien im Überblick vor, die für die historische Diskursanalyse relevant sind. Kapitel 3 beschreibt die einzelnen Untersuchungsschritte der historischen Diskursanalyse nach Landwehr. Kapitel 4 analysiert Rhonda Zaharnas Essay und untersucht, wie die arabische Welt in diesem Kontext dargestellt wird. Die Zusammenfassung und der Ausblick fassen die Ergebnisse der Arbeit zusammen und geben einen Ausblick auf mögliche weitere Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Historische Diskursanalyse, Diskursbegriff, Diskurstheorien, Interkulturalität, kulturelle Diversität, arabische Welt, Rhonda Zaharna, Achim Landwehr, Untersuchungsschritte, Kontextanalyse, Kommunikation, Wissen, Wirklichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der historischen Diskursanalyse nach Achim Landwehr?
Ziel ist es, die Entstehung von Wissen und Wirklichkeit in historischen Kontexten durch die Untersuchung sprachlicher und sozialer Prozesse nachzuvollziehen.
Welche Untersuchungsschritte schlägt Landwehr vor?
Die Schritte umfassen Themenfindung, Korpusbildung (Quellenauswahl), Kontextanalyse sowie die detaillierte Analyse von Aussagen und Texten.
Welche Diskurstheorien werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit gibt einen Überblick über die Theorien von Jürgen Habermas, Michel Foucault, Pierre Bourdieu sowie Ernesto Laclau und Chantal Mouffe.
Was wird am Fallbeispiel von Rhonda Zaharna untersucht?
Es wird geprüft, ob Landwehrs Methode geeignet ist, Zaharnas Darstellung der arabischen Welt als diskursives Konstrukt aus einer westlichen Perspektive zu analysieren.
Was bedeutet "Korpusbildung" in der Diskursanalyse?
Korpusbildung bezeichnet die systematische Zusammenstellung von Texten und Quellen, die für die Untersuchung eines bestimmten Diskurses relevant sind.
Wie hängen Wissen und Macht in der Diskursanalyse zusammen?
Diskurse bestimmen, was in einer Gesellschaft als "wahr" gilt. Damit sind sie eng mit Machtverhältnissen verknüpft, wie besonders im Ansatz von Foucault und Bourdieu deutlich wird.
- Quote paper
- Lisa Lindner (Author), 2016, Achim Landwehrs "Historische Diskursanalyse". Skizzierung einzelner Untersuchungsschritte und kritische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350038