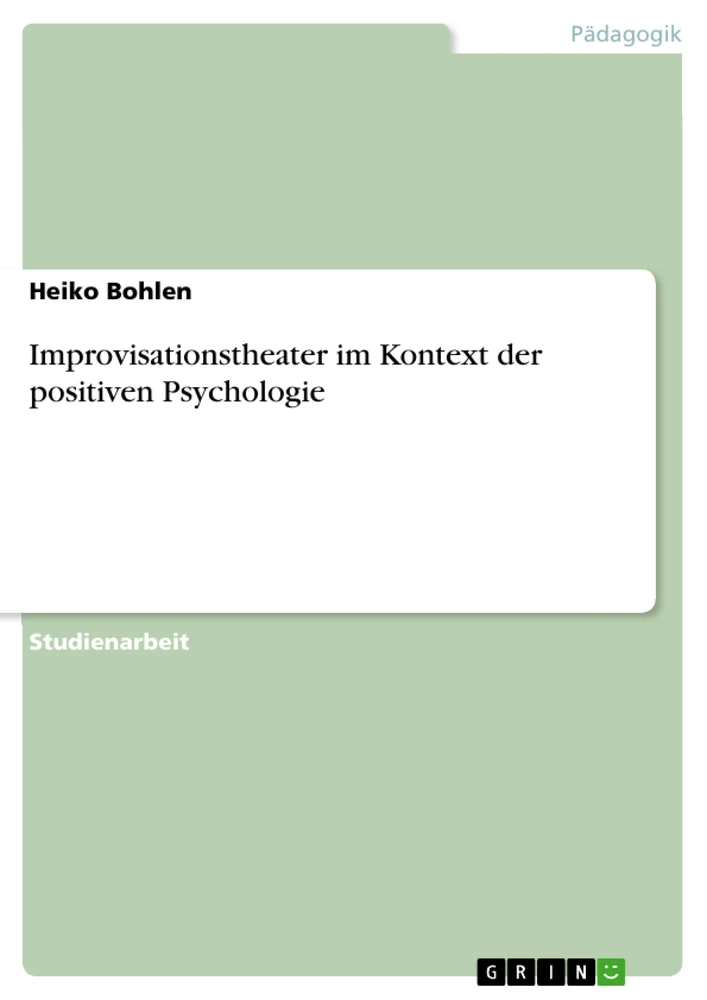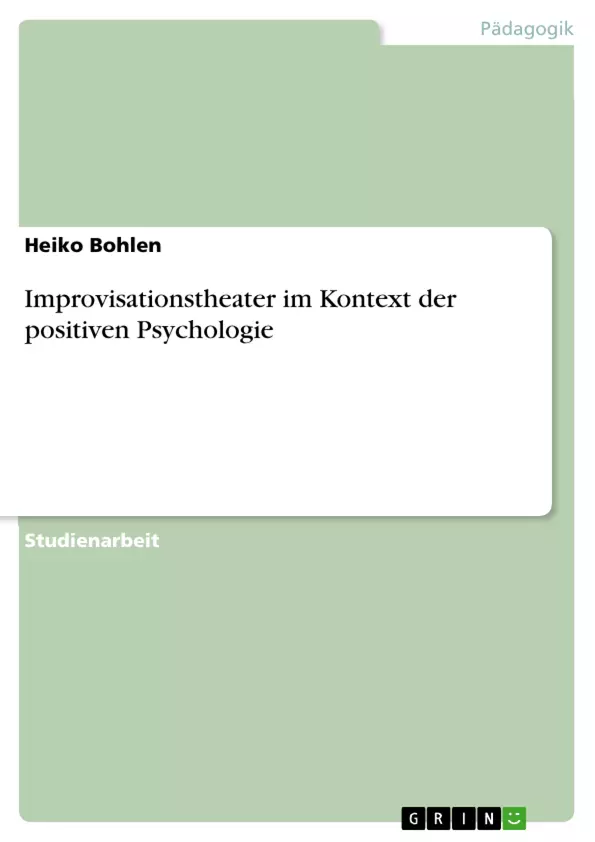Die Positive Psychologie ist kurz gesagt die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem glücklichen Leben. Es geht ihr in erster Linie nicht darum, wie Krankheiten entstehen und wie man sie behandelt, sondern darum, zu unterstützen und zu untersuchen, wie Menschen glücklicher werden. Bekannt wurde dieser Ansatz vor allem durch den US-amerikanischen Psychologen Martin Seligman Ende des letzten Jahrhunderts. Bis heute ist diese Strömung der Psychologie immer bedeutsamer geworden. Sie prägt beispielsweise die moderne psychologische Auseinandersetzung mit der Frage nach guter Unternehmensführung und führte zu neuen Therapieansätzen.
Ein weiterer Einflussfaktor der Positiven Psychologie ist mittlerweile die Schule. Das an ersten Schulen in Deutschland eingeführte Schulfach Glück geht in eine ähnliche Richtung und versucht wissenschaftliche Erkenntnisse der Positiven Psychologie in die Schule zu übertragen.
Eine zentrale Annahme bei Seligman und Ausgangspunkt für seine Theorie ist, dass Glück zu einem großen Anteil lernbar ist. Dieser Prozess wird mit Flourishing bezeichnet, d.h. dem Aufblühen einer Person und der damit verbundenen Steigerung des Wohlbefindens. Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit dieses Flourishing durch eine spezielle Form des Theaterspiels, dem Improvisationstheater, unterstützt und gefördert werden kann.
Improvisationstheater unterscheidet sich vom klassischen Theater insofern, als dass es weder ein Skript noch festgelegte Rollen o.ä. gibt, sondern das gesamte Spiel durch freies, improvisiertes Spiel der Schauspieler spontan entsteht. Um die leitende Fragestellung zu beantworten wird zunächst die Positive Psychologie in ihren Grundzügen dargestellt. Dabei wird vor allem auf den wichtigsten Vertreter Seligman und seine Theorie des Wohlbefindens eingegangen. Eine weitere bedeutsame Arbeit innerhalb der Positiven Psychologie ist die von Fredrickson (2001) entwickelte Broaden- und Built-Theorie positiver Emotionen.
Aufgrund des Rahmens dieser Ausarbeitung und der zu untersuchenden Aspekte beim Improvisationstheater beschränkt sich die Analyse der Positiven Psychologie auf diese Autoren . Daran schließt sich eine genaue Betrachtung des Improvisationstheaters an. Es wird zum einen dargestellt, was das Improvisationstheater genau ist und zum anderen, inwiefern es sich vom klassischen Theater unterscheidet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Positive Psychologie
- Ursprünge
- Theorie des Wohlbefindens
- Broaden- und Built-Theorie positiver Emotionen
- Improvisations-Theater
- Improvisationstheater im Kontext der positiven Psychologie
- Improvisationstheater mit Kindern
- Flourishing beim Improvisationstheater
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, inwieweit Improvisationstheater zur Förderung von Flourishing und Wohlbefinden beitragen kann. Sie betrachtet die Positive Psychologie als theoretischen Rahmen und untersucht, wie Improvisationstheater die zentralen Konzepte der Positiven Psychologie wie positive Emotionen, Stärken und Sinnfindung unterstützt.
- Positive Psychologie und ihre Anwendung im pädagogischen Kontext
- Theorie des Wohlbefindens nach Seligman und die Bedeutung von Flourishing
- Improvisationstheater als pädagogisches Mittel zur Förderung von Kreativität und Selbstvertrauen
- Der Einfluss von Improvisationstheater auf positive Emotionen und das Erleben von Flow
- Die Rolle von Improvisationstheater in der Entwicklung von sozialen Kompetenzen und interpersonellen Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung gibt einen Überblick über das Thema und die Forschungsfrage. Sie beleuchtet die zentrale Rolle der Positiven Psychologie für die Untersuchung von Glück und Wohlbefinden und stellt den Ansatz des Improvisationstheaters als potenzielles Mittel zur Förderung von Flourishing vor.
- Das zweite Kapitel beschreibt die Ursprünge der Positiven Psychologie und beleuchtet die zentralen Theorien von Seligman und Fredrickson. Es wird auf die Theorie des Wohlbefindens und die Broaden- und Built-Theorie positiver Emotionen eingegangen.
- Im dritten Kapitel wird das Improvisationstheater als Spielform definiert und von traditionellen Theaterformen abgegrenzt. Es werden die charakteristischen Elemente des Improvisationstheaters dargestellt und die Bedeutung von Spontaneität und Kreativität hervorgehoben.
- Kapitel vier analysiert die Verbindung zwischen Improvisationstheater und der Positiven Psychologie. Es wird untersucht, wie das Improvisationstheater zu positivem emotionalen Erleben, dem Aufbau von Stärken und dem Erlangen von Sinn beitragen kann. Besonders die Förderung von Selbstbewusstsein, Empathie und Teamarbeit wird beleuchtet.
- Der Schwerpunkt von Kapitel 4.1 liegt auf der Bedeutung des Improvisationstheaters für die Entwicklung von Kindern. Es werden die positiven Auswirkungen des Improvisationstheaters auf die soziale, kognitive und emotionale Entwicklung von Kindern erläutert.
Schlüsselwörter
Positive Psychologie, Wohlbefinden, Flourishing, Improvisationstheater, Flow, Kreativität, Selbstbewusstsein, soziale Kompetenz, Theaterpädagogik, Kinder, Entwicklung, Emotionen, Stärken, Sinn
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Positiven Psychologie?
Die Positive Psychologie befasst sich wissenschaftlich mit dem "glücklichen Leben". Statt sich auf Krankheiten zu konzentrieren, untersucht sie, wie Menschen Wohlbefinden steigern und "aufblühen" (Flourishing) können.
Wie unterscheidet sich Improvisationstheater vom klassischen Theater?
Improvisationstheater verzichtet auf Skripte und feste Rollen. Die Szenen entstehen spontan aus dem Moment heraus durch die Interaktion der Schauspieler.
Was bedeutet "Flourishing" im Kontext des Theaterspiels?
Flourishing bezeichnet das persönliche Aufblühen. Durch Improvisationstheater kann dies gefördert werden, indem Selbstvertrauen, Kreativität und positive Emotionen durch das spontane Spiel gestärkt werden.
Was besagt die Broaden-and-Build-Theorie?
Diese Theorie von Barbara Fredrickson besagt, dass positive Emotionen das Denk- und Handlungsrepertoire erweitern (broaden) und langfristig Ressourcen für die persönliche Entwicklung aufbauen (build).
Warum ist Improtheater besonders für Kinder wertvoll?
Es unterstützt die soziale, kognitive und emotionale Entwicklung, fördert die Empathie und hilft Kindern, spielerisch mit Fehlern umzugehen und Teamfähigkeit zu entwickeln.
- Quote paper
- Heiko Bohlen (Author), 2015, Improvisationstheater im Kontext der positiven Psychologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350531