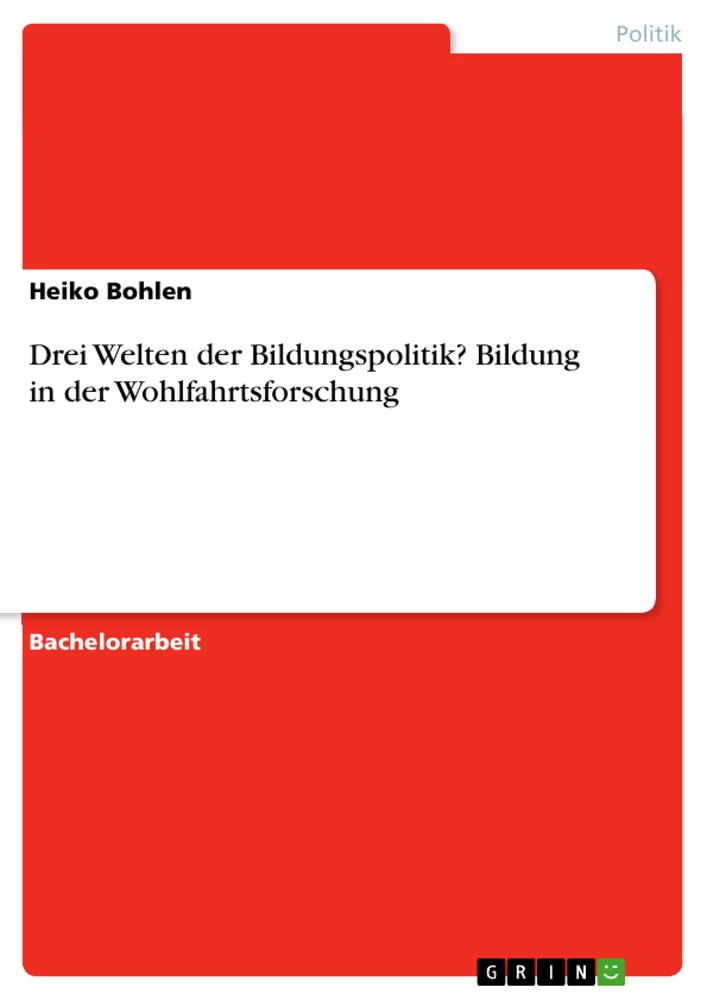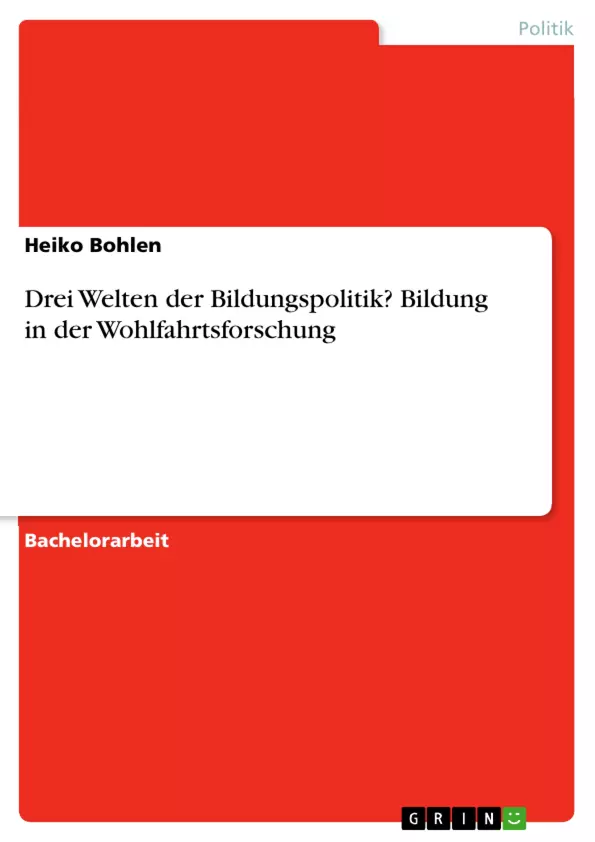Wer sich mit Esping-Andersen und den „Three Worlds of Welfare Capitalism“ (1990) beschäftigt, findet eine große Menge an Literatur vor. Kein anderer in der Wohlfahrtsforschung wurde und wird so viel zitiert und behandelt wie der dänische Soziologie und Politikwissenschaftler. Dazu zählen naturgemäß sowohl unzählige positive Rezensionen als auch sehr viel Kritik und Überarbeitungen, gerade im Hinblick auf die von ihm 1990 erarbeitete Typologie von Wohlfahrtsstaaten.
Einige Punkte lassen sich bei den vielen verschiedenen Meinungen über Esping-Andersen schnell feststellen: Mit Daten aus den 80er Jahren ist es zum einen nicht verwunderlich, dass seine empirischen Beobachtungen heutzutage längst überholt sind und die Einordnung der Staaten in seine Typologie angezweifelt werden müssen. Zum anderen beschreibt „The Three Worlds of Welfare Capitalism“ in seiner Vorgehensweise die wirkliche Welt in keiner Weise ausreichend – allein schon aufgrund der Tatsache, dass ganze Kontinente wie Südamerika oder Afrika gar nicht berücksichtigt werden. Dennoch gehe ich davon aus, dass sich auch heute noch, fast 25 Jahre später, wesentliche Grundzüge der Typologie in den Wohlfahrtsstaaten wiederfinden lassen. Der Politikwissenschaftler Schmid behauptet sogar, dass „die Typologie von Esping-Andersen zum Dreh- und Angelpunkt der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung geworden und auch nach 20 Jahren noch geblieben“ (Schmid 2010: 91) ist. Festhalten kann man in jedem Fall, dass man nicht an Esping-Andersen vorbeikommt, wenn man sich mit der Wohlfahrtsforschung beschäftigen möchte.
Bei der Auseinandersetzung mit Esping-Andersen und der Lektüre seines zentralen Buches „The Three Worlds of Welfare Capitalism“ habe ich jedoch das Politikfeld Bildung vermisst. Für mich war das unverständlich, da ich Bildungspolitik als vorausschauende Sozialpolitik verstehe und Bildung insgesamt als eines der zentralen Faktoren für die Zukunft wohlfahrtsstaatlichen Handelns begreife. Nicht zuletzt die Ergebnisse der PISA-Studien haben gezeigt, dass durch die sogenannte Bildungsvererbung das Thema Bildung auch in wohlfahrtsstaatlich relevante Bereiche hineinspielt und soziale Aufstiegschancen bestimmt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bildung in der Wohlfahrtsforschung
- 2.1 Klärung und Abgrenzung grundlegender Begriffe
- 2.2 Vernachlässigung der Bildung in der Wohlfahrtsforschung
- 2.3 Bildungspolitik als Gegenstandsbereich der Wohlfahrtsforschung?
- 3. Esping-Andersens Typologie der Wohlfahrtsregime
- 3.1 Theoretische Grundlagen
- 3.2 Wohlfahrtsregime und Unterscheidungsmerkmale der Typologie
- 3.3 Typologie der Wohlfahrtsregime
- 3.3.1 Liberales Wohlfahrtsregime
- 3.3.2 Konservatives Wohlfahrtsregime
- 3.3.3 Sozialdemokratisches Wohlfahrtsregime
- 3.4 Überarbeitung durch Esping-Andersen
- 3.5 Ergänzung der Typologie
- 4. Drei Welten der Bildungspolitik?
- 4.1 Vorüberlegungen
- 4.2 Bildungsungerechtigkeit
- 4.3 Finanzindikatoren
- 4.4 Bildungsniveau
- 4.5 Zusammenfassung: Vorschlag einer Typologie
- 4.5.1 Sozialdemokratisches Bildungsregime
- 4.5.2 Konservatives Bildungsregime
- 4.5.3 Liberales Bildungsregime
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwiefern Esping-Andersens Typologie der Wohlfahrtsregime auf das Politikfeld Bildung übertragen werden kann. Sie beleuchtet das Verhältnis der beiden Politikfelder und analysiert die Bedeutung dieser Übertragung für die Wohlfahrtsforschung.
- Definition und Abgrenzung grundlegender Begriffe wie Bildung, Wohlfahrtsstaat und Sozialstaat
- Analyse der Vernachlässigung bildungspolitischer Themen in der klassischen Wohlfahrtsforschung
- Diskussion, ob Bildungspolitik einen größeren Stellenwert in der Wohlfahrtsforschung einnehmen sollte
- Übertragung der Typologie der Wohlfahrtsregime auf das Politikfeld Bildung anhand von Forschungsergebnissen zu Bildungsungerechtigkeit, Bildungsfinanzierung und Bildungsniveau
- Entwicklung eines Vorschlags für eine Typologie von Bildungsregimen, um die Möglichkeiten der Übertragbarkeit auf Esping-Andersens Ansatz zu verdeutlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz von Esping-Andersens Typologie für die Wohlfahrtsforschung betont und gleichzeitig die Lücke im Fokus auf Bildung kritisiert. Anschließend werden grundlegende Begriffe geklärt und die Vernachlässigung der Bildung in der Wohlfahrtsforschung diskutiert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Bildungspolitik als eigenständiger Gegenstandsbereich der Wohlfahrtsforschung betrachtet werden sollte.
Im nächsten Schritt wird Esping-Andersens Typologie der Wohlfahrtsregime vorgestellt, einschließlich ihrer theoretischen Grundlagen und der Unterscheidung in liberale, konservative und sozialdemokratische Regime.
Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob diese Typologie auf das Politikfeld Bildung übertragen werden kann. Hierfür werden Forschungsergebnisse zu Bildungsungerechtigkeit, Bildungsfinanzierung und Bildungsniveau präsentiert und auf ihre Übereinstimmung mit Esping-Andersens drei Welten untersucht.
Abschließend wird ein Vorschlag für eine Typologie von Bildungsregimen entwickelt, der die Übertragbarkeit von Esping-Andersens Ansatz auf das Politikfeld Bildung verdeutlicht. Das Fazit diskutiert die Bedeutung der Arbeit für die Wohlfahrtsforschung.
Schlüsselwörter
Bildungspolitik, Wohlfahrtsforschung, Esping-Andersen, Wohlfahrtsregime, Bildungsungerechtigkeit, Bildungsfinanzierung, Bildungsniveau, Typologie, Sozialstaat, Sozialpolitik, Bildungsvererbung.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Esping-Andersen und was sind die „Three Worlds of Welfare Capitalism“?
Esping-Andersen ist ein Soziologe, der 1990 eine Typologie von Wohlfahrtsstaaten in liberale, konservative und sozialdemokratische Regime entwickelte.
Wird Bildung in der klassischen Wohlfahrtsforschung berücksichtigt?
Die Arbeit kritisiert, dass Bildung in den klassischen Modellen von Esping-Andersen weitgehend vernachlässigt wurde, obwohl sie als „vorausschauende Sozialpolitik“ gilt.
Was versteht man unter „Bildungsvererbung“?
Bildungsvererbung bezeichnet den Effekt, dass soziale Aufstiegschancen und Bildungserfolg stark vom Bildungshintergrund der Eltern abhängen (PISA-Studie).
Wie lassen sich Bildungsregime typologisieren?
Die Arbeit schlägt eine Einteilung in sozialdemokratische, konservative und liberale Bildungsregime vor, analog zu den Wohlfahrtsstaaten.
Welche Indikatoren werden zum Vergleich der Bildungsregime genutzt?
Zur Analyse werden Finanzindikatoren, das allgemeine Bildungsniveau und das Ausmaß an Bildungsungerechtigkeit herangezogen.
- Citar trabajo
- Heiko Bohlen (Autor), 2014, Drei Welten der Bildungspolitik? Bildung in der Wohlfahrtsforschung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350532