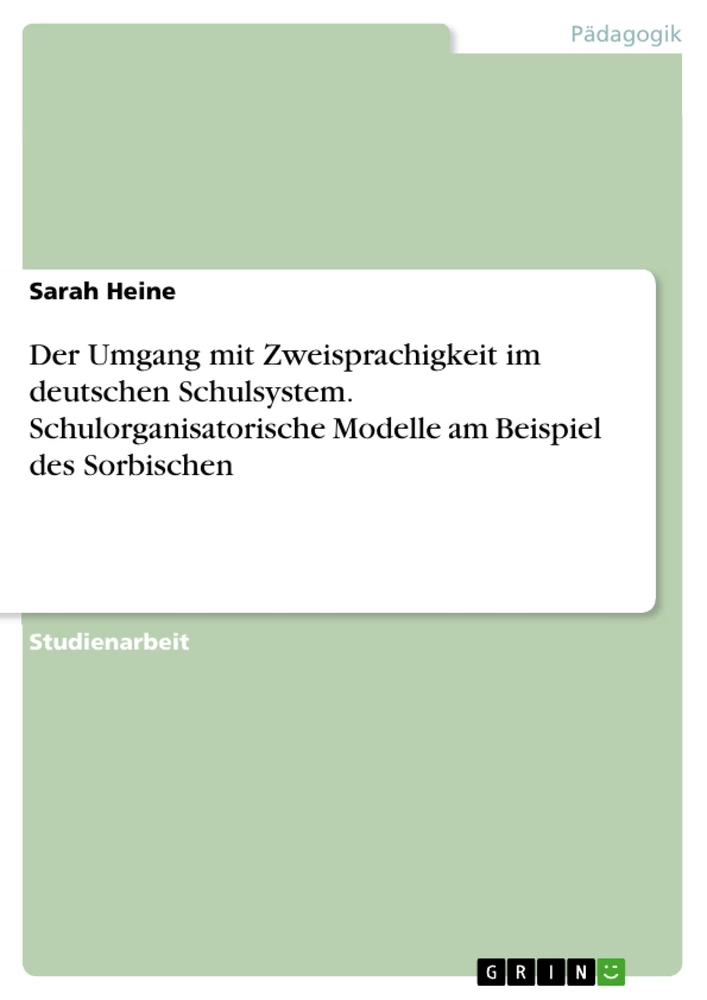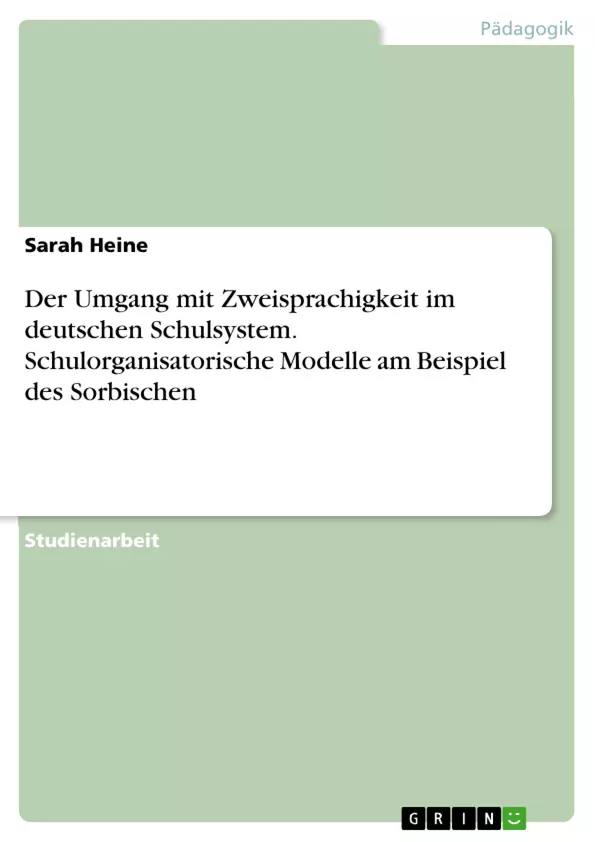Die Sorben werden in der BRD zu den autochthonen Minderheiten gezählt. Als solche genießen ihre Kultur und Sprache einen besonderen gesetzlichen Schutz. Dieser Schutz manifestiert sich unter anderem in der Bildungspolitik.
Ziel dieser Arbeit wird es sein, die schulischen Maßnahmen bezüglich der deutsch-sorbischen Zweisprachigkeit zu benennen, zu beschreiben und theoretisch einzuordnen.
Den Anfang der Arbeit soll die theoretische Grundlage bilden. Eine kurze Darstellung der von Reich und Roth benannten schulorganisatorischen Modelle, welchen die Maßnahmen bezüglich der Unterrichtung zweisprachiger Schüler zugeordnet werden können, soll dies bewerkstelligen. Diese Darstellung soll sowohl die allgemeine Terminologie, als auch deren Anwendung auf das deutsche Schulsystem beinhalten. Im Anschluss daran soll die autochthone Minderheit der Sorben nähere Beachtung finden. Dabei wird, auf Grund der Thematik der Arbeit, der Schwerpunkt auf der sorbischen Sprache liegen.
Daran anschließend werde ich mich den rechtlichen Hintergründen, welche den schulischen Maßnahmen in Bezug auf die deutsch-sorbische Zweisprachigkeit zu Grunde liegen, zuwenden. Hierbei soll sowohl die europäische, die bundesdeutsche, als auch die Länderebene Beachtung finden. In diesem Zusammenhang werden auch sorbische Vereinigungen genannt und beschrieben, welche an der Bildungspolitik aktiv beteiligt sind.
Dem rechtlichen bzw. rechtspolitischen Exkurs soll eine differenzierte Beschreibung des Umgangs sorbisch-deutscher Schulen mit der Zweisprachigkeit im sorbischen Verbreitungsgebiet folgen. Diese Darstellung wird geteilt nach Bundesland durchgeführt werden, da sowohl der Freistaat Sachsen als auch das Bundesland Brandenburg verschiedenen ausformulierte Landesverfassungen und Schulgesetze haben, in denen der Umgang mit dem Sorbischen festgeschrieben ist. Nach dieser Darstellung der schulischen Maßnahmen bezüglich der deutsch-sorbischen Zweisprachigkeit soll der Versuch gewagt werden, jene Maßnahmen denen zu Beginn beschriebenen schulorganisatorischen Modellen zuzuordnen. Auch dies wird auf Grund der schon genannten Gründen bundeslandspezifisch erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schulorganisatorische Modelle im Vergleich
- Einsprachige Modelle
- Zweisprachige Modelle
- Modelle zweisprachiger Bildung in Deutschland
- Die Sorben – eine kurze Einführung
- Rechtliche Hintergründe des sorbischen Schulwesens
- Rechtsnormen auf Europa- und Bundesebene
- Rechtsnormen auf Landesebene
- Weitere Akteure sorbischer Bildungspolitik
- Das Sorbische in der Schule – eine Bestandsaufnahme
- Das Sorbische an Schulen des Landes Brandenburg
- Das Sorbische an Schulen des Freistaates Sachsen
- Schulorganisatorische Modelle - Das Sorbische...
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem schulischen Umgang mit der deutsch-sorbischen Zweisprachigkeit in Deutschland. Ziel ist es, die verschiedenen schulischen Maßnahmen zu benennen, zu beschreiben und theoretisch einzuordnen. Hierzu wird das Modellkonzept von Reich/ Roth erläutert und auf die Situation der deutsch-sorbischen Zweisprachigkeit angewendet.
- Theoretische Einordnung schulorganisatorischer Modelle für die Unterrichtung zweisprachiger Schüler
- Beschreibung der Situation der sorbischen Minderheit in Deutschland mit Fokus auf die sorbische Sprache
- Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen für den schulischen Umgang mit der deutsch-sorbischen Zweisprachigkeit auf europäischer, bundesdeutscher und Länderebene
- Präsentation der aktuellen Praxis des sorbischen Unterrichts in Brandenburg und Sachsen
- Zuordnung der schulischen Maßnahmen zu den theoretischen Modellen und Analyse der Rolle zweisprachiger Schulen für den Erhalt der sorbischen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Sorben als autochthone Minderheit mit besonderem Schutz für Kultur und Sprache vor und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Die Kapitel 2 und 2.1 beschäftigen sich mit der theoretischen Grundlage, indem verschiedene schulorganisatorische Modelle für den Umgang mit zweisprachigen Schülern vorgestellt werden, wobei die einsprachigen Modelle Submersion und Immersion näher beleuchtet werden. Kapitel 2.2 geht auf die zweisprachigen Modelle Transitorisch, Language-maintenance und Two-way-immersion ein. Kapitel 2.3 zeigt, wie diese Modelle in Deutschland Anwendung finden. Kapitel 3 bietet eine kurze Einführung in die sorbische Minderheit, ihre Kultur und Sprache.
Schlüsselwörter
Zweisprachigkeit, Bildungspolitik, Schulorganisatorische Modelle, Submersion, Immersion, Transitorisch, Language-maintenance, Two-way-immersion, Sorben, Minderheiten, Rechtliche Rahmenbedingungen, Sprache, Kultur, Sprachpolitik, Deutschland, Brandenburg, Sachsen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Zweisprachigkeit im deutschen Schulsystem gefördert?
Es gibt verschiedene Modelle wie Immersion, Language-maintenance oder Two-way-immersion, die je nach Bundesland unterschiedlich umgesetzt werden.
Wer sind die Sorben?
Die Sorben sind eine autochthone (einheimische) Minderheit in Deutschland, deren Sprache und Kultur gesetzlich besonders geschützt sind.
Was ist der Unterschied zwischen dem sorbischen Schulwesen in Sachsen und Brandenburg?
Beide Bundesländer haben eigene Landesverfassungen und Schulgesetze, die den Umgang mit der sorbischen Sprache in den Schulen individuell regeln.
Was bedeutet „Language-maintenance“?
Dieses Modell zielt darauf ab, die Herkunftssprache der Schüler (hier Sorbisch) zu erhalten und neben der Mehrheitssprache Deutsch aktiv zu fördern.
Welche rechtlichen Grundlagen schützen das Sorbische?
Der Schutz basiert auf Rechtsnormen der Europäischen Union, des Bundes sowie den spezifischen Minderheitengesetzen der Länder Sachsen und Brandenburg.
- Citar trabajo
- Sarah Heine (Autor), 2011, Der Umgang mit Zweisprachigkeit im deutschen Schulsystem. Schulorganisatorische Modelle am Beispiel des Sorbischen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350632