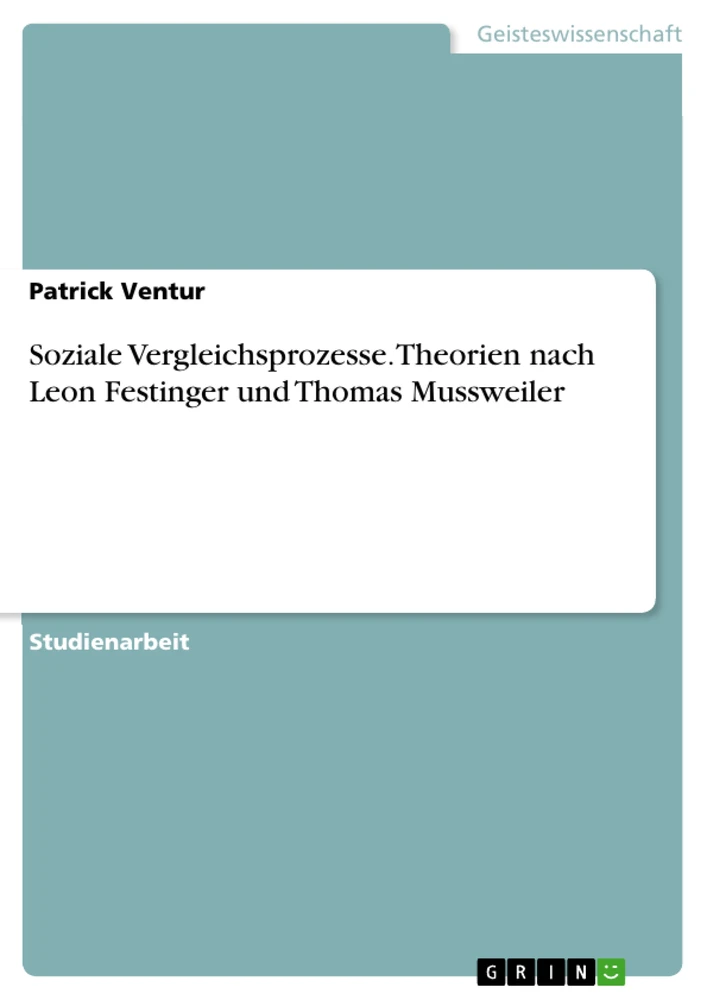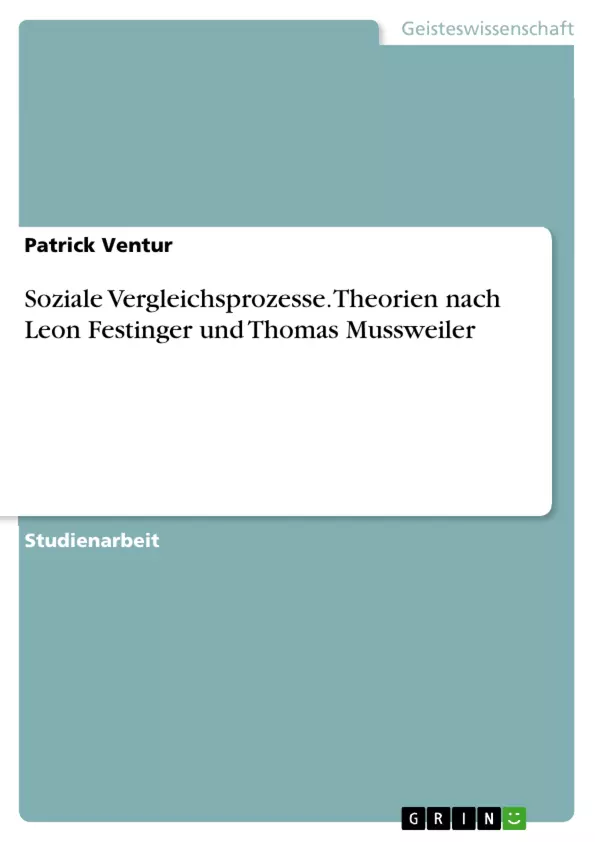Der wohl deutlichste Unterschied zwischen Mensch und Tier ist die Fähigkeit des Menschen zur Selbstreflektion, das Entstehen eines Bildes von einem selbst durch Reflektion der eigenen Erlebnisse, Erfahrungen oder Emotionen. Dieses „Selbst“ manifestiert unter anderem durch das Selbstkonzept, die Selbstwahrnehmung, Selbstaufmerksamkeit und Selbstregulation. Das Wissen über das Selbst, also die Selbsterkenntnis, wird durch drei verschiedene Prozesse erlangt. Diese Prozesse sind Introspektion, Selbstwahrnehmung und soziale Vergleiche.
Kommunikation als Schlüssel für komplexe soziale Strukturen und Interaktion macht es möglich, sich selbst und seine Erfahrungen, Emotionen und Erlebnisse mit anderen zu teilen. Vergleiche mit anderen Menschen, also soziale Vergleiche, helfen dabei, diese Informationen für sich nutzbar zu machen. Sie beeinflussen somit die Beurteilung und das Erleben von Ereignissen: Wie gut bin ich im Sport? Habe ich in dieser Situation richtig gehandelt? Ist meine Einschätzung angemessen oder hätte ich anders reagieren sollen?
Soziale Vergleiche begegnen einem unweigerlich in jeder alltäglichen Situation: im Büro, bei der Beurteilung der Gerechtigkeit von Aufgabenverteilungen, im Fitnessstudio, wenn es darum geht, wer der Schnellste oder Stärkste ist, oder in sozialen Netzwerken, wenn die Anzahl von Freunden oder Likes verglichen werden. Die Allgegenwärtigkeit von sozialen Vergleichen macht die Theorie sozialer Vergleichsprozesse und der zugrunde liegenden Mechanismen zu einem zentralen Thema der Sozialpsychologie (vgl. Mussweiler, 2006, S. 103).
Die vorliegende Seminararbeit beschäftigt sich mit der Theorie sozialer Vergleichsprozesse von Leon Festinger (1954) und dem aktuellen Stand der Theorie nach Mussweiler (2006). Neue Forschungsergebnisse zur Theorie werden im Anschluss diskutiert.
Die von Mussweiler genannten zentralen Fragen des Forschungsinteresses für soziale Vergleichsprozesse sollen dabei die Struktur dieser Seminararbeit vorgeben:
1. Warum werden soziale Vergleichsprozesse durchgeführt?
2. Wie wird ein Vergleichsstandard ausgewählt?
3. Welche Arten von sozialen Vergleichen gibt es und welche Auswirkungen haben sie auf die Selbstwahrnehmung?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Biografie Leon Festinger
- 3. Hauptteil
- 3.1 Ursprünge der Theorie sozialer Vergleichsprozesse
- 3.1.1 Festinger (1942): Anspruchsniveau
- 3.1.2 Festinger (1950): Informeller Gruppendruck
- 3.2 Theorie sozialer Vergleichsprozesse
- 3.2.1 Warum werden soziale Vergleiche durchgeführt?
- 3.2.2 Wie wird ein Vergleichsstandard ausgewählt?
- 3.2.3 Welche Arten von sozialen Vergleichen gibt es und welche Auswirkungen haben sie auf die Selbstwahrnehmung?
- 3.3 Aktuelles Forschungsinteresse
- 3.1 Ursprünge der Theorie sozialer Vergleichsprozesse
- 4. Diskussion
- 4.1 Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse im beruflichen Alltag
- 4.1.1 Motiv der Selbsterkenntnis
- 4.1.2 Motiv der Selbsterhöhung
- 4.1.3 Motiv der Selbstverbesserung
- 4.2 Nutzung der Theorie sozialer Vergleichsprozesse in Medien und Marketing
- 4.1 Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse im beruflichen Alltag
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Theorie sozialer Vergleichsprozesse von Leon Festinger (1954) und analysiert den aktuellen Stand der Theorie nach Mussweiler (2006). Ziel ist es, die zentralen Elemente der Theorie zu beleuchten und deren Bedeutung für die Selbstwahrnehmung und das Verhalten von Menschen zu verdeutlichen.
- Die Ursprünge der Theorie sozialer Vergleichsprozesse und ihre Entwicklung
- Die zentralen Elemente der Theorie, wie z.B. die Motivation für soziale Vergleiche, die Auswahl von Vergleichsstandards und die Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung
- Die Anwendung der Theorie in unterschiedlichen Lebensbereichen, insbesondere im beruflichen Alltag und im Bereich der Medien und des Marketings
- Aktuelle Forschungsinteressen und zukünftige Entwicklungen der Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt die Bedeutung der Selbstreflektion und die Rolle des Selbstkonzepts im menschlichen Leben heraus. Es wird erläutert, wie soziale Vergleiche einen wichtigen Beitrag zur Selbsterkenntnis leisten und die Beurteilung von Ereignissen und Erfahrungen beeinflussen.
Kapitel 2: Biografie Leon Festinger
Dieses Kapitel beleuchtet die Biografie von Leon Festinger, dem Begründer der Theorie sozialer Vergleichsprozesse. Es werden zentrale Stationen seiner akademischen Laufbahn und seine wichtigsten Forschungsinteressen aufgezeigt.
Kapitel 3: Hauptteil
Der Hauptteil der Arbeit widmet sich den Ursprüngen der Theorie sozialer Vergleichsprozesse und deren zentralen Elementen. Es werden die Gründe für die Durchführung von sozialen Vergleichen, die Auswahl von Vergleichsstandards und die verschiedenen Arten von Vergleichen sowie ihre Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung untersucht.
Kapitel 4: Diskussion
Die Diskussion behandelt die Anwendung der Theorie sozialer Vergleichsprozesse im beruflichen Alltag und im Bereich der Medien und des Marketings. Es wird untersucht, wie die Theorie das Verhalten von Menschen in diesen Bereichen beeinflussen kann.
Schlüsselwörter
Soziale Vergleichsprozesse, Selbstwahrnehmung, Selbsterkenntnis, Selbsterhöhung, Selbstverbesserung, Vergleichsstandards, Gruppendruck, Selbstkonzept, Motivation, Medien, Marketing.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Theorie sozialer Vergleichsprozesse nach Leon Festinger?
Menschen haben ein grundlegendes Bedürfnis, ihre eigenen Meinungen und Fähigkeiten zu bewerten. Mangels objektiver Maßstäbe vergleichen sie sich dazu mit anderen Personen.
Warum führen Menschen soziale Vergleiche durch?
Die Hauptmotive sind Selbsterkenntnis (Akkuratheit), Selbsterhöhung (das eigene Selbstwertgefühl steigern) und Selbstverbesserung (von besseren Vorbildern lernen).
Was ist der Unterschied zwischen Aufwärts- und Abwärtsvergleichen?
Bei Aufwärtsvergleichen vergleicht man sich mit Überlegenen (Motiv: Lernen/Inspiration), bei Abwärtsvergleichen mit Unterlegenen (Motiv: Selbstwertschutz/Beruhigung).
Wie wird ein Vergleichsstandard ausgewählt?
Laut Festinger wählen wir bevorzugt Personen aus, die uns in ihren Fähigkeiten oder Meinungen ähnlich sind, um einen aussagekräftigen Vergleich zu erhalten.
Welche Rolle spielt die Theorie im Marketing?
Marketing nutzt soziale Vergleiche, indem Ideale (Schönheit, Erfolg) präsentiert werden, die beim Konsumenten ein Bedürfnis nach Selbstverbesserung oder Angleichung auslösen.
- Citar trabajo
- Patrick Ventur (Autor), 2015, Soziale Vergleichsprozesse. Theorien nach Leon Festinger und Thomas Mussweiler, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350689