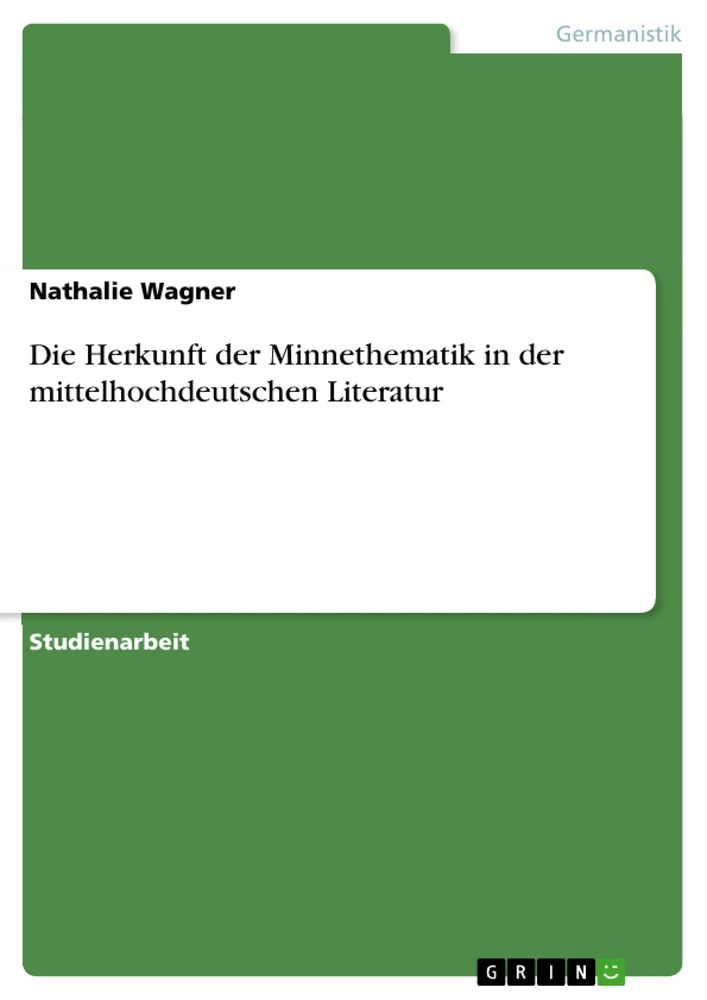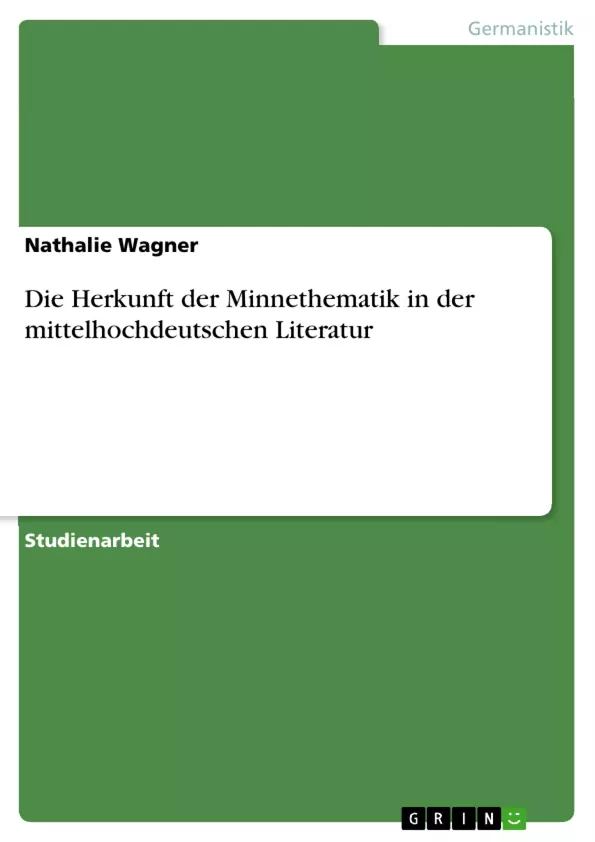Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit ist die Erläuterung des Minnekonzepts in der mittelhochdeutschen Literatur, die Ermittlung verschiedener Herkunftsthesen dieses aufblühenden Modells sowie die Übertragung dieser Liebesthematik in die mittelhochdeutsche Literatur.
Das Konzept der Minne stellt eine Ausprägung der höfischen Liebe dar die Europa im elften Jahrhundert entdeckt. Es handelt sich um eine, in der Feudalgesellschaft angelegte Ideologie der Liebe, geprägt von einem Dienstgedanken, die sich in der Lyrik und Epik mit unterschiedlichen Akzenten entfaltet.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die mittelhochdeutsche Literatur: ein Überblick
- Einleitung in die Minnethematik
- Minne: Etymologie
- Höfische Liebe als Gesellschaftsutopie
- Historische Rezeptionsgeschichte
- Versteckte Realitätsbezüge
- Frankreich vs. Deutschland
- Das Motiv der Minne in der mittelhochdeutschen Epik
- Überlieferung
- Entfaltung
- Die mittelhochdeutsche Liebeslyrik
- Überlieferung
- Der Minnesang
- Die Phasen des deutschen Minnesangs
- Schlusswort
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Minnekonzept in der mittelhochdeutschen Literatur, beleuchtet verschiedene Thesen zu seiner Herkunft und analysiert die Übertragung dieser Liebesthematik in die Literatur dieser Epoche. Die Arbeit konzentriert sich auf die literarische Darstellung und gesellschaftliche Bedeutung der Minne.
- Die Entwicklung und Ausprägung des Minnekonzepts im Hochmittelalter
- Die etymologischen Wurzeln und Bedeutungsfelder des Begriffs „Minne“
- Die Minne als Ausdruck höfischer Gesellschaft und Gesellschaftsutopie
- Der Einfluss antiker und lateinischer Vorbilder auf die Minnethematik
- Die Darstellung der Minne in Epik und Lyrik des Mittelhochdeutschen
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Dieses Vorwort führt kurz in das Thema der Arbeit ein: die Erläuterung des Minnekonzepts in der mittelhochdeutschen Literatur, die Untersuchung verschiedener Herkunftstheorien und die Analyse der Übertragung der Liebesthematik in die Literatur.
Die mittelhochdeutsche Literatur: ein Überblick: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die mittelhochdeutsche Literaturperiode (1050-1350), die als Blütezeit der Literatur gilt. Im Gegensatz zum althochdeutschen, klösterlich geprägten Schrifttum, verlagerte sich das Zentrum der literarischen Produktion an fürstliche Höfe. Laien, insbesondere Ministerialen, nahmen eine zentrale Rolle als Autoren ein. Artusstoffe, Minnesang und die daraus resultierende Minnethematik kennzeichnen diese Epoche.
Einleitung in die Minnethematik: Das Kapitel führt das Konzept der Minne als Ausprägung der höfischen Liebe ein, die im 11. Jahrhundert in Europa aufkam. Es beschreibt die Minne als eine in der Feudalgesellschaft verankerte Ideologie der Liebe, geprägt von einem Dienstgedanken und in Lyrik und Epik unterschiedlich akzentuiert. Sie wird als eine auf „sublimierter Erotik beruhenden Zuneigung“ charakterisiert, die die Steigerung aller Seelenkräfte bewirkt und als erzieherische Kraft dient. Die Minne unterscheidet sich von der caritas und cupiditas und wird als ein komplexes, gattungsübergreifendes Phänomen dargestellt, das die höfische Literatur des Hochmittelalters prägte.
Minne: Etymologie: Dieses Kapitel beleuchtet die etymologischen Wurzeln des Begriffs „Minne“, der verschiedene Bedeutungsfelder umfasst. Er leitet sich vom indogermanischen Wort „men“ ab und bedeutet grundlegend liebendes, freundliches Gedenken. Der Begriff umfasst die caritas, die verlangende, zwischengeschlechtliche Liebe (amor, eros) und die höfische, zeremonielle Liebe im Hochmittelalter. Im Spätmittelalter wurde er durch „Liebe“ ersetzt.
Höfische Liebe als Gesellschaftsutopie: Dieses Kapitel betrachtet die höfische Liebe als ein Gesellschaftsmodell, das sich ideal mit dem Rittertum verbindet. Die vorgegebenen Umgangsformen wie Kultiviertheit, Zurückhaltung und Taktgefühl sind zentrale Aspekte. Der Ritter konnte durch die höfische Liebe die höfische Vollkommenheit anstreben. Es wird eine didaktische Funktion suggeriert: Werte und Normen, die in den Geschichten vermittelt werden, sollen auf die Gesellschaft übertragen und ein Idealbild höfischer Männlichkeit und Weiblichkeit schaffen.
Historische Rezeptionsgeschichte: Das Kapitel beschreibt die mittelhochdeutsche Literatur mit ihrer Ausprägung des Minnekonzepts im Kontext lateinischer und antiker Quellen. Ovids „Ars amatoria“ wird als antikes Vorbild hervorgehoben, das im 11. Jahrhundert als Lehrmeister in Sachen Liebe, Tugendlehre und urbaner Lebensführung bewundert wurde. Das Werk „De amore“ von Andreas Capellanus, das verschiedene Arten der Liebe unterscheidet, wird ebenfalls diskutiert. Ovid gilt als Vorbild für viele europäische Persönlichkeiten des 13. Jahrhunderts, wie Guillaume de Lorris.
Schlüsselwörter
Minne, mittelhochdeutsche Literatur, höfische Liebe, Gesellschaftsutopie, Rittertum, Etymologie, Ovid, Andreas Capellanus, Epik, Lyrik, Minnesang, mittelalterliche Liebe, historische Rezeptionsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zur mittelhochdeutschen Minne
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Konzept der Minne in der mittelhochdeutschen Literatur (ca. 1050-1350). Sie untersucht die Ursprünge der Minne, ihre Darstellung in der Literatur dieser Epoche und ihre gesellschaftliche Bedeutung. Der Fokus liegt auf der literarischen Darstellung und der gesellschaftlichen Funktion der Minne.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung und Ausprägung des Minnekonzepts, die etymologischen Wurzeln des Begriffs "Minne", die Minne als Ausdruck höfischer Gesellschaft und Gesellschaftsutopie, den Einfluss antiker und lateinischer Vorbilder (wie Ovid und Andreas Capellanus) und die Darstellung der Minne in Epik und Lyrik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält ein Vorwort, ein Kapitel zur mittelhochdeutschen Literatur im Überblick, eine Einleitung in die Minnethematik, ein Kapitel zur Etymologie von "Minne", ein Kapitel über die höfische Liebe als Gesellschaftsutopie, ein Kapitel zur historischen Rezeptionsgeschichte, Abschnitte zur Minne in Epik und Lyrik (mit Unterkapiteln zur Überlieferung und Entfaltung in der Epik, sowie zur Überlieferung, zum Minnesang und zu dessen Phasen in der Lyrik), ein Schlusswort und ein Literaturverzeichnis.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Minnekonzept in seiner literarischen und gesellschaftlichen Bedeutung zu verstehen. Sie untersucht verschiedene Thesen zu seiner Herkunft und analysiert, wie dieses Liebesthema in der mittelhochdeutschen Literatur umgesetzt wurde.
Welche Rolle spielt die höfische Gesellschaft?
Die Arbeit betont die enge Verbindung zwischen Minne und höfischer Gesellschaft. Die Minne wird als ein Gesellschaftsmodell dargestellt, das sich ideal mit dem Rittertum verbindet und durch Kultiviertheit, Zurückhaltung und Taktgefühl gekennzeichnet ist. Sie wird als ein Instrument zur Vermittlung von Werten und Normen, zur Gestaltung eines Idealbildes höfischer Männlichkeit und Weiblichkeit und als didaktisches Mittel gesehen.
Welche Bedeutung haben antike und lateinische Vorbilder?
Die Arbeit untersucht den Einfluss antiker und lateinischer Quellen auf die Minnethematik. Ovids „Ars amatoria“ und Andreas Capellanus' „De amore“ werden als wichtige Vorbilder diskutiert, die das Verständnis von Liebe, Tugend und höfischem Leben im Hochmittelalter prägten.
Wie wird die Minne in Epik und Lyrik dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Darstellung der Minne sowohl in der mittelhochdeutschen Epik als auch Lyrik. Dabei wird auf die Überlieferung und die jeweilige Entfaltung des Themas in diesen Genres eingegangen. Im Bezug auf die Lyrik wird der Minnesang und seine verschiedenen Phasen detailliert betrachtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Minne, mittelhochdeutsche Literatur, höfische Liebe, Gesellschaftsutopie, Rittertum, Etymologie, Ovid, Andreas Capellanus, Epik, Lyrik, Minnesang, mittelalterliche Liebe, historische Rezeptionsgeschichte.
- Citation du texte
- Nathalie Wagner (Auteur), 2013, Die Herkunft der Minnethematik in der mittelhochdeutschen Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350719