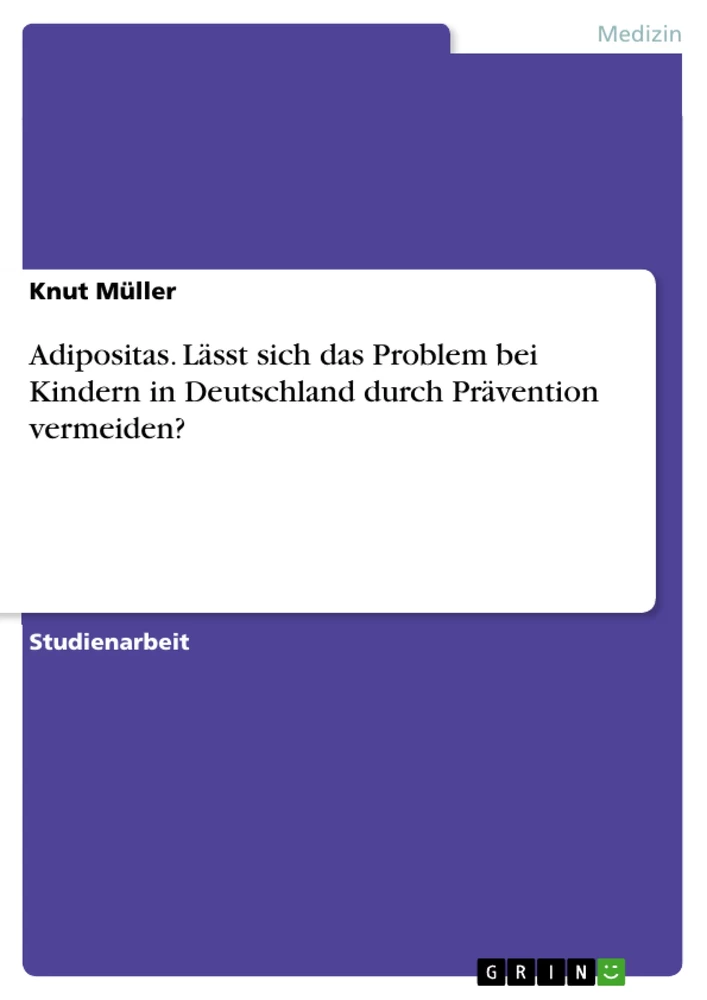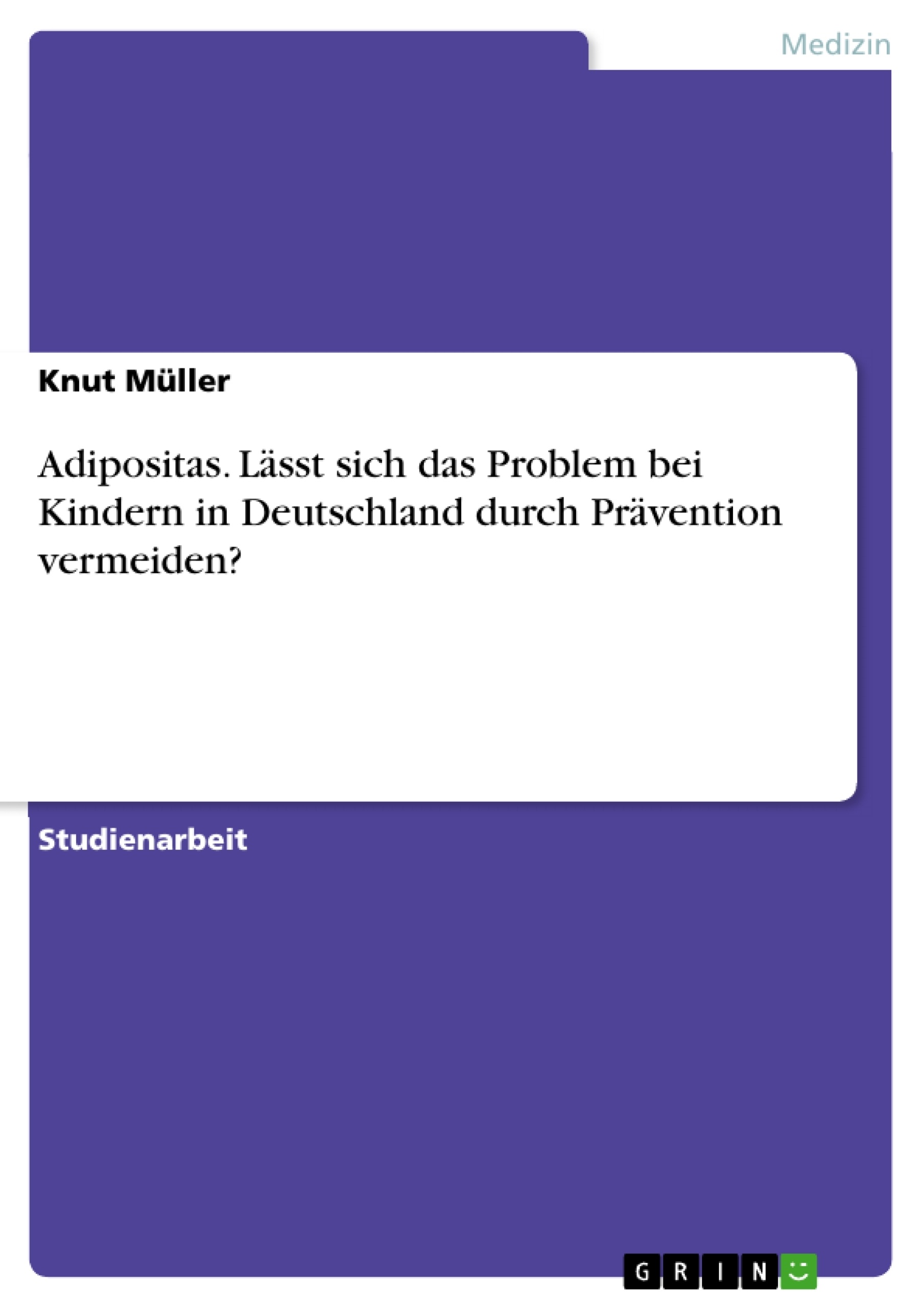Immer mehr junge Erwachsende leiden an einer Adipositas in Deutschland. Wie sich dieses erklären lässt und welche Möglichkeiten wir besitzen dieses zu ändern wird Ihnen in dieser Hausarbeit näher erläutert.
Es wird zunächst ein geschichtlicher Abriss zum Thema Ernährung und Verhalten gegeben und dabei aufgezeigt, dass Ernährung und Adipositas schon immer im Zusammenhang standen und letzteres kein neuzeitliches Phänomen ist.
Das nächste Kapitel ist der aktuellen Definition von Adipositas gewidmet und enthält eine Klassifikation mithilfe der Body-Mass-Index-Formel, die zunächst bei Erwachsenen Anwendung findet. Im Anschluss daran wird eine andere Klassifikation des BMI erläutert, die bei Kindern und Jugendlichen genutzt wird. Danach wird der aktuelle Sachstand zusammengefasst und dabei das Thema „adipöse Kinder und Jugendliche“ vorgestellt.
Anschließend werden Studien und Datenbanken näher betrachtet, um eine mögliche weitere Entwicklung aufzuzeigen. Im letzten Kapitel der Hausarbeit werden verschiedene Präventionsmethoden näher vorgestellt. Es geht in erster Linie um die Prävention von adipösen Kindern und Jugendlichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Geschichtlicher Hintergrund
- 2.1 Urzeit
- 2.2 Antike
- 2.3 Mittelalter
- 2.4 Industrielle Revolution
- 3 Übergewicht/Adipositas - Definition und Klassifikation
- 3.1 Definition
- 3.2 BMI-Formel
- 3.3 Klassifikation Erwachsene
- 3.4 Klassifikation bei Kindern und Jugendlichen
- 4 Recherche der Studie
- 5 Prävention bei Kindern und Jugendlichen
- 5.1 Primärprävention
- 5.2 Sekundärprävention
- 5.3 Tertiärprävention
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Problematik der Adipositas bei Kindern in Deutschland und befasst sich mit der Frage, ob sich dieses Problem durch Präventionsmaßnahmen vermeiden lässt. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der Adipositas, die Definition und Klassifikation sowie präventive Strategien zu geben.
- Geschichtliche Entwicklung von Ernährung und Adipositas
- Definition und Klassifikation von Adipositas bei Kindern und Erwachsenen
- Aktuelle Studien und Daten zur Adipositas bei Kindern
- Verschiedene Präventionsansätze für adipöse Kinder und Jugendliche
- Zusammenhang zwischen Ernährung, Bewegung und Adipositas
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Adipositas bei Kindern ein und erläutert die Relevanz der Fragestellung. Das zweite Kapitel liefert einen historischen Abriss, der die Entwicklung von Ernährung und Adipositas über verschiedene Epochen hinweg betrachtet. Es beleuchtet, wie sich die Ernährung des Menschen im Laufe der Zeit verändert hat und wie diese Veränderungen die Entstehung von Adipositas beeinflusst haben.
Kapitel drei widmet sich der Definition und Klassifikation von Adipositas, wobei sowohl die Klassifikation für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche behandelt wird. Kapitel vier beschäftigt sich mit der aktuellen Forschungslage und analysiert verschiedene Studien und Datenbanken, um die Entwicklung der Adipositas bei Kindern zu beleuchten.
Das fünfte Kapitel widmet sich verschiedenen Präventionsansätzen für adipöse Kinder und Jugendliche und stellt die drei Stufen der Prävention - Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention - vor. Die Arbeit legt dabei den Schwerpunkt auf die Prävention von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen, ohne jedoch die Bedeutung der Prävention von Folgeerkrankungen zu vernachlässigen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Adipositas, Prävention, Kinder und Jugendliche, Ernährung, Bewegung, Gesundheitswesen. Neben diesen zentralen Begriffen werden auch Themen wie historische Entwicklung der Adipositas, BMI, Studien, Datenbanken, Folgeerkrankungen, Gesundheitsförderung und Familienarbeit thematisiert.
Häufig gestellte Fragen
Ist Adipositas ein neuzeitliches Phänomen?
Nein, historische Rückblicke zeigen, dass Ernährung und Adipositas schon seit der Urzeit und Antike im Zusammenhang stehen, auch wenn die Häufigkeit heute massiv zugenommen hat.
Wie wird Adipositas bei Kindern definiert?
Während bei Erwachsenen die Standard-BMI-Formel gilt, wird bei Kindern und Jugendlichen eine spezielle Klassifikation genutzt, die Alter und Geschlecht berücksichtigt.
Was ist der Unterschied zwischen Primär- und Sekundärprävention?
Primärprävention zielt darauf ab, die Entstehung von Übergewicht zu verhindern, während Sekundärprävention sich an bereits gefährdete oder leicht übergewichtige Kinder richtet.
Welche Rolle spielt die Tertiärprävention?
Tertiärprävention fokussiert sich auf bereits adipöse Kinder, um Folgeerkrankungen zu minimieren und eine weitere Gewichtszunahme zu stoppen.
Kann Prävention das Adipositas-Problem in Deutschland lösen?
Die Hausarbeit untersucht, ob durch gezielte Maßnahmen in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Familienarbeit die steigenden Raten vermieden werden können.
- Quote paper
- Knut Müller (Author), 2016, Adipositas. Lässt sich das Problem bei Kindern in Deutschland durch Prävention vermeiden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/350950