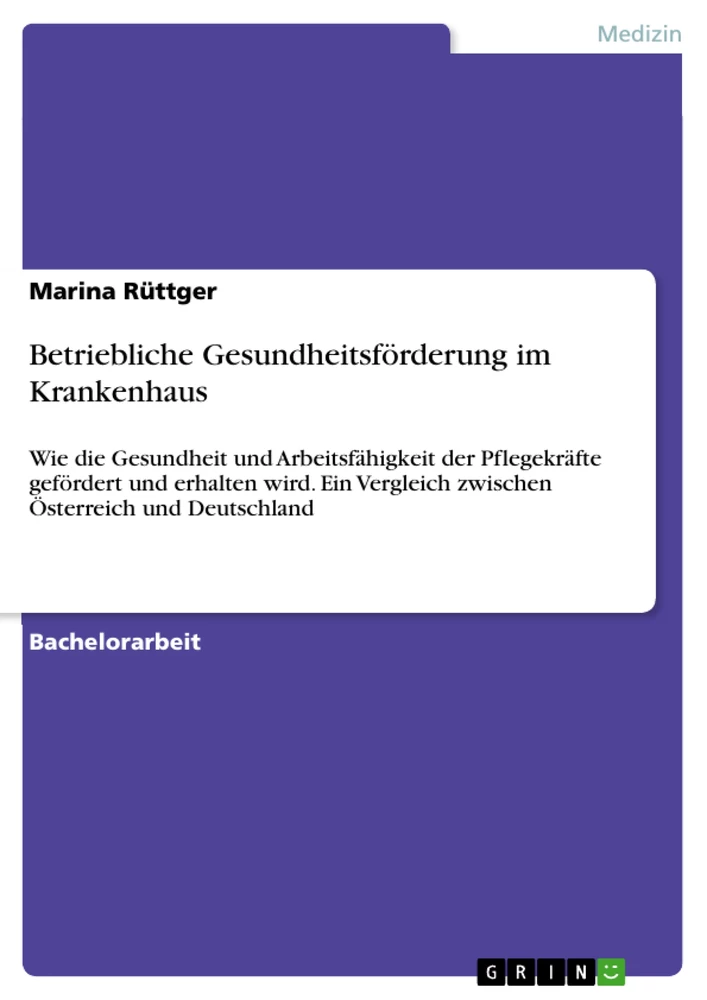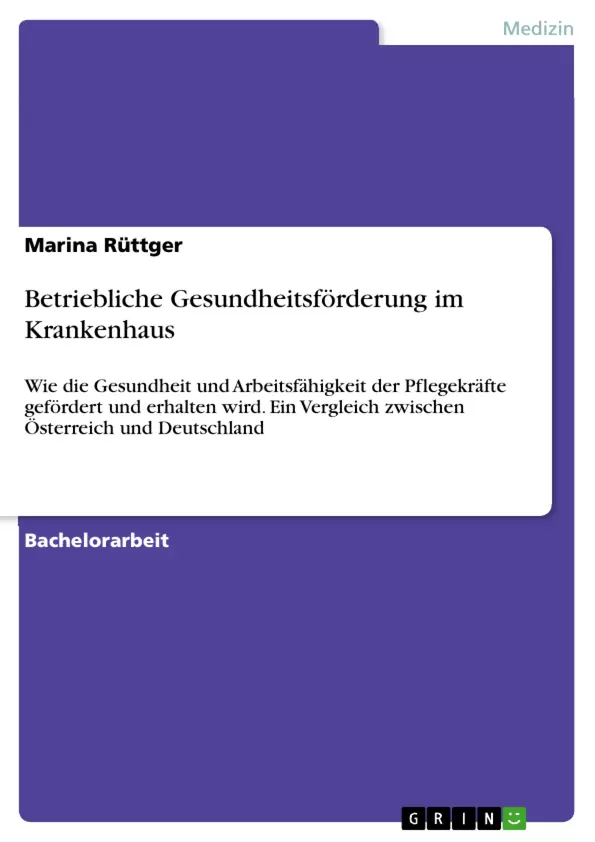Die psychische und physische Gesundheit von Pflegekräften gilt als eine wichtige Ressource von Krankenhäusern. Denn die Pflegekräfte sind ein wesentlicher Faktor dafür, die Wettbewerbsfähigkeit und die Existenzsicherung des Krankenhauses zu gewährleisten.
Neben den Folgen des demographischen Wandels stellen eine Steigerung chronischer Erkrankungen wie beispielsweise Herz – Kreislauf - Erkrankungen, Krebserkrankungen oder Diabetes mellitus, die Zunahme von Multimorbidität und andauernde Pflegebedürftigkeit weitere Herausforderungen für das Berufsbild der Pflege dar. Es wird somit deutlich, dass die Pflege von kranken und alten Menschen im Krankenhausbereich einen wachsenden Bereich ausmacht. Aus genannten Gründen werden Gesundheitsleistungen heute und besonders in naher Zukunft stark nachgefragt sein.
Der Beruf der Pflegekraft ist durch hohe Anforderungen in physischer, psychischer und sozialer Hinsicht geprägt. Der Umgang mit Ausnahmesituationen, bedingt durch den direkten Kontakt zu sterbenden und schwerstkranken Patienten muss zusätzlich bewältigt werden. Psychische Belastungenergeben sich zudem aus Personalmangel, welcher durch Einsparungen des Krankenhauses entsteht, aus einer hohen Fluktuation in der Pflege sowie Schicht- und Nachtdiensten. Hinzu kommen körperliche Belastungen, wie das täglich schwere Heben, Tragen und Umlagern von Patienten. Hierbei sind vor allem die arbeitsbedingten Muskel – Skelett - Erkrankungen hervorzuheben, welche die Gruppe mit den häufigsten Krankheitsarten und mit den meisten Arbeitsunfähigkeitstagen im Bereich der Pflege darstellen. Erkrankungen, welche durch Belastungen des Muskel –Skelett - Systems verursacht werden, führen häufig zu Fehlzeiten und belasten das restliche Team durch Mehrarbeit. Das Risiko eines frühzeitigen Berufssaustiegsaufgrund von Berufskrankheiten ist hoch und im Pflegeberuf weit verbreitet.
Infolgedessen sind entsprechende Maßnahmen und Konzepte notwendig, um die Gesundheit der Pflegekräfte zu fördern und somit den Erhalt der Arbeitsfähigkeit von Pflegekräften sicherzustellen. Dabei geht es vor allem darum die Leistungsfähigkeit in psychischer sowie physischer Hinsicht dauerhaft zu erhalten, diese zu unterstützen und gegebenenfalls wiederherzustellen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Praktische Relevanz und Problemstellung
- Zielsetzung der Arbeit
- Definitorische Grundlagen
- Gesundheit
- Definition
- Arbeitsfähigkeit - Gesundheit als Faktor der Gesunderhaltung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement und Betriebliche Gesundheitsförderung
- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Betriebliche Gesundheitsförderung im Krankenhaus
- Instrumente der betrieblichen Gesundheitsförderung
- Einführung von Gesundheitszirkeln
- Mitarbeiterbefragung
- Betrieblicher Gesundheitsbericht
- Arbeitsunfähigkeitsanalyse
- Das Krankenhaus als Arbeitsplatz
- Arbeitsbedingungen und - belastungen der Pflegekräfte
- Arbeiten im Nacht- und Schichtdienst
- Berufskrankheiten und krankheitsbedingte Fehlzeiten
- Darstellung der betrieblichen Gesundheitsförderung im deutschen Krankenhauswesen
- Akteure der betrieblichen Gesundheitsförderung im Krankenhaus
- Deutsches Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser (DNGfK)
- Die Krankenkassen
- Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst- und Wohlfahrtspflege (BGW)
- Initiative für neue Qualität der Arbeit (INQA)
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA)
- Darstellung der betrieblichen Gesundheitsförderung im österreichischen Krankenhauswesen
- Akteure der betrieblichen Gesundheitsförderung im Krankenhaus
- Österreichisches Netzwerk Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen (ONGKG)
- Fonds Gesundes Österreich (FGÖ)
- Wiener Allianz für Gesundheitsförderung
- Praxisprojekte zur Gesundheitsförderung im Krankenhaus
- Projekt „Gemeinsam Gesünder“ im Krankenhaus Barmherzige Brüder Eisenstadt
- Projekt „Fit und Vital - unser Spital“ im Bezirkskrankenhaus Schwaz
- Das Gesundheitsprogramm Carus Vital des Universitätsklinikums Dresden
- Projekt „Gezieltes Rückentraining für Mitarbeiter“ im Städtischen Klinikum Solingen
- Vergleichende Analyse und kritische Beurteilung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Thema der betrieblichen Gesundheitsförderung im Krankenhaus, insbesondere unter Berücksichtigung des Pflegepersonals. Die Arbeit analysiert und vergleicht die Situation in Österreich und Deutschland, beleuchtet die relevanten Akteure und Praxisprojekte und bewertet die Wirksamkeit und Herausforderungen der Gesundheitsförderung in diesem Bereich.
- Definition und Bedeutung von betrieblicher Gesundheitsförderung im Krankenhauskontext
- Analyse der Arbeitsbedingungen und -belastungen des Pflegepersonals
- Bewertung verschiedener Instrumente und Ansätze der Gesundheitsförderung
- Untersuchung der Rolle relevanter Akteure in Österreich und Deutschland
- Auswertung von Praxisprojekten zur Gesundheitsförderung im Krankenhaus
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die praktische Relevanz des Themas und die Zielsetzung der Arbeit erläutert. Im zweiten Kapitel werden die definitorischen Grundlagen für Gesundheit, betriebliche Gesundheitsförderung und Arbeits- und Gesundheitsschutz gelegt. Das dritte Kapitel widmet sich der betrieblichen Gesundheitsförderung im Krankenhaus, indem es die wichtigsten Instrumente, die besonderen Herausforderungen des Krankenhausarbeitsplatzes und die Situation in Deutschland und Österreich beleuchtet. Kapitel 4 präsentiert Praxisprojekte aus beiden Ländern, um die Umsetzung von Gesundheitsförderung in der Praxis zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Betriebliche Gesundheitsförderung, Krankenhaus, Pflegepersonal, Arbeitsbedingungen, Gesundheitszirkel, Mitarbeiterbefragung, Arbeitsunfähigkeitsanalyse, Deutsche Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser (DNGfK), Österreichisches Netzwerk Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen (ONGKG), Praxisprojekte.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Gesundheitsförderung für Pflegekräfte besonders wichtig?
Pflegekräfte sind hohen physischen (Heben, Tragen) und psychischen (Zeitdruck, Kontakt mit Tod) Belastungen ausgesetzt. Gesundheitsförderung sichert ihre Arbeitsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit des Krankenhauses.
Was sind die häufigsten Berufskrankheiten in der Pflege?
Besonders verbreitet sind Muskel-Skelett-Erkrankungen aufgrund der körperlichen Belastung sowie psychische Erkrankungen wie Burnout durch Personalmangel und Schichtdienst.
Welche Instrumente werden zur Gesundheitsförderung eingesetzt?
Wichtige Instrumente sind Gesundheitszirkel, Mitarbeiterbefragungen, betriebliche Gesundheitsberichte und die Analyse von Arbeitsunfähigkeitstagen.
Welche Organisationen unterstützen Krankenhäuser dabei?
In Deutschland sind das DNGfK, Krankenkassen und die BGW aktiv. In Österreich unterstützen das ONGKG und der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) entsprechende Projekte.
Gibt es erfolgreiche Praxisbeispiele?
Die Arbeit nennt Projekte wie „Gemeinsam Gesünder“ (Eisenstadt), „Fit und Vital“ (Schwaz) und „Carus Vital“ (Dresden) als Vorbilder für gelungene Umsetzung.
- Citar trabajo
- Marina Rüttger (Autor), 2016, Betriebliche Gesundheitsförderung im Krankenhaus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351033