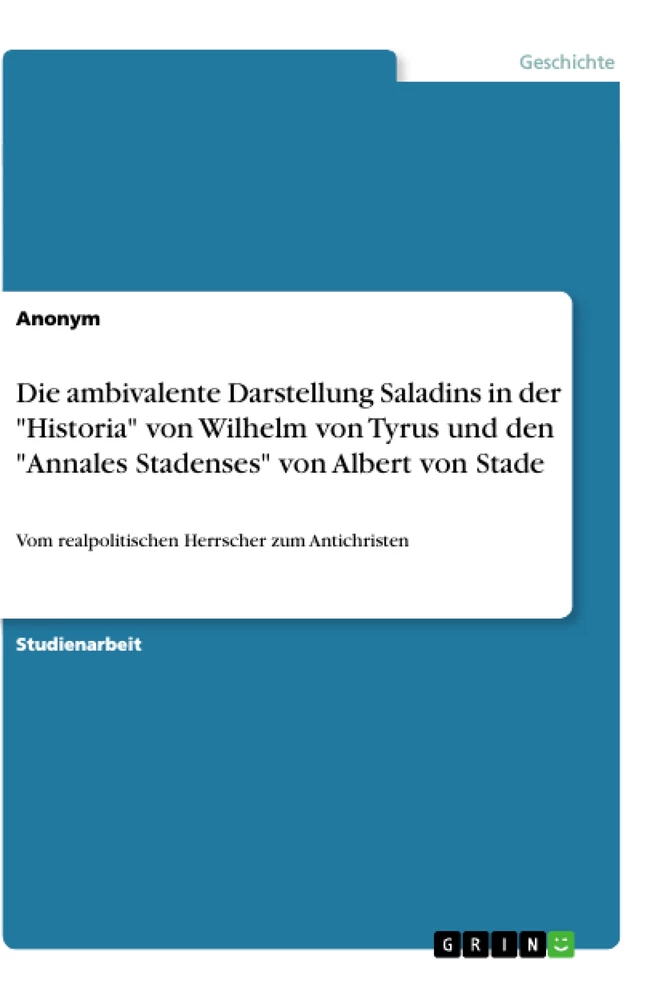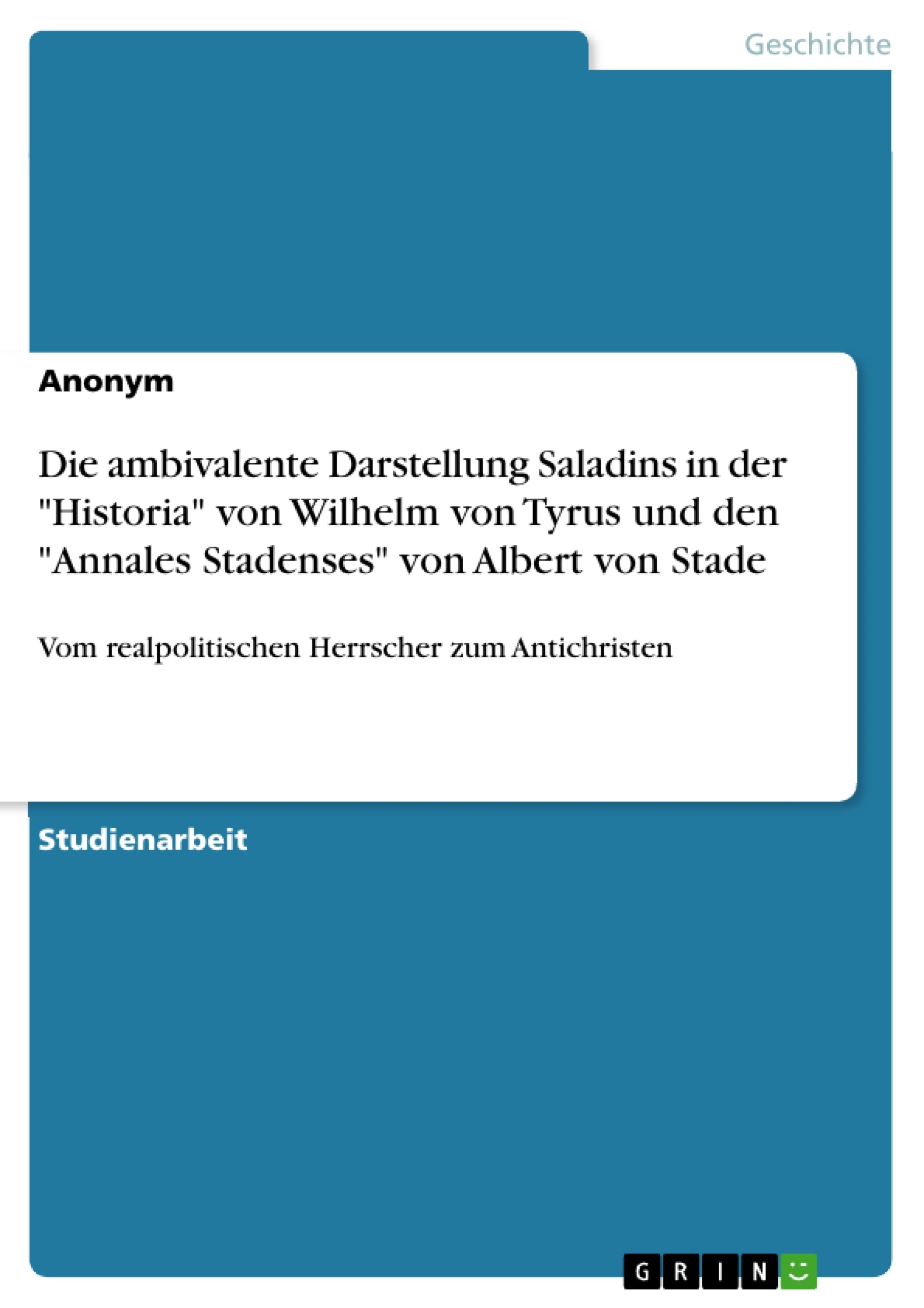Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Darstellung von Saladin in den christlichen Werken von Wilhelm von Tyrus „Historia“ und Albert von Stades „Annales Stadenses“. Konkret geht es um die Frage, wie sich die Darstellung von Saladin durch christliche Autoren nach dem Fall von Jerusalem verändert hat. Dazu muss vor allem auf die Entstehungsgeschichte der Werke und die Arbeitsweise der Autoren eingegangen werden, um die Darstellung Saladins als Feindbild der Christenheit nach dem Fall Jerusalems zu verstehen.
Wilhelm von Tyrus nimmt im Rahmen der Kreuzfahrerüberlieferungen eine besondere Stellung ein. Er war der einzige Kreuzzugschronist, der den Großteil seines Lebens und bis zu seinem Tod, laut Meyer 1186, in Palästina gelebt hat. Wegen seiner Tätigkeit als Erzbischof und Kanzler von Jerusalem fanden neben geistlichen Themen auch realpolitische Konflikte Platz in seiner „Historia“, die die Ereignisse bis zum Jahr 1183/4 aufgreift. Deshalb erhält die Quelle besondere Beachtung in dieser Hausarbeit, beschreibt sie Saladin ohne Vorbelastung durch die Eroberung Jerusalems 1187. Folglich ist diese Beschreibung befreit von heilsgeschichtlichen Einordnungen Saladins und bietet die Ausgangslage für eine Darstellung des Realpolitikers Saladin. Zur Analyse von Wilhelm von Tyrus Leben, seiner Arbeitsweise und den Besonderheiten seines Werkes, wird die Forschungsarbeit von Rudolf Hiestand, Thomas Rödig und Rainer Christoph Schwinges herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wilhelm von Tyrus – Ein christlicher Historiograph im Orient
- Darstellung Saladins in Historia rerum in partibus transmarinis gestarum
- Albert von Stade, ein biographischer Überblick
- Darstellung von Saladin in Annales Stadensis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung Saladins in den christlichen Werken von Wilhelm von Tyrus und Albert von Stade, um zu analysieren, wie sich diese Darstellung nach dem Fall Jerusalems verändert hat. Die Entstehungsgeschichte der Werke und die Arbeitsweise der Autoren spielen dabei eine zentrale Rolle.
- Die Entwicklung des Bildes Saladins von einem realpolitischen Herrscher zum Antichristen.
- Der Einfluss der Eroberung Jerusalems auf die Darstellung Saladins in christlichen Quellen.
- Vergleich der Darstellungen Saladins bei Wilhelm von Tyrus und Albert von Stade.
- Analyse der unterschiedlichen Perspektiven und Intentionen der Autoren.
- Die Rolle der Heilsgeschichte in der Konstruktion des Feindbildes Saladin.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach der Veränderung der Darstellung Saladins in christlichen Quellen nach dem Fall Jerusalems in den Mittelpunkt. Sie benennt die beiden Hauptquellen, Wilhelm von Tyrus' Historia und Albert von Stades Annales Stadenses, und skizziert den methodischen Ansatz, der die Entstehungsgeschichte der Werke und die Arbeitsweise der Autoren berücksichtigt, um die Entwicklung des Bildes Saladins als Feindbild der Christenheit zu verstehen.
2. Wilhelm von Tyrus - Ein christlicher Historiograph im Orient: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Leben und Werk des christlichen Historiographen Wilhelm von Tyrus. Es beleuchtet seine Biografie, die durch die Quellenlage nur bruchstückhaft bekannt ist, seine Ausbildung in Palästina und Europa, sowie seinen Aufstieg in Schlüsselpositionen der Verwaltung Jerusalems. Besonderes Augenmerk liegt auf seiner Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, einer Kreuzzugschronik, die bis 1183/4 reicht und Saladin vor dem Hintergrund der Eroberung Jerusalems beschreibt. Das Kapitel analysiert Wilhelms Position und seine mögliche Unvoreingenommenheit gegenüber Saladin vor 1187.
3. Darstellung Saladins in Historia rerum in partibus transmarinis gestarum: (Dieses Kapitel wurde ausgelassen, da der Text keinen weiteren Inhalt zu diesem Punkt bietet.)
4. Albert von Stade, ein biographischer Überblick: (Dieses Kapitel wurde ausgelassen, da der Text keinen weiteren Inhalt zu diesem Punkt bietet.)
5. Darstellung von Saladin in Annales Stadensis: Dieses Kapitel behandelt die Darstellung Saladins in Albert von Stades Annales Stadenses. Im Gegensatz zu Wilhelm von Tyrus, der Saladin vor dem Fall Jerusalems beschreibt, präsentiert Albert von Stade Saladin im Kontext der Eroberung von 1187 und in Verbindung mit der antichristlichen Prophetie des Abtes Joachim. Das Kapitel untersucht die Gründe für die negative Darstellung Saladins als Antichristen und die Übernahme dieser Sichtweise in kontinentaleuropäische Quellen. Die Forschungsergebnisse von Karl Fiehn und Gerda Maeck zu Albert von Stade werden hier einbezogen.
Schlüsselwörter
Saladin, Wilhelm von Tyrus, Albert von Stade, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, Annales Stadenses, Kreuzzüge, Feindbild, Antichrist, Heilsgeschichte, Realpolitik, christliche Geschichtsschreibung, Mittelalter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Darstellung Saladins bei Wilhelm von Tyrus und Albert von Stade
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Darstellung Saladins in den christlichen Werken von Wilhelm von Tyrus und Albert von Stade. Der Fokus liegt auf der Analyse, wie sich diese Darstellung nach dem Fall Jerusalems verändert hat. Die Entstehungsgeschichte der Werke und die Arbeitsweise der Autoren spielen dabei eine zentrale Rolle.
Welche Quellen werden untersucht?
Die Hauptquellen sind die „Historia rerum in partibus transmarinis gestarum“ von Wilhelm von Tyrus und die „Annales Stadenses“ von Albert von Stade. Diese Chroniken bieten unterschiedliche Perspektiven auf Saladin, da Wilhelm von Tyrus vor und Albert von Stade nach dem Fall Jerusalems schrieb.
Welche Fragestellungen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Bildes Saladins von einem realpolitischen Herrscher zum Antichristen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss der Eroberung Jerusalems auf die Darstellung Saladins in christlichen Quellen und dem Vergleich der Darstellungen bei Wilhelm von Tyrus und Albert von Stade. Die unterschiedlichen Perspektiven und Intentionen der Autoren sowie die Rolle der Heilsgeschichte in der Konstruktion des Feindbildes Saladin werden ebenfalls analysiert.
Wer ist Wilhelm von Tyrus?
Wilhelm von Tyrus war ein christlicher Historiograph im Orient. Das Kapitel beschreibt sein Leben, seine Ausbildung und seinen Aufstieg in Schlüsselpositionen der Verwaltung Jerusalems. Seine „Historia rerum in partibus transmarinis gestarum“ ist eine Kreuzzugschronik, die bis 1183/4 reicht und Saladin vor dem Hintergrund der Eroberung Jerusalems beschreibt.
Wie wird Saladin in der „Historia rerum in partibus transmarinis gestarum“ dargestellt?
Dieses Kapitel wurde im vorliegenden Text ausgelassen, da keine weiteren Informationen zur Verfügung stehen.
Wer ist Albert von Stade?
Das Kapitel bietet einen biographischen Überblick über Albert von Stade, den Autor der „Annales Stadensis“.
Wie wird Saladin in den „Annales Stadensis“ dargestellt?
Im Gegensatz zu Wilhelm von Tyrus, präsentiert Albert von Stade Saladin im Kontext der Eroberung Jerusalems von 1187 und in Verbindung mit der antichristlichen Prophetie des Abtes Joachim. Die Arbeit untersucht die Gründe für die negative Darstellung Saladins als Antichrist und die Übernahme dieser Sichtweise in kontinentaleuropäische Quellen. Die Forschungsergebnisse von Karl Fiehn und Gerda Maeck zu Albert von Stade werden hier einbezogen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Saladin, Wilhelm von Tyrus, Albert von Stade, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, Annales Stadenses, Kreuzzüge, Feindbild, Antichrist, Heilsgeschichte, Realpolitik, christliche Geschichtsschreibung, Mittelalter.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit berücksichtigt die Entstehungsgeschichte der untersuchten Werke und die Arbeitsweise der Autoren, um die Entwicklung des Bildes Saladins als Feindbild der Christenheit zu verstehen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, Die ambivalente Darstellung Saladins in der "Historia" von Wilhelm von Tyrus und den "Annales Stadenses" von Albert von Stade, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351105