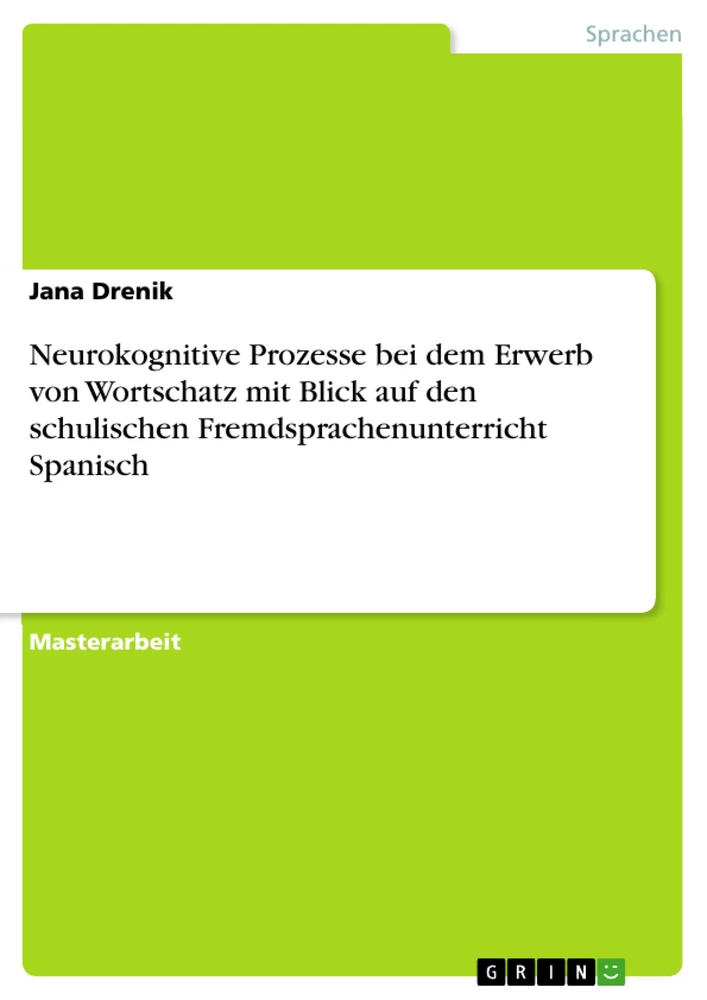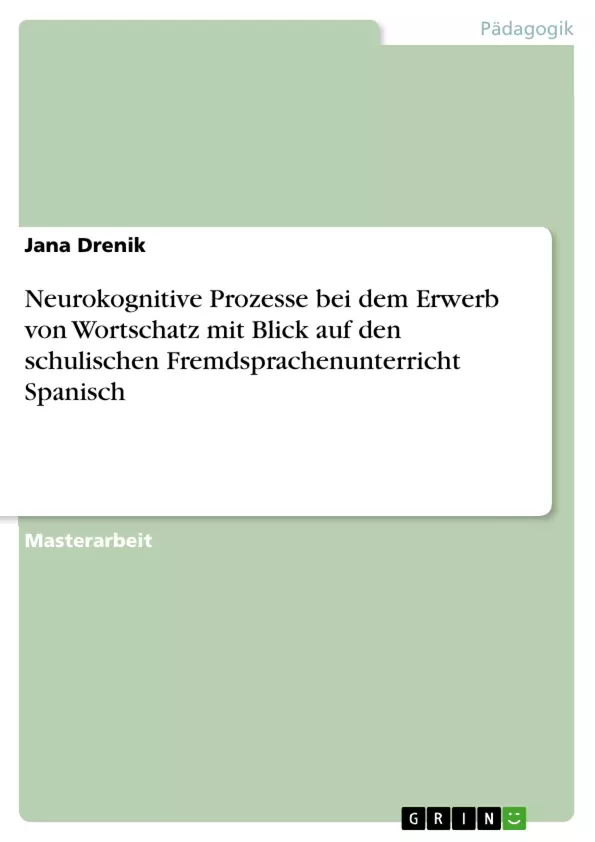DieseArbeit lenkt den Blick auf den Wortschatz seine Bedeutung für den Fremdsprachenerwerb. Sie beschäftigt sich mit den zugrunde liegenden Forschungsfragen, welche neurokognitiven Prozesse den Erwerb und die langfristige Speicherung von Wortschatz beeinflussen und welche didaktischen Grundprinzipien sich aus Psycholinguistik und Lernpsychologie für eine nachhaltige und effektive Vermittlung von Wortschatz im Spanischunterricht ableiten lassen. Das Ziel dieser Arbeit ist, die neurokognitiven Aspekte des Wortschatzerwerbs sowie der Wortschatzerweiterung und die damit in der fachdidaktischen Praxis einhergehenden Methoden zu untersuchen. Obgleich die Forschungslage zum ein- und mehrsprachigen mentalen Lexikon äußerst heterogen ist, können wissenschaftlich fundierte Möglichkeiten aufgezeigt werden, inwiefern die lexikalische Kompetenz im Rahmen des institutionalisierten Fremdsprachenunterrichts gefördert werden kann. Diese Arbeit hat dagegen nicht die Darstellung der Bandbreite an Wortschatzübungen zum Ziel, sondern gibt vielmehr einen überblicksverschaffenden Einblick potentieller Alternativen für die Optimierung von Wortschatzarbeit. Die Grundlage hierfür bieten die aus der Fremdsprachendidaktik und Psycholinguistik verwendete Literatur sowie der Einbezug aktueller Lehrwerke für den Spanischunterricht.
Der Wortschatz wurde über einen langen Zeitraum hinweg von der Wichtigkeit der Grammatik beim Fremdsprachenlernen in den Schatten gestellt. Mittlerweile haben die Fremdsprachendidaktik und die Psycholinguistik jedoch erkannt, dass mit Blick auf einen kommunikativen Fremdsprachenunterricht, wie ihn der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen (GER), die Bildungsstandards und die Kernlehrpläne fordern, dass der Wortschatzerwerb sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht eine Schlüsselrolle bei der Sprachbeherrschung einnimmt. Eine rudimentäre Kommunikation wäre trotz unzureichender Grammatikkenntnisse bei Vorhandensein eines annehmbaren Wortschatzinventars eher möglich als umgekehrt. Dies implizieren auch die Lehr- und Lernmethoden, die innerhalb der letzten Jahre das didaktische Material neu strukturiert und den Stellenwert der Wortschatzdidaktik verstärkt in den Vordergrund gerückt haben (vgl. Nieweler 2006: 174; De Florio-Hansen 2009: 181).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Was ist ein Wort? Annäherung an einen vielfältigen Begriff
- 2.1 Einzelkomponenten der lexikalischen Einheit
- 2.2 Der Wortschatz als ein dynamisches System
- 2.2.1 Rezeptiver, produktiver und potentieller Wortschatz
- 3 Die mentale Organisation von Wörtern im Gehirn
- 3.1 Das Langzeitgedächtnis
- 3.2 Der menschliche Wortspeicher: Das mentale Lexikon
- 3.2.1 Begriffsbestimmung und Forschung
- 3.2.2 Aufbau und Struktur
- 3.2.3 Wortform und Wortbedeutung
- 3.2.4 Das mentale Lexikon als Netzwerk
- 3.2.5 Zusammenfassung
- 3.3 Die Repräsentation von Wörtern im zwei- und mehrsprachigen mentalen Lexikon
- 3.3.1 Die Formen der mentalen Repräsentation nach Weinreich (1953)
- 3.3.2 Die Subset-Hypothesis nach Paradis (1987)
- 3.3.3 Aufbau semantisch-konzeptueller Repräsentationen
- 3.3.3.1 Die Entwicklung der lexikalischen Einheit
- 3.3.3.2 L1-Transfer im Bereich der Lexik
- 3.3.3.3 Kollokationen und Konstruktionen
- 3.4 Folgerungen für den Fremdsprachenunterricht
- 3.4.1 Rückbezug auf vorhandenes Sprachwissen
- 3.4.2 Mehrdimensionales Wortwissen
- 3.4.3 Kontextualisiertes und vernetztes Lernen
- 3.4.4 Wiederholungen und aktiver Gebrauch
- 3.4.5 Mehrkanaliges und ganzheitliches Lernen
- 4 Wortschatzarbeit im Spanischunterricht
- 4.1 Die lexikalische Kompetenz: eine Begriffsannäherung
- 4.2 Die Frage nach dem Umfang und der Auswahl des Wortschatzes
- 4.3 Die Vermittlung von Vokabellernstrategien im Spanischunterricht: eine Methodenvielfalt
- 4.3.1 Didaktische Grundannahmen
- 4.3.2 Phasen des Wortschatzerwerbs
- 4.3.2.1 Sprachaufnahmephase
- 4.3.2.2 Konsolidierungsstrategien
- 4.3.2.3 Phase der Archivierung
- 4.3.2.4 Wortschatz einmal anders: Alternativen zum Vokabeltest
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit neurokognitiven Prozessen beim Erwerb von Wortschatz im Kontext des schulischen Fremdsprachenunterrichts Spanisch. Sie analysiert die mentale Organisation von Wörtern im Gehirn und untersucht, wie diese Erkenntnisse für die Gestaltung von Wortschatzarbeit im Unterricht genutzt werden können.
- Mentale Repräsentation von Wörtern im Gehirn
- Aufbau und Funktionsweise des mentalen Lexikons
- Wortschatzerwerb im Fremdsprachenunterricht
- Didaktische Prinzipien für effektive Wortschatzarbeit
- Vokabellernstrategien im Spanischunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Zielsetzung der Arbeit dar. Kapitel 2 definiert den Begriff "Wort" und betrachtet den Wortschatz als ein dynamisches System. Kapitel 3 beleuchtet die mentale Organisation von Wörtern im Gehirn, einschließlich der Funktionsweise des Langzeitgedächtnisses und des mentalen Lexikons. Es werden verschiedene Modelle der mentalen Repräsentation von Wörtern in ein- und mehrsprachigen Gehirnen vorgestellt.
Kapitel 4 widmet sich der Wortschatzarbeit im Spanischunterricht und analysiert die lexikalische Kompetenz sowie verschiedene Methoden zur Vermittlung von Vokabellernstrategien. Die Arbeit untersucht verschiedene Phasen des Wortschatzerwerbs und stellt alternative Ansätze zum traditionellen Vokabeltest vor.
Schlüsselwörter
Neurokognitive Prozesse, Wortschatzerwerb, mentales Lexikon, Fremdsprachenunterricht, Spanisch, lexikalische Kompetenz, Vokabellernstrategien, didaktische Prinzipien
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „mentale Lexikon“?
Es beschreibt die Art und Weise, wie Wörter im menschlichen Gehirn gespeichert und organisiert sind, ähnlich einem hochvernetzten Netzwerk von Wortformen und Bedeutungen.
Wie lernen Schüler im Spanischunterricht effektiv Vokabeln?
Effektive Wortschatzarbeit nutzt Methoden wie das vernetzte Lernen, Wiederholungen in Kontexten und mehrkanaliges (auditiv, visuell, motorisch) Lernen.
Was bedeutet lexikalische Kompetenz?
Lexikalische Kompetenz umfasst nicht nur das Wissen über die Bedeutung eines Wortes, sondern auch seine grammatikalische Verwendung, Aussprache und Verknüpfung mit anderen Wörtern (Kollokationen).
Wie unterscheidet sich der rezeptive vom produktiven Wortschatz?
Der rezeptive Wortschatz umfasst Wörter, die man beim Hören oder Lesen versteht. Der produktive Wortschatz sind jene Wörter, die man selbst aktiv beim Sprechen oder Schreiben anwendet.
Welche Rolle spielt das Langzeitgedächtnis beim Sprachenlernen?
Für eine dauerhafte Speicherung müssen Wörter die Phase der Archivierung im Langzeitgedächtnis erreichen, was durch Konsolidierungsstrategien und regelmäßigen aktiven Gebrauch gefördert wird.
- Quote paper
- Jana Drenik (Author), 2016, Neurokognitive Prozesse bei dem Erwerb von Wortschatz mit Blick auf den schulischen Fremdsprachenunterricht Spanisch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351247