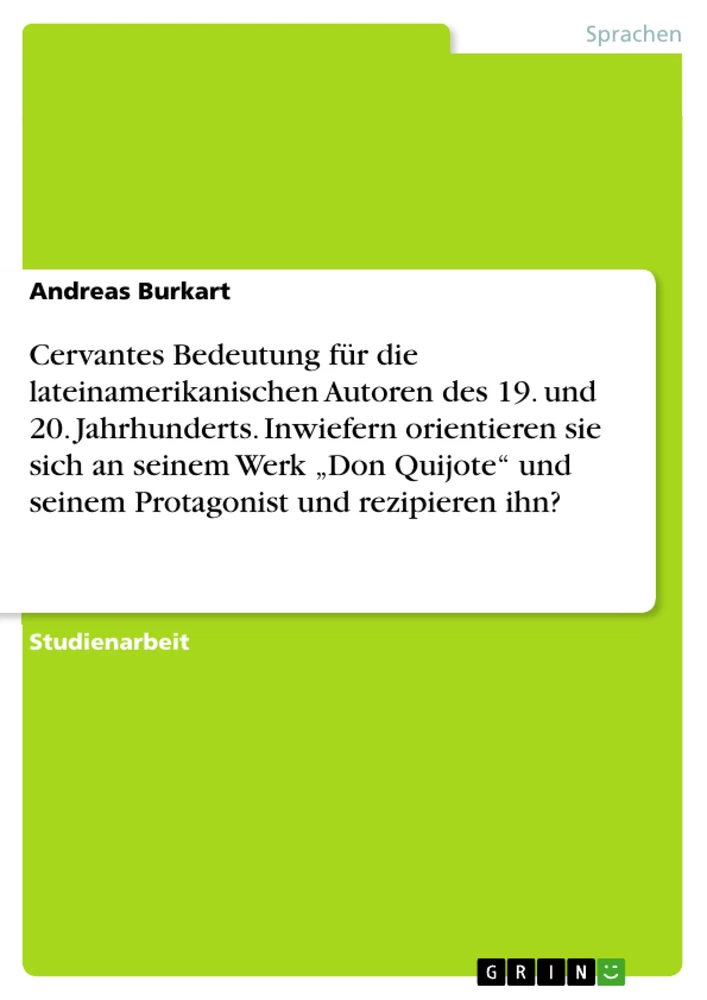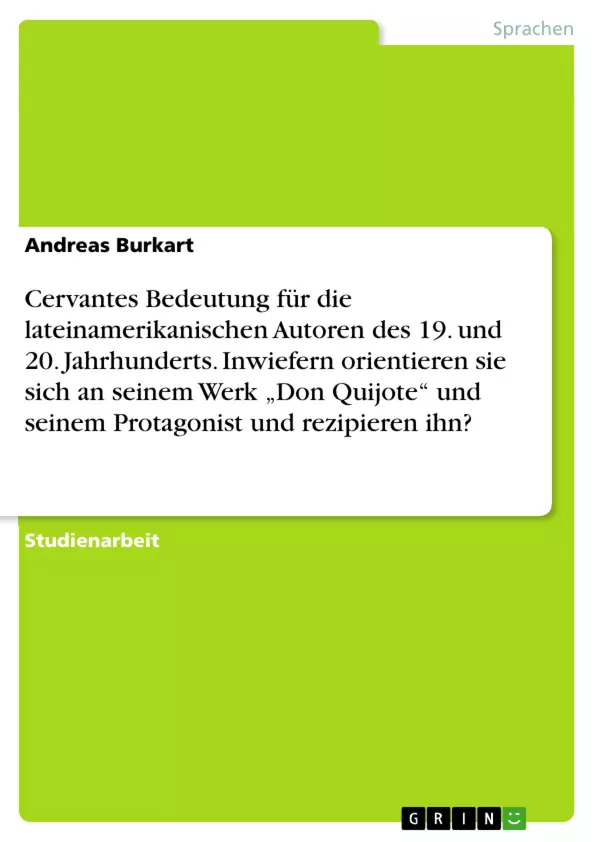Ich beschäftige ich mich in dieser Hausarbeit mit der Fragestellung, inwiefern sich die lateinamerikanischen Autoren des neunzehnten und zwanzigstsen Jahrhunderts an Cervantes und seinem Werk „Don Quijote“ sowie seinem Protagonist Don Quijote orientieren, ihn rezipieren und welche Bedeutung Cervantes für lateinamerikanische Autoren hat.
Dafür wird zunächst im zweiten Kapitel auf die Orientierung der lateinamerikanischen Autoren bezüglich dem Werk und der Figur eingegangen. Dabei wird zwischen einer Imitation des Werks wie beispielsweise bei Lizardi und Montalvo und einer Adaptation des Werks wie bei Febres Cordero oder Alberdi unterschieden.
In Kapitel 3 wird der Stellenwert des Don Quijote als lateinamerikanische Identifikationsfigur verdeutlicht. Kapitel 4 zeigt auf, inwiefern das Werk und die Figur des Don Quijote als Modell einer lateinamerikanischen Synthese verstanden werden kann. Im Fokus soll dabei das identitätsphilosophische Paradigma stehen. Dieses lateinamerikanische Paradigma wird im 5. Kapitel erneut aufgegriffen und auf die Weltliteratur übertragen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Don Quijote als Vorbild der lateinamerikanischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts
- 2.1 Die Imitation des „Don Quijote“
- 2.1.1 Fernández de Lizardi mit dem Roman „Periquillo Sarmiento“
- 2.1.2 Juan Montalvo mit dem Roman „Capítulos que se le olvidaron a Cervantes“
- 2.2 Die Adaption des „Don Quijote“
- 2.2.1 Tulio Febres Cordero
- 2.2.2 Alberdi
- 2.3 Jorge Luis Borges mit Pierre Menard, autor del Quijote
- 2.1 Die Imitation des „Don Quijote“
- 3. Die lateinamerikanische Identifikationsfigur: Don Quijote
- 4. Das Konzept einer lateinamerikanischen Synthese im Don Quijote
- 5. Die Gegensätze der Literatur im Don Quijote
- 5.1 Jorge Luis Borges
- 5.2 Carlos Fuentes
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss von Cervantes' „Don Quijote“ auf lateinamerikanische Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Arbeit analysiert, wie diese Autoren sich an Cervantes' Werk und seiner Hauptfigur orientierten und ihn rezipierten. Es wird die Bedeutung Cervantes für die lateinamerikanische Literatur beleuchtet.
- Imitation und Adaption von „Don Quijote“ in der lateinamerikanischen Literatur
- Don Quijote als lateinamerikanische Identifikationsfigur
- „Don Quijote“ als Modell einer lateinamerikanischen Synthese
- Das Konzept der Identität in der Rezeption von „Don Quijote“
- Die Darstellung von Gegensätzen in der Literatur im Kontext von „Don Quijote“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Fragestellung der Hausarbeit ein: Inwiefern orientieren sich lateinamerikanische Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts an Cervantes' „Don Quijote“, rezipieren sie ihn, und welche Bedeutung hat Cervantes für sie? Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und kündigt die Kapitelübersichten an, in denen die Imitation und Adaption des Werkes und die Rolle Don Quijotes als Identifikationsfigur behandelt werden.
2. Don Quijote als Vorbild der lateinamerikanischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts: Dieses Kapitel untersucht die Rezeption von „Don Quijote“ in der lateinamerikanischen Literatur nach der Unabhängigkeit. Es unterscheidet zwischen Imitation und Adaption des Werkes. Die Imitation wird anhand von Beispielen wie Fernández de Lizardi's „Periquillo Sarniento“ und Montalvo's „Capítulos que se le olvidaron a Cervantes“ erläutert. Die Adaption wird anhand von Beispielen wie Febres Cordero und Alberdi vorgestellt. Schließlich wird Borges' Essay „Pierre Menard, autor del Quijote“ als Parodie der Nachahmungen analysiert. Das Kapitel unterstreicht die Bedeutung von „Don Quijote“ als unumstrittenes Vorbild für lateinamerikanische Romanautoren dieser Zeit und hebt den identitätsphilosophischen und literarischen Quijotismo hervor.
2.1 Die Imitation des „Don Quijote“: Dieses Unterkapitel innerhalb von Kapitel 2 konzentriert sich auf die unterschiedlichen Arten der Imitation von Cervantes' „Don Quijote“ durch lateinamerikanische Autoren des 19. Jahrhunderts. Es werden exemplarisch Fernández de Lizardi mit seinem Roman „Periquillo Sarniento“ und Juan Montalvo mit seinem Werk „Capítulos que se le olvidaron a Cervantes“ analysiert. Bei Lizardi wird die Imitation durch Parallelen zwischen seinem Roman und dem Original aufgezeigt. Montalvo hingegen imitiert den Schreibstil, die Figurenkonstellationen und die Lokalitäten von Cervantes, so dass sein Werk als ein potentielles Kapitel des „Don Quijote“ gelesen werden kann.
2.1.1 Fernández de Lizardi mit dem Roman „Periquillo Sarniento“: Dieses Unterkapitel beleuchtet die Imitation von Cervantes durch Fernández de Lizardi in seinem Roman „Periquillo Sarniento“, dem ersten postkolonialen lateinamerikanischen Roman. Die Analyse konzentriert sich auf die Rechtfertigung des realistischen Stils durch Bezugnahme auf Cervantes und die zahlreichen Erwähnungen und Parallelen zu „Don Quijote“ im Roman selbst. Der Fokus liegt auf der Imitation der Erzähltechnik von Cervantes, der Fiktionalisierung des Autors, und der Parallelen zwischen den Protagonisten Don Quijote und Periquillo.
2.1.2 Juan Montalvo mit dem Roman „Capítulos que se le olvidaron a Cervantes“: Dieses Unterkapitel untersucht Montalvos Roman „Capítulos que se le olvidaron a Cervantes“, der den Eindruck erweckt, als handele es sich um fehlende Kapitel des „Don Quijote“. Die Analyse konzentriert sich auf die Imitation von Cervantes' Schreibstil, Figurenkonstellationen und Lokalitäten. Der Fokus liegt auf der universalen Bedeutung von „Don Quijote“ für lateinamerikanische Autoren, wie Montalvo im Vorwort seines Werkes betont.
Schlüsselwörter
Cervantes, Don Quijote, lateinamerikanische Literatur, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Imitation, Adaption, Identifikationsfigur, lateinamerikanische Identität, identitätsphilosophisches Paradigma, postkoloniale Literatur, Quijotismo, Realismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Der Einfluss von Cervantes' Don Quijote auf die lateinamerikanische Literatur
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss von Miguel de Cervantes' „Don Quijote“ auf lateinamerikanische Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie analysiert, wie diese Autoren Cervantes' Werk und seine Hauptfigur rezipierten und sich daran orientierten. Ein Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung von Cervantes für die Entwicklung der lateinamerikanischen Literatur.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Imitation und Adaption von „Don Quijote“ in der lateinamerikanischen Literatur, Don Quijote als lateinamerikanische Identifikationsfigur, „Don Quijote“ als Modell einer lateinamerikanischen Synthese, das Konzept der Identität in der Rezeption von „Don Quijote“, und die Darstellung von Gegensätzen in der Literatur im Kontext von „Don Quijote“.
Welche Autoren werden in der Hausarbeit untersucht?
Die Hausarbeit analysiert die Rezeption von „Don Quijote“ bei verschiedenen lateinamerikanischen Autoren, darunter Fernández de Lizardi (mit „Periquillo Sarniento“), Juan Montalvo (mit „Capítulos que se le olvidaron a Cervantes“), Tulio Febres Cordero, Alberdi und Jorge Luis Borges (mit „Pierre Menard, autor del Quijote“). Die Arbeit betrachtet auch die Werke von Carlos Fuentes.
Wie wird der Einfluss von „Don Quijote“ in der Hausarbeit dargestellt?
Die Hausarbeit unterscheidet zwischen Imitation und Adaption von „Don Quijote“. Die Imitation wird anhand von Beispielen erläutert, bei denen lateinamerikanische Autoren Cervantes' Werk direkt nachahmen oder Parallelen zu dessen Erzählweise und Figuren ziehen. Die Adaption beschreibt Fälle, in denen lateinamerikanische Autoren Elemente des „Don Quijote“ in ihre eigenen Werke integrieren und neu interpretieren.
Welche konkreten Beispiele für Imitation und Adaption werden genannt?
Als Beispiele für Imitation werden Fernández de Lizardis „Periquillo Sarniento“ und Montalvos „Capítulos que se le olvidaron a Cervantes“ analysiert. Die Adaption wird anhand der Werke von Febres Cordero und Alberdi illustriert. Borges' „Pierre Menard, autor del Quijote“ wird als Parodie der Nachahmungen untersucht.
Welche Rolle spielt Don Quijote als Identifikationsfigur?
Die Hausarbeit untersucht die Bedeutung Don Quijotes als Identifikationsfigur für lateinamerikanische Autoren und erörtert, wie dieser Aspekt die Rezeption des Werkes beeinflusst hat. Es wird beleuchtet, wie die Figur Don Quijote mit Fragen der lateinamerikanischen Identität verknüpft ist.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit ist in mehrere Kapitel unterteilt: Eine Einleitung, ein Kapitel über Don Quijote als Vorbild der lateinamerikanischen Literatur, ein Kapitel über Don Quijote als lateinamerikanische Identifikationsfigur, ein Kapitel über das Konzept einer lateinamerikanischen Synthese im Don Quijote, ein Kapitel über die Gegensätze in der Literatur im Kontext von Don Quijote und ein Fazit. Jedes Kapitel enthält Unterkapitel, die sich mit spezifischen Aspekten der Thematik befassen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Cervantes, Don Quijote, lateinamerikanische Literatur, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Imitation, Adaption, Identifikationsfigur, lateinamerikanische Identität, identitätsphilosophisches Paradigma, postkoloniale Literatur, Quijotismo, Realismus.
- Quote paper
- Andreas Burkart (Author), 2016, Cervantes Bedeutung für die lateinamerikanischen Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts. Inwiefern orientieren sie sich an seinem Werk „Don Quijote“ und seinem Protagonist und rezipieren ihn?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351342