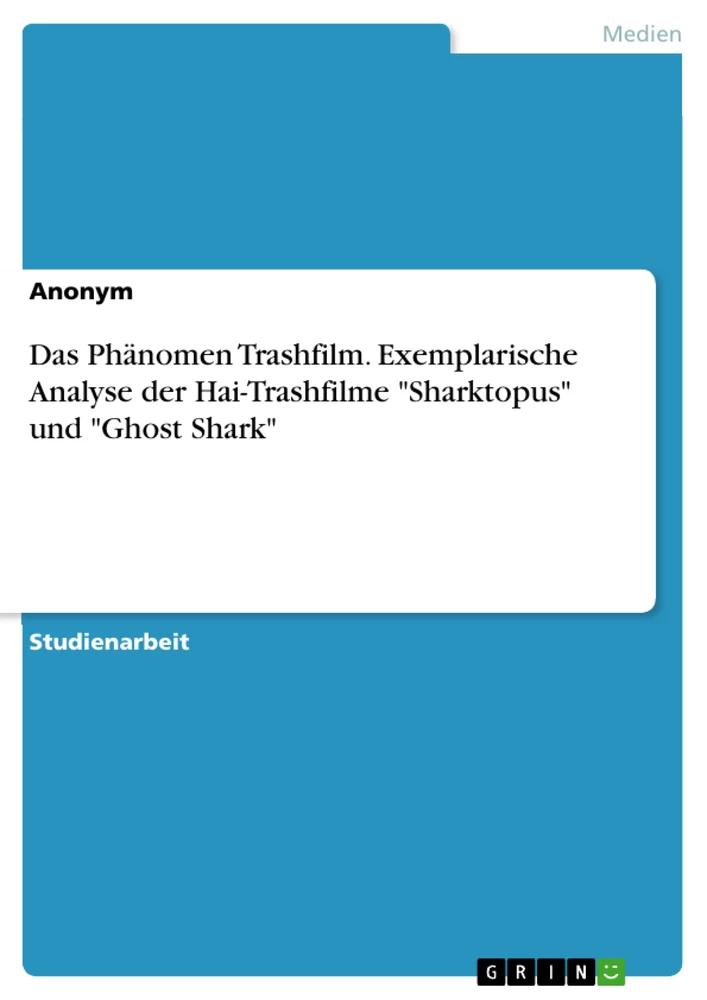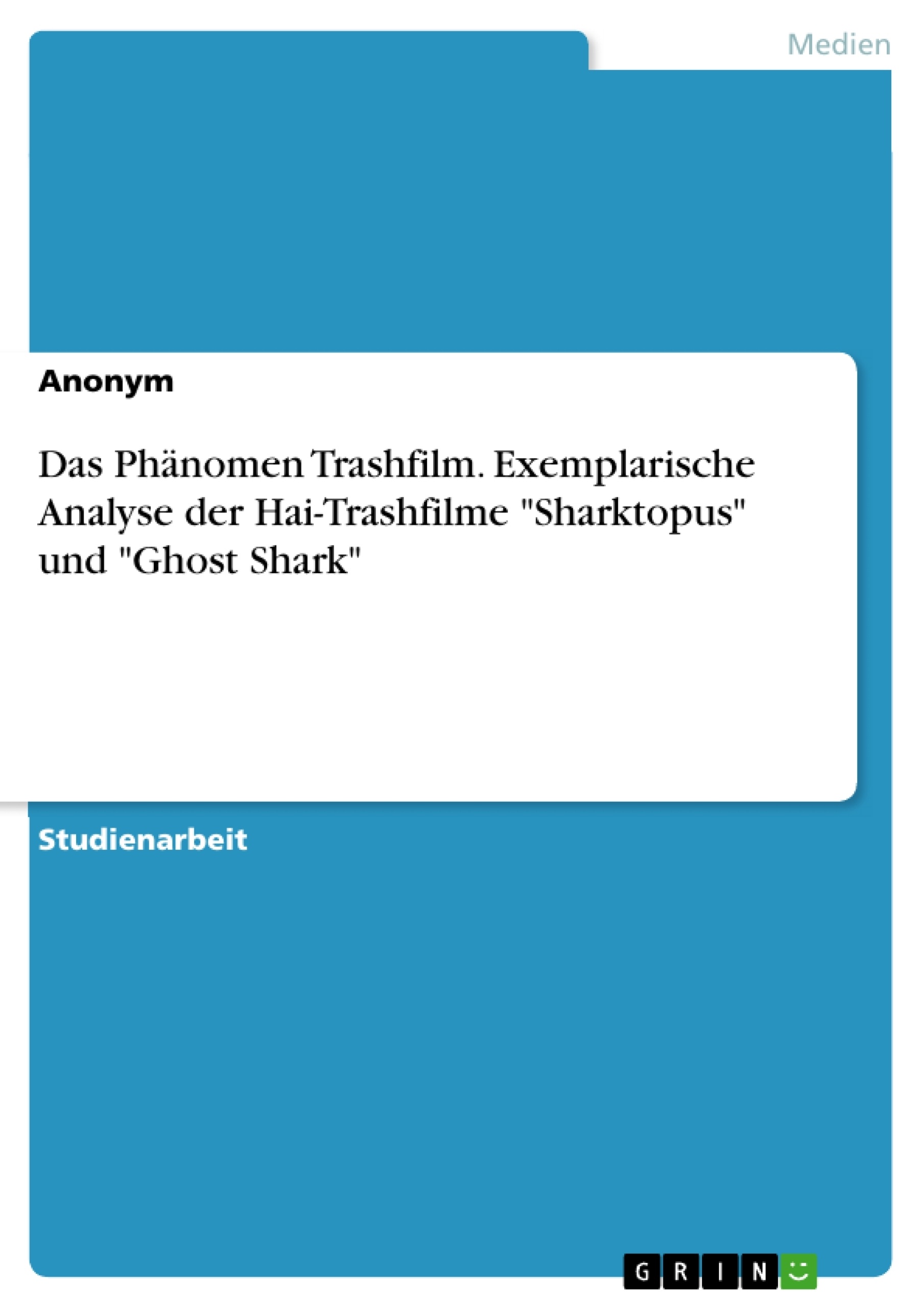Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen des Trashs im Film, anschaulich gemacht wird dieses am Beispiel von zwei ausgewählten Filmen des Subgenres der Hai-Trashfilme, Sharktopus sowie Ghost Shark, da diese aufgrund ähnlicher Elemente, auf welche im Verlauf der Arbeit näher eingegangen wird, eine gute Vergleichbarkeit ermöglichen.
Als Trashfilme werden Filme bezeichnet, welche sich im Allgemeinen dadurch auszeichnen, dass sie einer qualitativ schlechten Machart entsprechen und mit sehr geringem Budget verwirklicht wurden. Die (produktionstechnische, dramaturgische etc.) Qualität muss hierbei in Kontext zu den momentan gängigen Standards gesetzt werden, wobei diese massiv unterboten werden.
Viele der Filme haben mittlerweile sogar einen gewissen Kultstatus erlangt. Sharknado , der erste Film des Genres, dem es gelang, ein größeres Publikum auf sich aufmerksam zu machen, erreichte beim Auftakt der Reihe die „Schlechtesten Filme aller Zeiten“ auf Tele 5 beispielsweise mit 3,5 Prozent und 300.000 Zuschauern einen überraschend hohen Marktanteil. In den USA sahen den Film bei der Erstausstrahlung rund 1,37 Millionen Zuschauer.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Zielsetzung
- 2. Das Phänomen Trash
- 2.1 Rezeptionsmodi
- 2.2 Entwicklung des Genres
- 2.2.1 Hai-Trash
- 3. Exemplarische Analyse der ausgewählten Filme
- 3.1 Sharktopus
- 3.2 Ghost Shark
- 3.3 Das Haimonster als Epitom des Natur/Kultur-Konfliktes
- 3.4 Analyse im Hinblick auf typische Stilmittel
- 3.5 Medientheoretische Einordnung der Popularitätsentwicklung des Genres
- 4. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen "Trashfilm" am Beispiel der Hai-Trashfilme "Sharktopus" und "Ghost Shark". Ziel ist die medienkritische Beurteilung dieser Filme unter Berücksichtigung genrespezifischer Merkmale und deren Popularität. Die Analyse fokussiert auf stilistische Mittel, den Natur/Kultur-Konflikt und die Darstellung von Rollenklischees.
- Definition und Entwicklung des Trashfilm-Genres
- Analyse spezifischer Stilmittel in Hai-Trashfilmen
- Der Natur/Kultur-Konflikt als zentrales Thema
- Interpretation der Popularität des Genres
- Vergleichende Analyse von "Sharktopus" und "Ghost Shark"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Zielsetzung: Die Einleitung definiert Trashfilme als Produktionen mit geringer Produktionsqualität, die jedoch oft Kultstatus erreichen. Die Arbeit analysiert "Sharktopus" und "Ghost Shark" als exemplarische Vertreter des Hai-Trash-Subgenres, um die Relevanz und Faszination dieser Filme medienkritisch zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Analyse spezifischer Stilmittel, dem Natur/Kultur-Konflikt und der Popularität des Genres.
2. Das Phänomen Trash: Dieses Kapitel beleuchtet die semantische Entwicklung des Begriffs "Trash" und dessen Anwendung auf Filme. Es werden die Merkmale von Trashfilmen diskutiert, wie z.B. billige Spezialeffekte, schlechte Schauspielerei und triviale Handlungen. Der Bedeutungswandel von "Trash" als ursprünglich abwertender Begriff hin zu einem ästhetischen Konzept wird herausgearbeitet, wobei der bewusste Bruch mit konventionellen Filmstandards als charakteristisches Merkmal hervorgehoben wird. Die anfängliche Unbeabsichtigtheit mangelnder Produktionsqualität im Gegensatz zur modernen bewussten Inszenierung wird erklärt.
Schlüsselwörter
Trashfilm, Hai-Trash, Sharktopus, Ghost Shark, Medienkritik, Genreanalyse, Stilmittel, Natur/Kultur-Konflikt, Popularität, Rezeption, Kultstatus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Analyse von Hai-Trashfilmen ("Sharktopus" und "Ghost Shark")
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Phänomen "Trashfilm" am Beispiel der Hai-Trashfilme "Sharktopus" und "Ghost Shark". Der Fokus liegt auf einer medienkritischen Beurteilung dieser Filme, unter Berücksichtigung genrespezifischer Merkmale und deren Popularität.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Entwicklung des Trashfilm-Genres, Analyse spezifischer Stilmittel in Hai-Trashfilmen, der Natur/Kultur-Konflikt als zentrales Thema, Interpretation der Popularität des Genres und eine vergleichende Analyse von "Sharktopus" und "Ghost Shark". Es wird auch die semantische Entwicklung des Begriffs "Trash" und dessen Anwendung auf Filme beleuchtet.
Welche Methoden werden in der Analyse verwendet?
Die Analyse fokussiert auf stilistische Mittel, den Natur/Kultur-Konflikt und die Darstellung von Rollenklischees. Es wird eine medienkritische Beurteilung der Filme unter Berücksichtigung genrespezifischer Merkmale vorgenommen.
Welche Filme werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert exemplarisch die Hai-Trashfilme "Sharktopus" und "Ghost Shark".
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist die medienkritische Beurteilung von "Sharktopus" und "Ghost Shark" unter Berücksichtigung genrespezifischer Merkmale und deren Popularität. Es soll die Relevanz und Faszination dieser Filme medienkritisch beleuchtet werden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung mit Zielsetzung, ein Kapitel zum Phänomen Trash (inkl. Rezeptionsmodi und Genreentwicklung), ein Kapitel zur exemplarischen Analyse der ausgewählten Filme (inkl. Analyse spezifischer Stilmittel und medientheoretischer Einordnung), und abschließend eine Zusammenfassung und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Trashfilm, Hai-Trash, Sharktopus, Ghost Shark, Medienkritik, Genreanalyse, Stilmittel, Natur/Kultur-Konflikt, Popularität, Rezeption, Kultstatus.
Was wird unter "Trashfilm" verstanden?
In dieser Arbeit werden Trashfilme als Produktionen mit geringer Produktionsqualität definiert, die jedoch oft Kultstatus erreichen. Der Begriff "Trash" erfährt einen Bedeutungswandel von einem ursprünglich abwertenden Begriff hin zu einem ästhetischen Konzept, wobei der bewusste Bruch mit konventionellen Filmstandards als charakteristisches Merkmal hervorgehoben wird.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Das Phänomen Trashfilm. Exemplarische Analyse der Hai-Trashfilme "Sharktopus" und "Ghost Shark", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351426