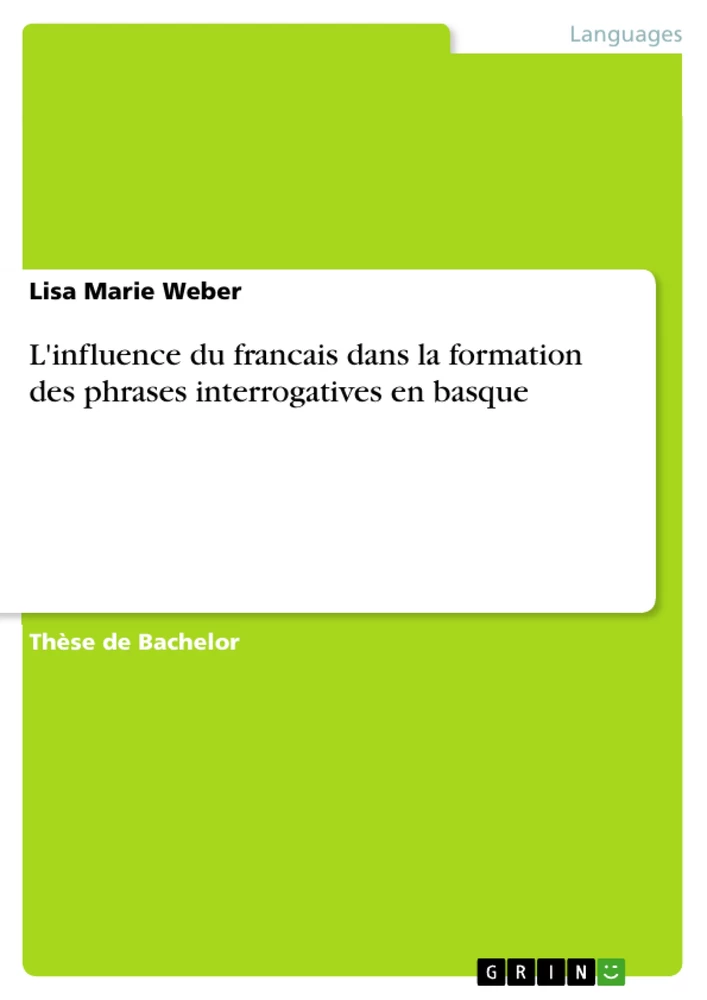Dans ce travail, il s’agit d’une analyse descriptive de l’usage des questions partielles in situ en basque labourdin et leur influence du français. Le basque (euskara) est une langue isolée parlée dans le sud de la France au département
Pyrénées Atlantiques et au nord de l’Espagne. Le Pays Basque est divisé en sept provinces, dont quatre en Espagne et trois en France. Dans chaque province, on parle une certaine variété. Les variétés peuvent êtres très différentes. Dans les années 1960, on a créé une variété standard avec sa propre grammaire que l’on appelle Euskara batua (basque uni).
Morphologiquement, le basque est une langue ergative-absolutive. De plus, c’est une langue de sujet elliptique à trois fois, ce que Duguine & Irurtzun (2014) appellent Three Times Pro Drop Language. Il est entouré de langues romanes, principalement l’espagnol et le français. Dans l’histoire, le gascon a aussi joué un grand rôle en ce qui concerne les influences à la langue basque (Haase, 1992). La situation au pays basque est diglossique : soit basque-espagnol, soit basque-français.
Le basque possède un nombre d’environ 700000 locuteurs, mais au Pays Basque d’Espagne, le nombre de jeunes locuteurs, surtout des néobascophones, croît, quant aux locuteurs du Pays Basque français où il décroît. La langue basque est connue pour un ordre de mots relativement libre. Toutefois, dans les phrases interrogatives wh 1, l’ordre est assez stricte. Néanmoins, du point de vue régional, l’ordre des mots y peut aussi varier. En 2014, Duguine & Irurtzun (2014) ont découvert en basque labourdin et navarro-labourdin, deux des trois dialectes parlés dans le Pays Basque français, une stratégie pour former des phrases interrogatives wh tout-à-fait nouvelle ressemblant à la stratégie wh-in situ française.
Une possible influence est donc supposée. Cette nouvelle stratégie wh basque sera présentée dans le travail suivant après avoir expliqué la formation des phrases interrogatives wh en langue française en tenant compte spécial sur la stratégie wh-in situ et celle en euskara batua. Ensuite, une enquête sur la fréquence de cette stratégie sera présentée et ses données seront évaluées et interprétées. Enfin, le travail sera conclu et des perspectives futures seront indiquées.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Introduction
- 2. Formation des phrases interrogatives wh en français en tenant compte spécial des constructions wh-in situ
- 3. Formation des phrases interrogatives wh en euskara batua
- 3.1. Faits généraux sur la syntaxe de la langue basque
- 3.2. Structure wh
- 4. Etat de la recherche
- 4.1. Un changement linguistique éventuel en labourdin
- 4.1.1. Données trouvées
- 4.1.2. Similarités en langue française
- 4.1.3. Autres caractéristiques
- 4.2. Des facteurs susceptibles de provoquer ce changement
- 4.2.1. Des facteurs sociolinguistiques
- 4.2.2. Des facteurs naturels
- 4.3. Discussion
- 4.1. Un changement linguistique éventuel en labourdin
- 5. Saisie de données empiriques
- 5.1. Méthode
- 5.2. Participants
- 5.3. Données
- 6. Interprétation des résultats
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung interrogativer wh-Sätze im Baskischen, insbesondere im Laboridinischen und Navarro-Laboridinischen Dialekt, und deren mögliche Beeinflussung durch das Französische. Die Studie konzentriert sich auf eine neuartige Strategie zur Bildung solcher Sätze, die Ähnlichkeiten zur französischen „wh-in situ“-Strategie aufweist.
- Analyse der Bildung interrogativer wh-Sätze im Französischen, mit besonderem Fokus auf die „wh-in situ“-Konstruktion.
- Beschreibung der Bildung interrogativer wh-Sätze im Standardbaskischen (Euskara batua).
- Untersuchung des Einflusses des Französischen auf die baskische Syntax im Kontext interrogativer Sätze.
- Empirische Datenerhebung und -auswertung zur Häufigkeit der neuen Strategie im Laboridinischen.
- Diskussion möglicher soziolinguistischer und natürlicher Faktoren, die den Sprachwandel beeinflussen könnten.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Introduction: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor: Das Baskische als isolierte Sprache, die geographische Verteilung der Dialekte und die Entstehung des Euskara batua. Sie beschreibt die morphologischen Eigenschaften des Baskischen und seine diglossische Situation, mit Fokus auf den Rückgang der baskischen Sprecher in Frankreich und den Anstieg im spanischen Teil des Baskenlandes. Der Schwerpunkt liegt auf dem relativ freien Wortstellung im Baskischen, im Gegensatz zur strengeren Ordnung in interrogativen wh-Sätzen. Die Einleitung führt die neu entdeckte Strategie im Laboridinischen ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit.
2. Formation des phrases interrogatives wh en français en tenant compte spécial des constructions wh-in situ: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Strategien zur Bildung interrogativer wh-Sätze im Französischen, darunter die „wh-in situ“-Strategie. Es analysiert die Eigenschaften dieser Strategie, wie den Interventionseffekt und die Ungrammatikalität in wh-islands und indirekten Fragen. Es werden pragmatische Aspekte diskutiert, wie die Presupposition und die Exhaustivität von Fragen, im Vergleich zu anderen Fragestrukturen. Das Kapitel untersucht die Verbreitung von „wh-in situ“ in verschiedenen Kontexten und Sprachen, basierend auf Studien zu Übersetzungen von Romanen.
3. Formation des phrases interrogatives wh en euskara batua: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Bildung interrogativer wh-Sätze im Standardbaskischen (Euskara batua). Es beschreibt allgemeine Aspekte der baskischen Syntax und analysiert die Struktur interrogativer wh-Sätze. Der Fokus liegt darauf, den grundlegenden Aufbau dieser Satzstrukturen im Standardbaskischen zu verstehen, um ihn im weiteren Verlauf mit der Entwicklung im Laboridinischen zu vergleichen. Dieser Vergleich bildet die Basis für die Analyse des möglichen Einflusses des Französischen.
4. Etat de la recherche: Dieses Kapitel befasst sich mit dem aktuellen Forschungsstand zum Thema. Es untersucht einen möglichen sprachlichen Wandel im Laboridinischen bezüglich der Bildung interrogativer wh-Sätze und betrachtet Parallelen zum Französischen. Es diskutiert soziolinguistische und natürliche Faktoren, die diesen Wandel möglicherweise beeinflusst haben. Die Diskussion analysiert die gefundenen Daten und ihren Kontext innerhalb der bestehenden Literatur.
5. Saisie de données empiriques: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Datenerhebung. Es legt dar, welche Methoden eingesetzt wurden, wer an der Studie teilgenommen hat und welche Daten erhoben wurden. Es liefert detaillierte Informationen zur Durchführung der Untersuchung und der Auswahl der Teilnehmergruppe, um die wissenschaftliche Validität der gewonnenen Ergebnisse zu gewährleisten.
Häufig gestellte Fragen zur Studie: Entstehung interrogativer wh-Sätze im Baskischen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung interrogativer wh-Sätze im Baskischen, insbesondere im Laboridinischen und Navarro-Laboridinischen Dialekt, und deren mögliche Beeinflussung durch das Französische. Der Fokus liegt auf einer neuartigen Strategie zur Bildung solcher Sätze, die Ähnlichkeiten zur französischen „wh-in situ“-Strategie aufweist.
Welche Sprachen werden in der Studie verglichen?
Die Studie vergleicht die Bildung interrogativer wh-Sätze im Französischen und im Standardbaskischen (Euskara batua), mit besonderem Augenmerk auf den Laboridinischen Dialekt des Baskischen.
Was sind die Zielsetzungen der Studie?
Die Studie analysiert die Bildung interrogativer wh-Sätze im Französischen (inkl. "wh-in situ"-Konstruktion), beschreibt die Bildung solcher Sätze im Standardbaskischen, untersucht den Einfluss des Französischen auf die baskische Syntax im Kontext interrogativer Sätze, wertet empirische Daten zur Häufigkeit der neuen Strategie im Laboridinischen aus und diskutiert mögliche soziolinguistische und natürliche Faktoren, die den Sprachwandel beeinflussen könnten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Bildung interrogativer wh-Sätze im Französischen (inkl. "wh-in situ"), Bildung interrogativer wh-Sätze im Standardbaskischen, Forschungsstand (inkl. möglicher Sprachwandel im Laboridinischen und Parallelen zum Französischen), empirische Datenerhebung und -interpretation der Ergebnisse. Jedes Kapitel wird detailliert zusammengefasst.
Wie wird die "wh-in situ"-Strategie im Französischen beschrieben?
Das Kapitel zum Französischen beschreibt verschiedene Strategien zur Bildung interrogativer wh-Sätze, inklusive der "wh-in situ"-Strategie. Es analysiert deren Eigenschaften (Interventionseffekt, Ungrammatikalität in wh-islands und indirekten Fragen), pragmatische Aspekte (Presupposition, Exhaustivität) und Verbreitung in verschiedenen Kontexten und Sprachen (basierend auf Studien zu Übersetzungen).
Wie wird die Bildung interrogativer wh-Sätze im Standardbaskischen beschrieben?
Das Kapitel zum Standardbaskischen beschreibt allgemeine Aspekte der baskischen Syntax und analysiert die Struktur interrogativer wh-Sätze. Ziel ist es, den grundlegenden Aufbau dieser Satzstrukturen im Standardbaskischen zu verstehen, um ihn mit der Entwicklung im Laboridinischen zu vergleichen und den möglichen Einfluss des Französischen zu analysieren.
Wie wird der Forschungsstand zum Thema dargestellt?
Das Kapitel zum Forschungsstand untersucht einen möglichen sprachlichen Wandel im Laboridinischen bezüglich der Bildung interrogativer wh-Sätze und betrachtet Parallelen zum Französischen. Es diskutiert soziolinguistische und natürliche Faktoren, die diesen Wandel möglicherweise beeinflusst haben und analysiert die gefundenen Daten im Kontext der bestehenden Literatur.
Wie wird die empirische Datenerhebung beschrieben?
Das Kapitel zur empirischen Datenerhebung beschreibt die Methodik, die eingesetzten Methoden, die Teilnehmer der Studie und die erhobenen Daten. Es liefert detaillierte Informationen zur Durchführung der Untersuchung und Teilnehmerauswahl, um die wissenschaftliche Validität der Ergebnisse zu gewährleisten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die konkreten Schlussfolgerungen der Studie werden im Kapitel zur Interpretation der Ergebnisse dargestellt und sind nicht explizit in der Inhaltsübersicht aufgeführt. Die Zusammenfassung der Kapitel liefert jedoch einen guten Überblick über die behandelten Themen und Fragestellungen.
- Arbeit zitieren
- Lisa Marie Weber (Autor:in), 2016, L'influence du francais dans la formation des phrases interrogatives en basque, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351572