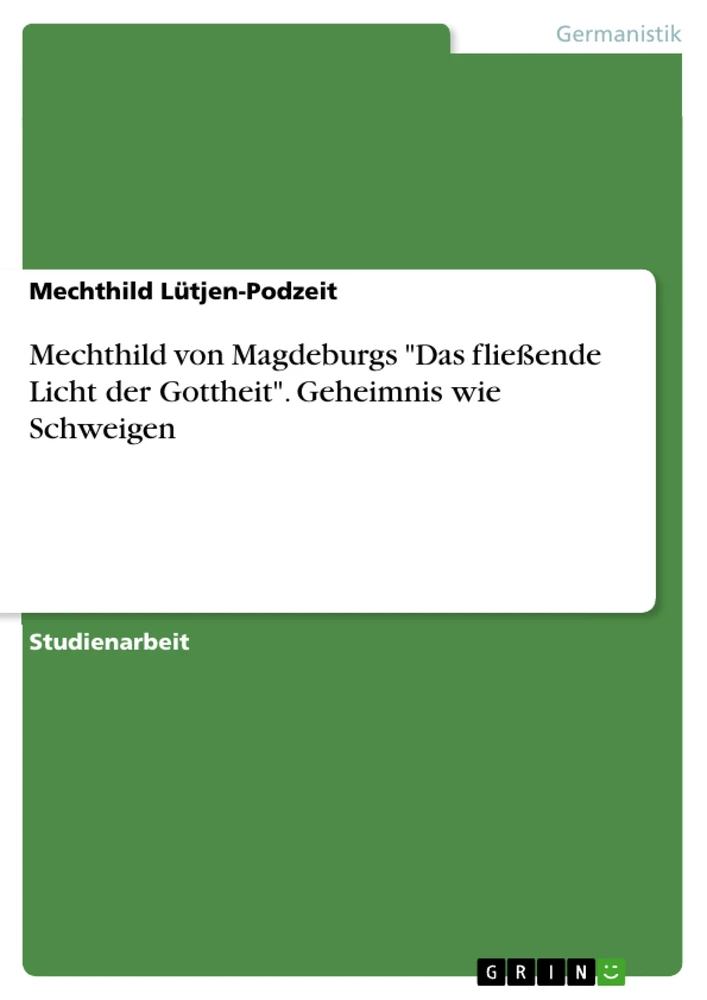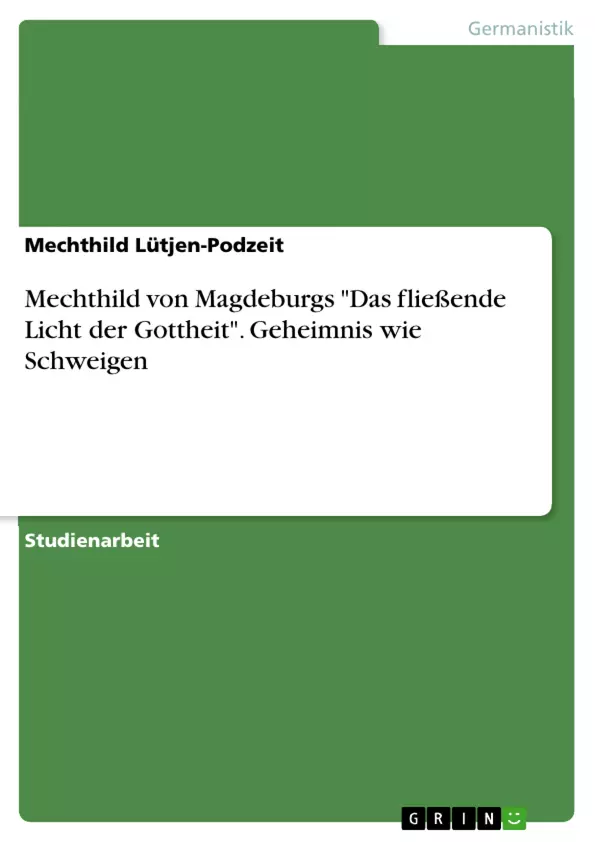Diese Proseminararbeit behandelt Mechthild von Magdeburgs "Das fließende Licht der Gottheit". Interpretiert wird das Werk gemeinsam mit Literaturzitaten zu Schweigen und Stille von Aichinger, Eckhart, und vielen mehr.
Ob Geheimnisse poetogen wirken? Diese Frage kann bejaht werden, wenn Texte als geheimnisvoll entstanden gezeichnet sind. Das kann man am „Beiwerk eines Buches“ erkennen, den so genannten Paratexten. Sie bilden mit Rezeptionsanweisungen zwischen Text und Nicht-Text oder Ankündigungen im Prolog die Mosaiksteine eines Entstehungsmythos, der einem Text von Anfang an eine mysteriale Aura verleiht. Bereits Titel teilen mit, dass die Genese der Texte auf besonderem, übernatürlichem Weg erfolgt ist. Wie bei allen Einweihungsschriften hängt die Aura mit Schwellenüberschreitung zusammen, die eine private Offenbarung darstellt von üblicherweise nicht Wißbarem.
Zur poetogenen Kraft der Geheimnisse gehört das ebenso wirksame mysteriogene Moment der Poesie (Mertens). Ihm ist vielleicht zu verdanken, dass ein mittels Texten offenbartes Geheimnis, das ja im Grunde kein Geheimnis mehr ist, es im mystischen Sinne doch bleibt: die Unverfügbarkeit der Erfahrung ist nicht aufzuheben durch die Publikation.
Inhaltsverzeichnis
- A) Allgemeines zur Textinterpretation
- Mehr als nur der Text: Verschwiegene Gottesrede
- Betrachtung und Beobachtung
- Zur Wort- und Begriffsgeschichte
- Die Kunst der Interpretation – Enthistorisierung des Texts?
- B) Fliessendes Licht fliessende Stille
- Theodor Fontane
- Søren Kierkegaard
- Angelus Silesius
- Dorothee Sölle
- Ilse Aichinger
- John Cage
- Thomas Bernhard
- Karlfried Graf Dürckheim
- Meister Eckhart
- Jiddu Krishnamurti
- Deepak Chopra
- Laotse
- Gerhard Kofler
- C) Annäherung an Stille in der Literatur
- Peter Rosegger
- Anton Tschechow
- Ilse Gräfin von Bredow
- Arno Surminski
- I Verschmelzung versus Zweiheit
- 2A) Allgemeines zur Textinterpretation
- Mehr als nur der Text: Verschwiegene Gottesrede: Die Mystik der Begine Mechthild von Magdeburg (etwa 1207 bis 1282)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der „Fließenden Stille“ in der Mystik Mechthild von Magdeburgs, indem sie den Text „Das fließende Licht der Gottheit“ auf seine poetogene Kraft und seine Geheimnisse hin untersucht. Sie analysiert, wie Stille und Schweigen in der Mystik von Mechthild von Magdeburg eine zentrale Rolle spielen und wie diese Themen in der Literatur und Philosophie behandelt werden.
- Die mystische Erfahrung von Mechthild von Magdeburg im Kontext der Literatur
- Die Bedeutung von Stille und Schweigen in der mystischen Gotteserfahrung
- Der Einfluss von Texten auf die Interpretation von Geheimnis und Stille
- Die Rolle von Sprache und Sprachlosigkeit in der mystischen Kommunikation
- Die Verschmelzung von Religion und Erotik in der mystischen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
- Im ersten Teil werden die Grundlagen der Textinterpretation und die Verschwiegene Gottesrede in Mechthilds Werk beleuchtet. Es werden die Bedeutung von Paratexten, die Rolle von Übersetzungsprozessen und die Bedeutung von Wiederholungen in Mechthilds Text untersucht.
- Der zweite Teil erforscht die verschiedenen Perspektiven auf „Fließendes Licht“ und „Fließende Stille“ von verschiedenen Autoren wie Fontane, Kierkegaard, Angelus Silesius, Sölle, Aichinger, Cage, Bernhard, Dürckheim, Eckhart, Krishnamurti, Chopra, Laotse und Kofler.
- Der dritte Teil konzentriert sich auf die Annäherung an Stille in der Literatur durch Autoren wie Rosegger, Tschechow, Gräfin von Bredow und Surminski.
Schlüsselwörter
Mystik, Mechthild von Magdeburg, Stille, Schweigen, Gotteserfahrung, Sprache, Sprachlosigkeit, Interpretation, Paratexte, Übersetzung, Wiederholungen, Literatur, Philosophie, Erotik, Religion, Geheimnis, Poetogene Kraft, Geheimnisse, Textinterpretation, Transzendenz, Dialog, Betrachtung, Beobachtung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Mechthild von Magdeburgs Werk?
„Das fließende Licht der Gottheit“ ist ein Hauptwerk der deutschen Mystik (13. Jh.), das die persönliche Gotteserfahrung der Begine Mechthild beschreibt.
Welche Rolle spielen Schweigen und Stille in der Mystik?
Schweigen und Stille sind zentrale Elemente der Gottesbegegnung; sie markieren die Grenze des Sagbaren und die Unverfügbarkeit der spirituellen Erfahrung.
Was sind Paratexte in diesem Kontext?
Paratexte sind „Beiwerke“ eines Buches wie Titel oder Prologe, die dem Text eine mysteriale Aura verleihen und Rezeptionsanweisungen für den Leser enthalten.
Wie hängen Religion und Erotik in Mechthilds Sprache zusammen?
Die mystische Sprache Mechthilds nutzt oft erotische Metaphern, um die leidenschaftliche Verschmelzung der Seele mit Gott darzustellen.
Welche modernen Autoren werden zum Vergleich herangezogen?
Die Arbeit vergleicht Mechthilds Ansätze mit Literaturzitaten von Ilse Aichinger, Thomas Bernhard, John Cage und Meister Eckhart.
- Quote paper
- Mechthild Lütjen-Podzeit (Author), 2014, Mechthild von Magdeburgs "Das fließende Licht der Gottheit". Geheimnis wie Schweigen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351767