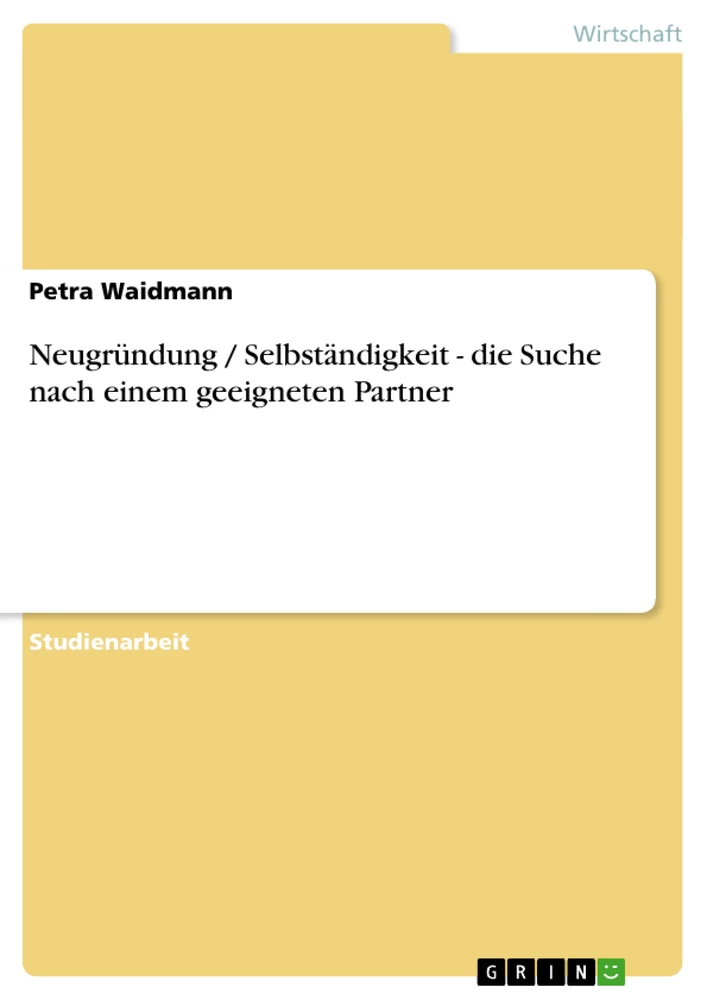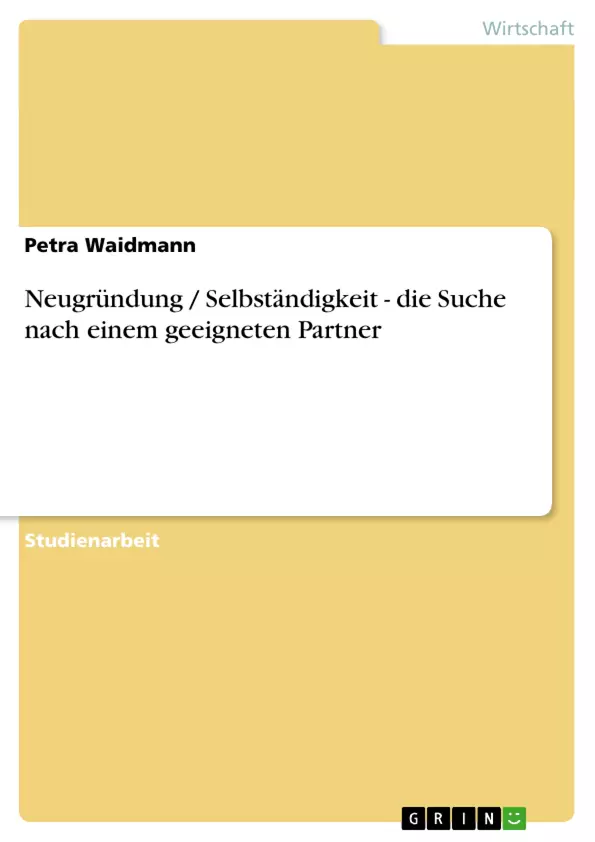[...] In diese Form könnten beispielsweise Überlegungen eines Unternehmens münden, das sich zu einem
Verbund mit einem anderen Betrieb entschlossen hat. Immer mehr Firmen drücken auf diesem oder ähnlichem
Wege den Willen zur Suche nach einem geeigneten Geschäftspartner aus. In den vergangenen
Jahren hat sich sukzessive der Trend zur Kooperation herauskristallisiert.
Nach Balling1 läßt sich zwar der empirische Nachweis der Bedeutung und Entwicklung mittels sekundärstatistischem
Datenmaterial nicht erbringen, da amtliche Statistiken nur Anhaltspunkte über vollständige
Vereinigungen liefern (z.B. bei Fusionen), dennoch werde dies deutlich durch vermehrte Pressemeldungen
und das zunehmende Interesse der Firmen an Kooperationsformen. Zudem habe bereits im Jahre
1991 eine Umfrage des Rationalisierungs-Kuratoriums der Deutschen Wirtschaft (RKW) ergeben, daß seit
Mitte der achtziger Jahre Kooperationsformen stärker in Betracht gezogen würden. Im Rahmen dieser
empirischen Erhebung bei kleinen und mittleren Unternehmen in Ost- und Westdeutschland sei festgestellt
worden, daß 28% der Befragten bereits Erfahrungen mit Partnerschaften gesammelt und von den
übrigen sich mehr als 40% entschlossen hätten, in nächster Zeit Kooperation einzugehen. Diese Zahlen
stünden somit im deutlichen Gegensatz zu der bis zu diesem Zeitraum „eher zurückhaltenden Einstellung“
deutscher Unternehmen hinsichtlich Zusammenschlüssen.
Aber warum suchen Unternehmen eigentlich die Zusammenarbeit mit anderen Betrieben, welche Hintergründe,
Voraussetzungen und Zielsetzungen können zu diesem Sc hritt mit teilweise weitreichenden Konsequenzen
führen, welche Möglichkeiten der Kooperation existieren und welche Wege beschreiten Unternehmen
um den für sie idealen Partner zu finden?
Diese sind nur einige der wichtigsten Fragen, die in diesem Zusammenhang zu klären sind.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die zentralen theoretischen Hintergründe aufzuzeigen, eine gewisse
Systematik in der Vorgehensweise zur Kooperation aufzudecken und sowohl auf erreichbare Ziele und
Chancen als auch auf Risiken hinzuweisen, die solch eine Verbindung mit sich bringt. Zudem werden für
die praktische Umsetzung der Partnersuche Wege erläutert, die ein Unternehmen mittels der sich im Anhang
befindenden Kontaktadressen einschlagen kann.
1 vgl. Kelting-Büttner, Ergebnisse der RKW- Kooperationsumfrage Eschborn 1991, S.1, zitiert nach Balling,
Kooperation, S.29-30
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Kooperationen in der Theorie
- Bedeutung von Unternehmenszusammenschlüssen
- Kooperation - Begriffsbestimmung
- Kooperationsformen und Abgrenzung zu verwandten Begriffen
- Unterscheidung nach verbleibender Selbständigkeit
- Unterscheidung nach verbundenen Produktions- / Handelsstufen
- Unterscheidung nach betrieblichen Kooperationssektoren
- Grenzüberschreitende Vereinigungen
- Determinanten im Rahmen der Umsetzung einer Kooperation
- Kontaktwege zum idealen Partner
- Traditionelle Wege
- Nutzung neuer Medien
- Funktionsweise einer Börse
- Business Angels Forum
- Börsen der IHK
- Die Kapazitätenbörse
- Die Kooperationsbörse
- Die Technologiebörse
- Die Existenzgründerbörse
- Schlußbetrachtung
- Anhang - Kontaktadressen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik der Neugründung/Selbständigkeit und der Suche nach dem geeigneten Kooperationspartner. Sie zielt darauf ab, die zentralen theoretischen Hintergründe der Unternehmenszusammenschlüsse aufzuzeigen, eine Systematik in der Vorgehensweise zur Kooperation zu entwickeln und auf erreichbare Ziele, Chancen und Risiken hinzuweisen. Darüber hinaus werden praktische Wege zur Partnersuche erläutert und relevante Kontaktadressen im Anhang bereitgestellt.
- Bedeutung von Unternehmenszusammenschlüssen im Wettbewerbsumfeld
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Kooperation"
- Kooperationsformen und ihre Eigenschaften
- Determinanten der Umsetzung einer Kooperation
- Praktische Wege zur Suche nach einem geeigneten Kooperationspartner
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die wachsende Bedeutung von Kooperationen im Kontext des Wettbewerbs auf gesättigten Märkten. Sie stellt den Lesern den Problemkreis der Unternehmenszusammenschlüsse vor, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen. Sie führt zudem die zentralen Fragen auf, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden.
Kooperationen in der Theorie
Dieses Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen von Unternehmenszusammenschlüssen. Es wird die Bedeutung von Kooperation im Wettbewerbsumfeld betrachtet, der Begriff "Kooperation" definiert und von verwandten Begriffen abgegrenzt. Die verschiedenen Kooperationsformen werden mit ihren jeweiligen Eigenschaften und Merkmalen vorgestellt.
Kontaktwege zum idealen Partner
Dieses Kapitel behandelt verschiedene Wege zur Suche nach einem geeigneten Kooperationspartner. Es werden sowohl traditionelle Wege als auch moderne Online-Plattformen und -Börsen vorgestellt. Die Besonderheiten und Möglichkeiten jeder Plattform werden im Detail dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen Neugründung, Selbständigkeit, Kooperation, Unternehmenszusammenschlüsse, Wettbewerbsvorteile, Marktbearbeitung, Risikominimierung, Partnerfindung, Kontaktadressen, IHK-Börsen, Business Angels, Technologiebörsen, Existenzgründerbörsen.
Häufig gestellte Fragen
Warum suchen immer mehr Unternehmen nach Kooperationspartnern?
In gesättigten Märkten und bei wachsendem Wettbewerb helfen Kooperationen dabei, Ressourcen zu bündeln, Risiken zu minimieren und Marktvorteile zu erlangen, die ein Unternehmen allein nicht erreichen könnte.
Welche Formen der Kooperation gibt es?
Man unterscheidet nach der verbleibenden Selbständigkeit, den beteiligten Produktionsstufen (horizontal, vertikal) oder den betrieblichen Sektoren (z.B. F&E-Kooperationen).
Wie findet ein Gründer den idealen Partner?
Neben traditionellen Wegen bieten neue Medien effiziente Plattformen wie die IHK-Börsen (Existenzgründer-, Technologie- oder Kooperationsbörsen) sowie Business Angels Foren.
Was ist die Aufgabe einer Kooperationsbörse?
Sie dient als Vermittlungsplattform, auf der Unternehmen anonym oder offen Gesuche und Angebote für Partnerschaften einstellen können, um gezielt Synergien zu finden.
Welche Risiken birgt eine Unternehmenspartnerschaft?
Zu den Risiken zählen der Verlust an Eigenständigkeit, potenzielle Konflikte bei der Entscheidungsfindung und der ungewollte Abfluss von Know-how an den Partner.
- Citar trabajo
- Petra Waidmann (Autor), 2001, Neugründung / Selbständigkeit - die Suche nach einem geeigneten Partner, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35180