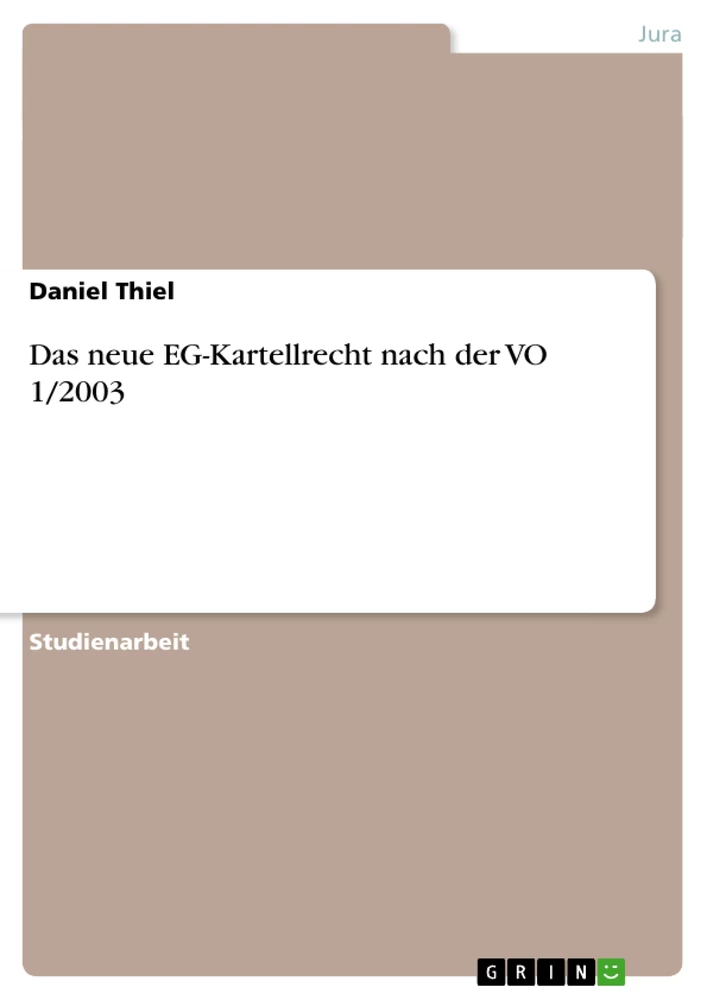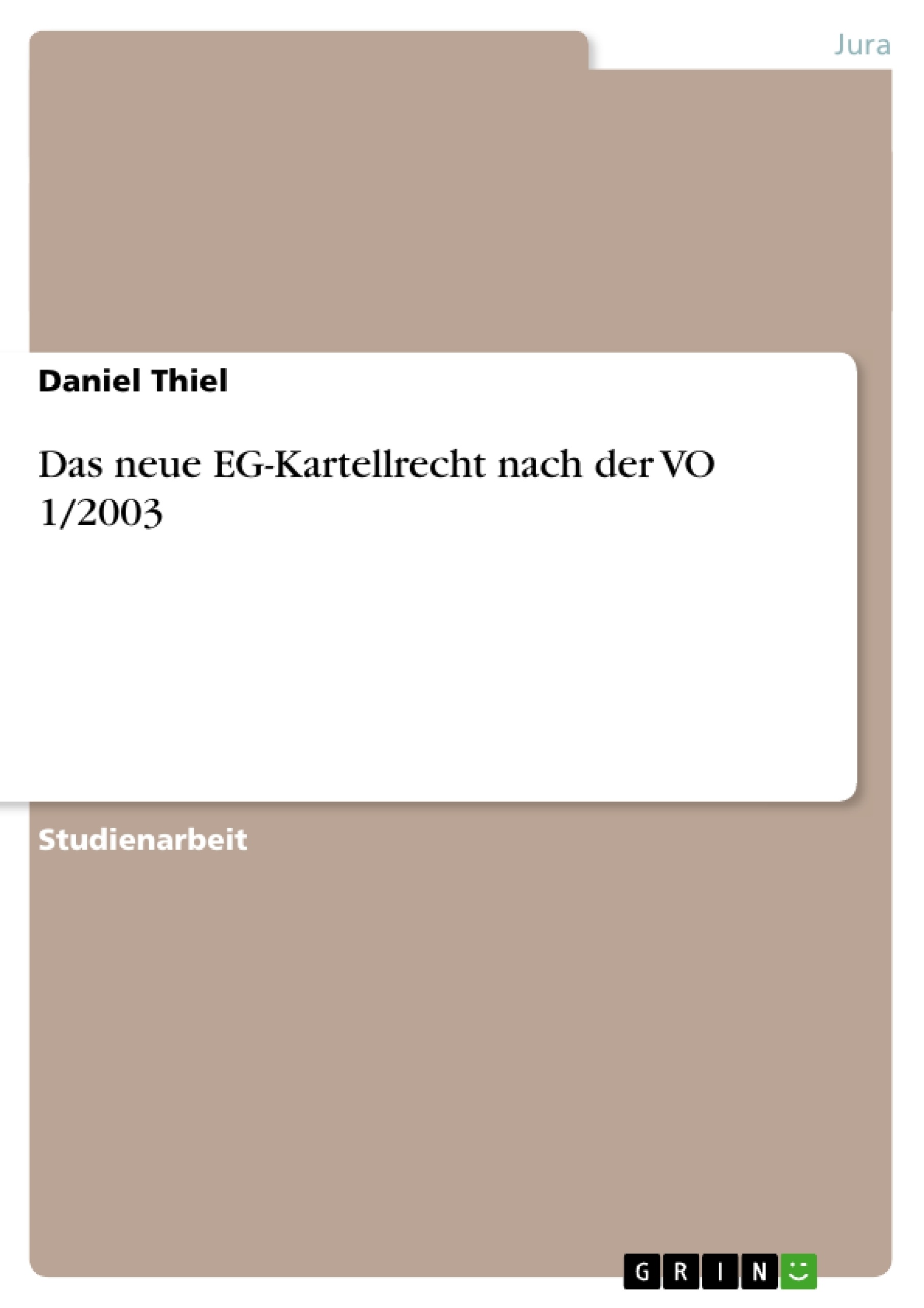Das europäische Kartellrecht ist primärrechtlich auf den Montanunionvertrag
von 1951 zurückzuführen. Bereits in diesem Vertragstext war ein
rudimentäres Kartellrecht vorhanden.
Ein bis heute inhaltlich unverändertes Kartellrecht, wurde im EWGVertrag
von 1957 installiert. Die Art. 85 und 86 EWGV enthielten dabei
kartellrechtliche Regelungen, die unabhängig von amerikanischen Einflüssen
waren.1
Die Kartellgesetzgebung, wie sie heute besteht, setzt sich aus drei Säulen
zusammen.2 Die erste Säule befasst sich mit dem Bereich der wettbewerbsbeschränkenden
Vereinbarungen. Die zweite Säule betrifft den Bereich
des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und die dritte
Säule regelt den Bereich der Fusionskontrolle. Die ersten beiden Säulen
sind in den Art. 81, 82 EGV kodifiziert. Die dritte Säule ist primärrechtlich
nicht geregelt.
Sekundärrechtlich war der Bereich der wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen
bisher grundsätzlich in der Verordnung 17 von 1962 geregelt.
Diese VO 17/62 wurde nun durch die VO 1/2003 ersetzt.
Die Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission begann
die internen Arbeit zur Reform der Verordnung 17/62 Anfang 1997. Im
April 1999 veröffentlichte die Kommission das Weißbuch über die Modernisierung
der Vorschriften zur Anwendung der Art. 81 und 82 EGV.3
Die Kommission veröffentlichte dann im September 2000 einen Verordnungsvorschlag
4 der im wesentlichen vom Rat angenommen wurde. Die
modernisierte Verordnung 17/62 wurde vom Rat am 16. Dezember 2002
als Durchführungsverordnung 1/2003 einstimmig verabschiedet und trat mit dem Beitritt der neuen EU-Mitgliedsstaaten am 01. Mai 2004 gemäß
Art. 45 VO 1/20035 in Kraft.
1 Heinemann, Jura 2003, 649, 649.
2 Heinemann, Jura 2003, 649, 650.
3 KOM (1999) 101 endg., Amtsblatt C 132, S. 1 ff. vom 02.05.1999; im weiteren
Weißbuch genannt.
4 KOM (2000) 582 endg., Amtsblatt C 365, S. 284 ff. vom 19.12.2000; im weiteren
VO-Vorschlag genannt.
5 Alle weiteren Artikel ohne nähere Bezeichnung sind solche der VO 1/2003.
Inhaltsverzeichnis
- A. Entwicklung und Grundlagen des europäischen Kartellrechts
- I. Entwicklung des europäischen Kartellrechts
- II. VO 17/62
- III. Gründe für die Reform
- 1. Schwächen der VO 17/62
- 2. Externe Faktoren
- 3. Änderung des Wettbewerbsverständnisses
- IV. Tatbestandsvoraussetzungen Art. 81 I EGV
- 1. Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen
- 2. Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte Verhaltensweisen
- 3. Zwischenstaatlichkeitsklausel
- B. VO 1/2003
- I. System der Legalausnahme Art. 1
- 1. Gruppenfreistellungsverordnungen unter der VO 1/2003
- 2. Ist die VO 1/2003 europarechtswidrig?
- a) Änderung des EGV?
- b) Ist Art. 81 III EGV unmittelbar anwendbar?
- 3. zu erwartende Folgen in der Praxis
- II. Beweislastverteilung Art. 2
- III. Verhältnis zum nationalen Wettbewerbsrecht Art. 3
- IV. Dezentralisierung
- V. Entscheidungsbefugnisse
- 1. einstweilige Maßnahmen Art. 8
- 2. Verpflichtungszusage Art. 9
- 3. Feststellung der Nichtanwendbarkeit Art. 10
- VI. Ermittlungs- und Sanktionsbefugnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Neuerungen des EG-Kartellrechts nach der Verordnung 1/2003. Ziel ist es, die Entwicklung des europäischen Kartellrechts nachzuzeichnen, die Gründe für die Reform der VO 17/62 zu beleuchten und die wichtigsten Aspekte der neuen Verordnung 1/2003 zu erläutern. Im Fokus stehen dabei die Auswirkungen der Dezentralisierung, die geänderte Beweislastverteilung und das Verhältnis zum nationalen Wettbewerbsrecht.
- Entwicklung des europäischen Kartellrechts
- Gründe für die Reform der VO 17/62
- Schlüsselmerkmale der VO 1/2003
- Dezentralisierung im EG-Kartellrecht
- Verhältnis zwischen nationalem und europäischem Wettbewerbsrecht
Zusammenfassung der Kapitel
A. Entwicklung und Grundlagen des europäischen Kartellrechts: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung des europäischen Kartellrechts, beginnend mit der Entstehung der ersten Verordnung bis hin zu den Gründen für die notwendige Reform. Es werden die Schwächen der alten Verordnung (VO 17/62) aufgezeigt und die externen Faktoren, die zu einer Änderung des Wettbewerbsverständnisses geführt haben, detailliert analysiert. Der Abschnitt über die Tatbestandsvoraussetzungen von Artikel 81 I EGV legt die Grundlagen für das Verständnis der folgenden Kapitel. Die Darstellung der historischen Entwicklung dient als notwendige Basis für die Analyse der Neuerungen in VO 1/2003.
B. VO 1/2003: Dieses Kapitel widmet sich der neuen Verordnung 1/2003 im Detail. Es analysiert das System der Legalausnahme nach Artikel 1, einschließlich der Auswirkungen auf Gruppenfreistellungsverordnungen und die Frage der Europarechtswidrigkeit. Die Diskussion über die Beweislastverteilung (Artikel 2) und das Verhältnis zum nationalen Wettbewerbsrecht (Artikel 3) bilden den Kern dieses Abschnitts. Die Folgen der Dezentralisierung, die Entscheidungsbefugnisse der Kommission und die Ermittlungs- und Sanktionsbefugnisse werden ebenfalls umfassend behandelt. Der gesamte Abschnitt präsentiert eine tiefgreifende Analyse der zentralen Aspekte der Verordnung und ihren praktischen Implikationen.
Schlüsselwörter
EG-Kartellrecht, Verordnung 1/2003, VO 17/62, Dezentralisierung, Beweislastverteilung, nationales Wettbewerbsrecht, Gruppenfreistellungsverordnungen, Artikel 81 EGV, Wettbewerbsverständnis, Europäische Kommission, nationale Wettbewerbsbehörden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des EG-Kartellrechts nach Verordnung 1/2003
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Neuerungen des europäischen Kartellrechts nach der Verordnung (VO) 1/2003. Sie verfolgt die Entwicklung des europäischen Kartellrechts, untersucht die Gründe für die Reform der vorherigen Verordnung (VO 17/62) und erläutert die wichtigsten Aspekte der VO 1/2003. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen der Dezentralisierung, der geänderten Beweislastverteilung und dem Verhältnis zum nationalen Wettbewerbsrecht.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des europäischen Kartellrechts von der VO 17/62 bis zur VO 1/2003. Sie analysiert die Schwächen der VO 17/62 und die externen Faktoren, die zur Reform führten. Ein Schwerpunkt liegt auf den Schlüsselmerkmalen der VO 1/2003, insbesondere der Dezentralisierung, der Beweislastverteilung und dem Verhältnis zum nationalen Wettbewerbsrecht. Die Entscheidungsbefugnisse der Kommission, einschließlich einstweiliger Maßnahmen, Verpflichtungszusagen und Feststellungen der Nichtanwendbarkeit, werden ebenso behandelt wie die Ermittlungs- und Sanktionsbefugnisse.
Welche Struktur hat die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile: Teil A befasst sich mit der Entwicklung und den Grundlagen des europäischen Kartellrechts, inklusive der Tatbestandsvoraussetzungen von Artikel 81 I EGV. Teil B analysiert detailliert die VO 1/2003, einschließlich des Systems der Legalausnahme (Art. 1), der Beweislastverteilung (Art. 2), des Verhältnisses zum nationalen Wettbewerbsrecht (Art. 3) und der Dezentralisierung. Die Arbeit enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Warum wurde die VO 17/62 reformiert?
Die Reform der VO 17/62 wurde durch verschiedene Faktoren bedingt, darunter die Schwächen der alten Verordnung selbst, externe Einflüsse und eine veränderte Auffassung vom Wettbewerb. Die Arbeit geht detailliert auf diese Gründe ein.
Welche Auswirkungen hat die Dezentralisierung im EG-Kartellrecht?
Die Dezentralisierung ist ein zentrales Thema der VO 1/2003. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen dieser Dezentralisierung auf die Entscheidungsbefugnisse, die Ermittlungs- und Sanktionsbefugnisse sowie das Verhältnis zum nationalen Wettbewerbsrecht.
Wie verändert sich die Beweislastverteilung durch die VO 1/2003?
Die VO 1/2003 regelt die Beweislastverteilung neu (Art. 2). Die Arbeit analysiert diese Änderungen und deren praktische Bedeutung.
Welches Verhältnis besteht zwischen nationalem und europäischem Wettbewerbsrecht?
Die Arbeit untersucht das komplexe Verhältnis zwischen nationalem und europäischem Wettbewerbsrecht im Kontext der VO 1/2003 (Art. 3) und die Auswirkungen der Dezentralisierung auf dieses Verhältnis.
Welche Rolle spielen Gruppenfreistellungsverordnungen?
Die Arbeit diskutiert die Rolle von Gruppenfreistellungsverordnungen im System der Legalausnahme nach Artikel 1 der VO 1/2003.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: EG-Kartellrecht, Verordnung 1/2003, VO 17/62, Dezentralisierung, Beweislastverteilung, nationales Wettbewerbsrecht, Gruppenfreistellungsverordnungen, Artikel 81 EGV, Wettbewerbsverständnis, Europäische Kommission, nationale Wettbewerbsbehörden.
- Quote paper
- Daniel Thiel (Author), 2005, Das neue EG-Kartellrecht nach der VO 1/2003, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35182