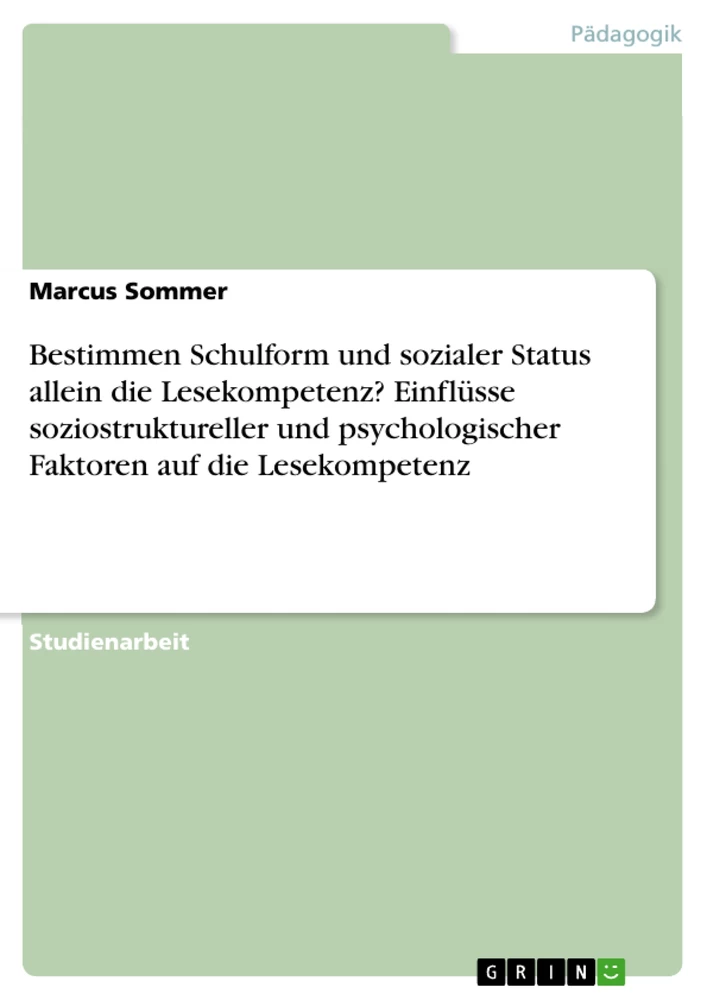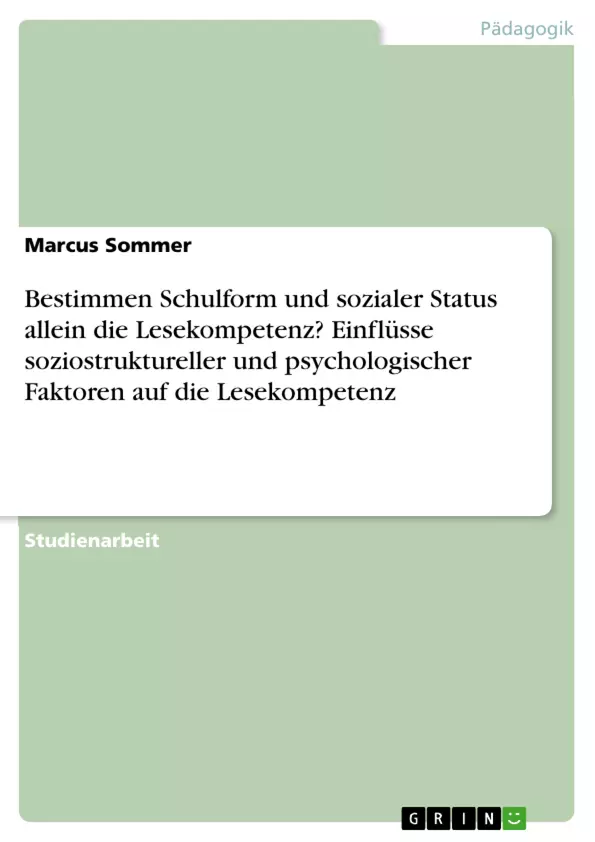Eine hohe Lesekompetenz wird als eine der zentralen Schlüsselqualifikationen angesehen, die eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben gewährleistet. Folglich ist eine geringe Lesefähigkeit demnach mit etlichen Risiken verbunden und birgt einen enormen Chancennachteil für die Betroffenen. Unter dem Begriff Lesekompetenz wird nach der PISA-Definition mehr verstanden, als einfach nur „lesen“ zu können. Demnach umfasst die internationale Konzeption zur Lesekompetenz das Verstehen, die zielgerichtete Informationsentnahme und Reflektion und Bewertung von lebenspraktisch relevantem Textmaterial.
Dabei sind die Ergebnisse zur Lesekompetenz deutscher Schüler zu Beginn der PISA-Erhebungen im Jahr 2001 niederschmetternd gewesen. So haben 21 % der 15-Jährigen nicht die Kompetenzstufe II (von insgesamt fünf Stufen) erreicht. Über ein Fünftel der deutschen Schülerinnen und Schüler besitzt bzw. besaß also nicht die Fähigkeit, zumindest einfache Verknüpfungen in Texten herzustellen. Diese Ergebnisse haben sich im Lauf der vergangenen Jahre verbessert und deutsche Schülerinnen und Schüler konnten im Laufe der folgenden PISA-Erhebungswellen deutliche Zuwächse in der Lesekompetenz verzeichnen.
Im Folgenden soll den Fragen nachgegangen werden, ob sich die aufgeführten Befunde auch für die Ergebnisse aus dem vorliegenden PISA-Daten-Output aus der ersten Erhebungswelle aus dem Jahr 2000 für das Land Brandenburg rekonstruieren lassen. Im Fokus stehen dabei vor allem die Fragen, ob sich der Einfluss sozialstruktureller Merkmale replizieren lässt, über die sozialstrukturellen Merkmale hinaus auch psychologische Merkmale Einfluss auf die Vorhersage der Lesekompetenz haben und diese Effekte geschlechtsunabhängig sind. In einer Nebenfragestellung soll zusätzlich der Frage nachgegangen werden, ob sich diese Effekte auch auf andere schulische Kompetenzen übertragen lassen. Dies soll exemplarisch am Beispiel der mathematischen Kompetenz getan werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und theoretischer Hintergrund
- Hypothesen
- Methoden
- Beschreibung des Datensatzes und der Stichprobe
- Datenanalyse
- Ergebnisse
- Diskussion der Ergebnisse
- Referenzen
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von soziostrukturellen und psychologischen Faktoren auf die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern. Sie analysiert PISA-Daten aus der ersten Erhebungswelle im Jahr 2000 für das Land Brandenburg und prüft, ob sich die Ergebnisse vorheriger Studien replizieren lassen.
- Replizierung des Einflusses von sozialstrukturellen Merkmalen auf die Lesekompetenz
- Untersuchung, ob psychologische Merkmale zusätzlich zu den soziostrukturellen Merkmalen die Lesekompetenz beeinflussen
- Prüfung der Geschlechtsunabhängigkeit der Effekte von sozialstrukturellen und psychologischen Faktoren auf die Lesekompetenz
- Analyse, ob sich die Effekte auf andere schulische Kompetenzen, wie beispielsweise die mathematische Kompetenz, übertragen lassen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den theoretischen Hintergrund der Arbeit dar und erklärt die Bedeutung der Lesekompetenz als Schlüsselqualifikation. Sie beleuchtet die Ergebnisse früherer PISA-Studien, die auf einen starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Lesekompetenz hinweisen. Das Kapitel "Methoden" beschreibt die verwendeten Daten und die angewendete Analysemethode.
Die Ergebnisse der Untersuchung werden im gleichnamigen Kapitel präsentiert. Die Diskussion der Ergebnisse befasst sich mit den gewonnenen Erkenntnissen und setzt diese in Beziehung zu den bestehenden Forschungsbefunden. Die Arbeit schließt mit einem Literaturverzeichnis und einem Anhang.
Schlüsselwörter
Lesekompetenz, PISA, soziostrukturelle Faktoren, psychologischer Einfluss, sozialer Status, Schulform, Selbstkonzept, Anstrengungsbereitschaft, kooperatives Lernen, Brandenburg
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat der soziale Status auf die Lesekompetenz?
PISA-Studien zeigen einen starken Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und der Lesefähigkeit, was zu erheblichen Chancennachteilen für benachteiligte Kinder führt.
Spielen psychologische Faktoren eine zusätzliche Rolle?
Ja, Merkmale wie das Selbstkonzept, die Anstrengungsbereitschaft und die Motivation beeinflussen die Lesekompetenz über den soziostrukturellen Status hinaus.
Sind die Effekte der Lesekompetenz geschlechtsabhängig?
Die Arbeit prüft, ob Jungen und Mädchen unterschiedlich stark von soziostrukturellen und psychologischen Faktoren in ihrer Leseleistung beeinflusst werden.
Was versteht PISA unter „Lesekompetenz“?
Es umfasst mehr als reines Vorlesen: Verstehen, zielgerichtete Informationsentnahme sowie die Reflexion und Bewertung von Texten.
Lassen sich diese Effekte auch auf Mathematik übertragen?
Die Arbeit untersucht exemplarisch, ob soziostrukturelle Merkmale einen ähnlich starken Einfluss auf die mathematische Kompetenz haben wie auf die Lesekompetenz.
Welche Bedeutung hat das kooperative Lernen für die Kompetenz?
Kooperatives Lernen gilt als ein psychologisch-didaktischer Faktor, der die Lesekompetenz durch sozialen Austausch und gegenseitige Unterstützung fördern kann.
- Quote paper
- Marcus Sommer (Author), 2015, Bestimmen Schulform und sozialer Status allein die Lesekompetenz? Einflüsse soziostruktureller und psychologischer Faktoren auf die Lesekompetenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352032