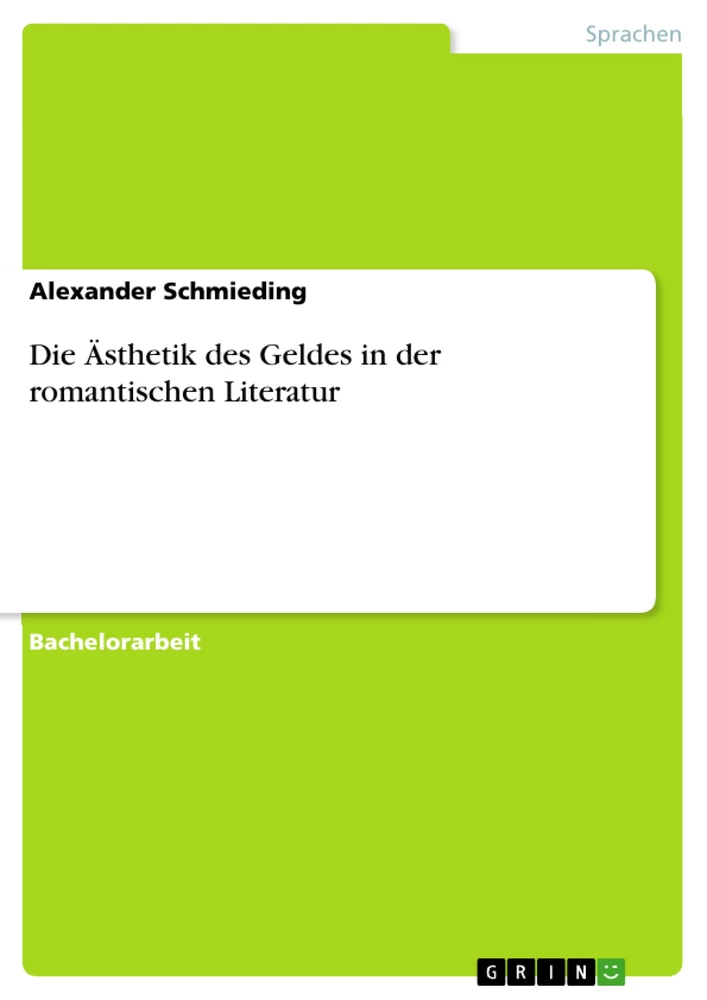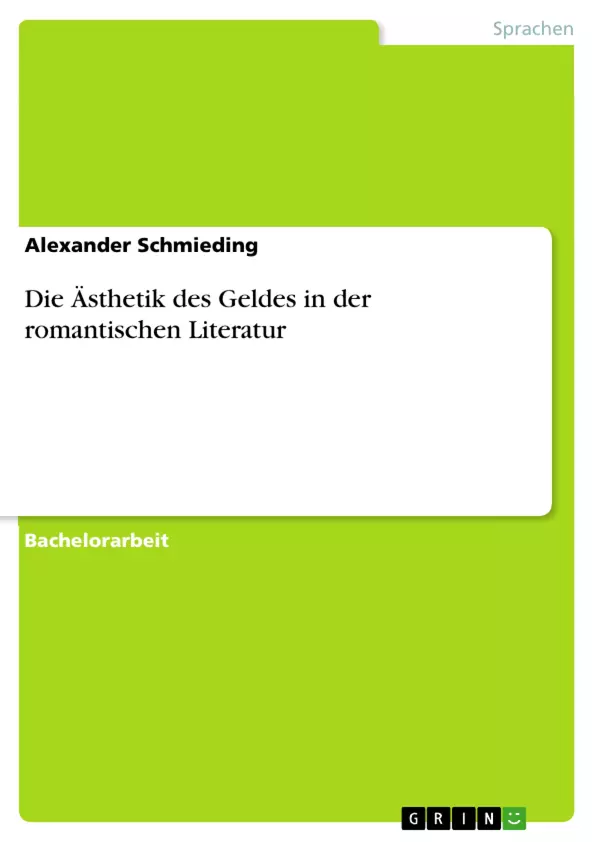Ich möchte in dieser Arbeit auf die Multimodalität und Ästhetizität von Geld eingehen. Dabei wird das Verhältnis zwischen ökonomischem und ästhetischem Wert Gegenstand der Arbeit sein.
Ich werde die phantastischen Texte der Romantik zur Kapitalismuskritik mit aktuellen kulturkritischen Aufsätzen von Philosophen, Soziologen und Ökonomen in Bezug setzen, um somit das genannte Verhältnis plastischer zu machen. Mein Forschungsinteresse liegt darin begründet Parallelen zu finden zwischen den frühen Formen der Kapitalakkumulation und dem Selbstverständnis des Künstlers mit Blick auf sein Verhältnis zur Gesellschaft.
Welche funktionalen Äquivalenzen gibt es z.B. im Umgang mit Geld und im Umgang mit Kunst? Ist ein Kapitalist nicht auch eine Art Künstler, der seine Arbeit inszeniert? Er arbeitet nicht wirklich, sondern lässt das Geld in Form von Zinsgewinnen arbeiten. Somit wird das Geld zum alleinigen Selbstzweck, vereint Wirk und Zweckursache in sich. In der Hinsicht gleicht es der Kunst, die sich allerdings auch nur solange selbst genügt, bis sie von ihrem Schöpfer in einer finanziellen Notlage veräußert wird und somit wieder in den Wertwechselstrom1 der Wirtschaft integriert wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 EINLEITUNG.
- 2.0 ÄSTHETIK DES GELDES
- 2.1. ROMANTISCHE THEORIE IM HISTORISCHE KONTEXT
- 2.1.1. Frühromantik.
- 2.1.2. Hochromantik.
- 2.1.3. Spätromantik.
- 2.2. GELDTHEORIE
- 2.2.1 Pro und Contra einer Geldgesellschaft.
- 2.2.2 Was macht die Faszination von Geld aus
- 2.2.3 Geld als Ersatzreligion
- 2.3. PROGRAMMATISCHE LITERATUR.
- 2.3.1. DER RUNENBERG VON LUDWIG TIECK (1804).
- 2.3.1.1. Etymologische Begriffsanalyse ....
- 2.3.1.2. Äquivalenzen zwischen Geld und Kunst.
- 2.3.2. DIE BERGWERKE ZU FALUN VON E.T.A HOFFMANN (1819).
- 2.3.2.1. Analyse des Begriffes Vitriol.
- 2.3.2.2. Geld als modernes Kunstwerk und seine Inkompatibilität zur Gesellschaft
- 2.3.3. DAS KALTE HERZ VON WILHELM HAUFF (1827).
- 2.3.3.1. Die moralisierende Abkehr von dem monetären Kunstideal
- 2.3.3.2. Der Holländer - Michel und die Funktionsweise seiner unlauteren Geschäftspraktiken………………………………..
- Funktionalen Äquivalenzen zwischen Geld und Kunst.
- Der Kapitalist als Künstler, der seine Arbeit inszeniert.
- Geld als Selbstzweck, vereint Wirk und Zweckursache.
- Kunst als Selbstzweck, bis sie in der finanziellen Notlage des Künstlers veräußert wird.
- Ästhetik des Geldes in der romantischen Literatur.
- Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Verhältnis zwischen ökonomischem und ästhetischem Wert im Kontext romantischer Literatur.
- Kapitel 2.0 analysiert die Ästhetik des Geldes, indem es zunächst die romantische Theorie im historischen Kontext betrachtet und verschiedene Stadien der Romantik (Frühromantik, Hochromantik, Spätromantik) unterscheidet.
- Kapitel 2.1.1. beleuchtet die Frühromantik und ihre Verbindung zur französischen Revolution.
- Kapitel 2.2. untersucht die Geldtheorie und die Faszination von Geld, sowie die Frage nach einer Geldgesellschaft.
- Kapitel 2.3. präsentiert programmatische Literatur der Romantik, die sich mit der Ästhetik des Geldes auseinandersetzt, darunter Ludwig Tiecks „Der Runenberg“ und E.T.A. Hoffmanns „Die Bergwerke zu Falun“.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Multimodalität und Ästhetizität von Geld und untersucht das Verhältnis zwischen ökonomischem und ästhetischem Wert. Die phantastischen Texte der Romantik werden zur Kapitalismuskritik genutzt und mit aktuellen kulturkritischen Aufsätzen von Philosophen, Soziologen und Ökonomen in Bezug gesetzt, um dieses Verhältnis zu verdeutlichen. Die Arbeit analysiert Parallelen zwischen frühen Formen der Kapitalakkumulation und dem Selbstverständnis des Künstlers im Verhältnis zur Gesellschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Ästhetik des Geldes, der romantischen Literatur, der Kapitalismuskritik, der Kunst und der Funktionsweise von Geld in der Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Geld in der romantischen Literatur dargestellt?
Geld wird oft als ästhetisches Phänomen und Selbstzweck dargestellt, das Parallelen zum Selbstverständnis des Künstlers aufweist.
Welche Werke werden in der Arbeit analysiert?
Untersucht werden Ludwig Tiecks „Der Runenberg“, E.T.A. Hoffmanns „Die Bergwerke zu Falun“ und Wilhelm Hauffs „Das kalte Herz“.
Inwiefern ähnelt ein Kapitalist einem Künstler?
Die Arbeit stellt die These auf, dass der Kapitalist seine Arbeit inszeniert und das Geld – ähnlich wie die Kunst – zum alleinigen Selbstzweck erhebt.
Was ist unter der „Ästhetik des Geldes“ zu verstehen?
Es beschreibt das Verhältnis zwischen ökonomischem Nutzwert und der faszinierenden, fast religiösen Ausstrahlung von Reichtum in der Kultur.
Welche Rolle spielt die Kapitalismuskritik in der Romantik?
Phantastische Texte der Romantik nutzen oft übernatürliche Elemente, um die moralischen Folgen der frühen Kapitalakkumulation zu kritisieren.
- Citation du texte
- Alexander Schmieding (Auteur), 2011, Die Ästhetik des Geldes in der romantischen Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352082