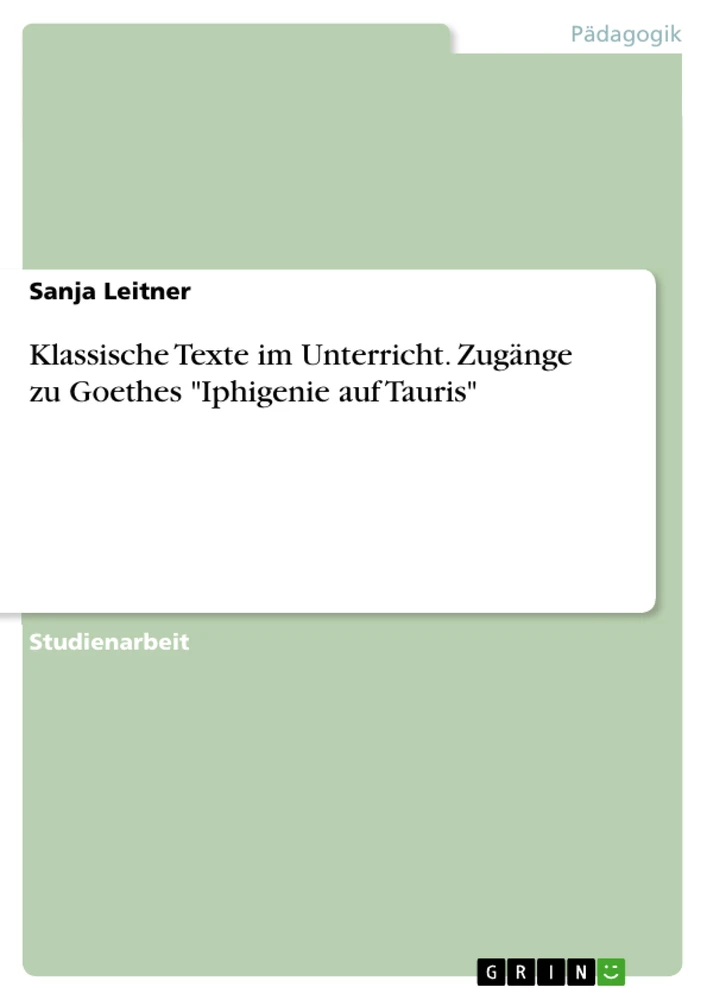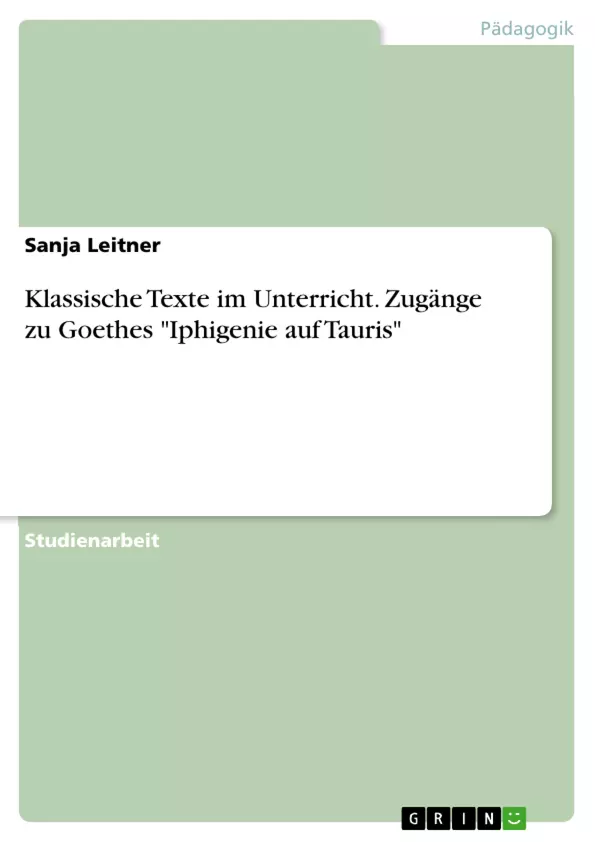Klassischen Texten eilt der Ruf voraus, sie seien besonders schwierig geschrieben und für unsere heutige Gesellschaft nicht mehr so leicht zu verstehen. Diese Vorurteile gegenüber klassischer Literatur stellen ein großes Problem für den Unterricht dar, weil die Motivation für das Lesen noch mehr sinkt und viele SchülerInnen einem Klassiker gar nicht die Chance geben wollen, sich auf ihn einzulassen. Gerade diesem Fehlglauben gilt es entgegenzutreten; diesem Problem müssen sich Lehrpersonen nun stellen. Dazu ist es notwendig, die Vorurteile der SchülerInnen weitgehend abzubauen und ihr Bewusstsein dafür zu schärfen, dass klassische Literatur nicht automatisch mit „langweilig“ und „schwierig“ assoziiert werden kann.
Damit dies gelingen kann, muss man eine Zugangsweise zur Literatur finden, die für SchülerInnen verständlich ist. Das Ziel, den SchülerInnen klassische Literatur (oder auch Literatur generell) auf eine Weise näherzubringen, die sie verstehen und die ihr Interesse wecken könnte, sollte bei DeutschlehrerInnen heutzutage höchste Priorität haben. In der Praxis ist dies jedoch oft nicht der Fall; möglicherweise weil das WIE nicht bekannt ist.
Daher möchten wir unsere Arbeit diesem Thema widmen und Lösungsvorschläge anbieten, wie man mit SchülerInnen effizient an einen klassischen Text herangeht. Wir haben dafür Goethes Drama „Iphigenie auf Tauris“ gewählt, da es sich hierbei um einen sehr bedeutenden Text handelt, welcher jedoch auf den ersten Blick aufgrund seiner Sprache für SchülerInnen abschreckend wirken könnte. Dennoch sind wir überzeugt, dass er das Potential besitzt, auch junge Leute begeistern zu können – sofern man ihnen den richtigen Zugang anbietet. Unser Ziel ist es, Zugangsweisen aufzuzeigen, mit denen man den SchülerInnnen diesen klassischen Text auf eine ihnen verständliche Weise näherbringen kann. Dazu haben wir zentrale Themen aus dem Text ausgewählt, die das Interesse der SchülerInnen wecken könnten. Des Weiteren möchten wir konkrete Möglichkeiten vorstellen, wie man mit dem Text arbeiten kann. Denn ein guter Deutschunterricht sollte nicht nur zum Lesen anregen sondern auch die Gelegenheit bieten, einen Text in angemessener Weise zu reflektieren und sich weiterführend mit ihm auseinanderzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorüberlegungen
- 3. Die Mythologie
- 3.1. Der Tantalidenfluch als Einstieg
- 3.2. Antikes Vorbild und Änderungen durch Goethe
- 4. Themen bzw. Zugänge
- 4.1. Der Tantalidenfluch
- 4.2. Die Rolle der Frau
- 4.3. Menschenopfer
- 4.4. Iphigenies Konflikt
- 5. Konkrete Arbeitsaufgaben
- 5.1. Arbeitsaufgaben zu Textstellen
- 5.2. Schreibaufgaben
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Herausforderungen und Möglichkeiten, Goethes „Iphigenie auf Tauris“ im Schulunterricht effektiv zu vermitteln. Sie zielt darauf ab, Vorurteile gegenüber klassischer Literatur bei Jugendlichen abzubauen und ansprechende Zugangsweisen aufzuzeigen. Konkrete Arbeitsmethoden und Aufgaben werden vorgestellt, um ein tiefergehendes Verständnis und Interesse an dem Werk zu fördern.
- Überwindung von Vorurteilen gegenüber klassischer Literatur
- Entwicklung geeigneter Zugangsweisen für Schüler
- Konkrete Arbeitsaufgaben zur Textanalyse und -reflexion
- Die Relevanz antiker Mythen im Kontext des Dramas
- Die Rolle von Frauen in Goethes Werk
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung thematisiert die verbreitete Abneigung von Jugendlichen gegenüber klassischer Literatur, insbesondere Goethes Werken. Sie argumentiert, dass diese Ablehnung oft auf Vorurteilen über Schwierigkeit und mangelnde Relevanz beruht. Das Hauptziel der Arbeit ist es, Methoden zu entwickeln, um „Iphigenie auf Tauris“ für Schüler verständlich und ansprechend zu gestalten und ihnen so den Zugang zu klassischer Literatur zu erleichtern. Der Fokus liegt auf der Auswahl relevanter Themen und der Entwicklung konkreter Arbeitsaufgaben für den Unterricht.
2. Vorüberlegungen: Dieses Kapitel vergleicht die Alltagssprache mit der literarischen Sprache und hebt die damit verbundenen Schwierigkeiten für Schüler hervor. Es kritisiert traditionelle Unterrichtsmethoden wie das reine Vorlesen von Texten und plädiert für modernere Ansätze, die das Textverständnis durch aktive Beteiligung und Hilfestellungen fördern. Die zentrale Frage, ob der gesamte Text oder nur Auszüge gelesen werden sollen, wird diskutiert. Die Vorteile des vollständigen Lesens werden gegen den Zeitdruck im Schulalltag abgewogen, wobei die Methode des textnahen Lesens als Kompromiss vorgeschlagen wird.
Schlüsselwörter
Iphigenie auf Tauris, Goethe, Klassische Literatur, Deutschunterricht, Didaktik, Textverständnis, Schülermotivation, Arbeitsaufgaben, Antike Mythologie, Frauenrolle.
Goethes "Iphigenie auf Tauris": Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich mit der didaktischen Herausforderung, Goethes "Iphigenie auf Tauris" im Schulunterricht effektiv zu vermitteln. Sie untersucht, wie Vorurteile gegenüber klassischer Literatur abgebaut und ansprechende Zugangsweisen für Schüler entwickelt werden können. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung konkreter Arbeitsmethoden und Aufgaben zur Förderung des Textverständnisses und des Interesses am Werk.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Themen, darunter die Überwindung von Vorurteilen gegenüber klassischer Literatur, die Entwicklung geeigneter Zugangsweisen für Schüler, die Relevanz antiker Mythen im Kontext des Dramas, die Rolle von Frauen in Goethes Werk und die Erstellung konkreter Arbeitsaufgaben zur Textanalyse und -reflexion. Die Mythologie, insbesondere der Tantalidenfluch, sowie Iphigenies Konflikt und die Rolle der Frau im Drama werden detailliert untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Vorüberlegungen, Die Mythologie (mit den Unterkapiteln "Der Tantalidenfluch als Einstieg" und "Antikes Vorbild und Änderungen durch Goethe"), Themen bzw. Zugänge (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Aspekten des Dramas), Konkrete Arbeitsaufgaben (mit Unterkapiteln zu Aufgaben zu Textstellen und Schreibaufgaben) und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel näher erläutert.
Wie werden Vorurteile gegenüber klassischer Literatur adressiert?
Die Arbeit adressiert die verbreitete Abneigung von Jugendlichen gegenüber klassischer Literatur, indem sie moderne und ansprechende Zugangsweisen zum Text vorschlägt. Sie kritisiert traditionelle Unterrichtsmethoden und plädiert für aktive Beteiligung der Schüler und Hilfestellungen beim Textverständnis. Die Auswahl relevanter Themen und die Entwicklung konkreter, praxisorientierter Arbeitsaufgaben sollen das Interesse der Schüler wecken und das Textverständnis fördern.
Welche konkreten Arbeitsaufgaben werden vorgestellt?
Die Seminararbeit präsentiert konkrete Arbeitsaufgaben, die auf die Textanalyse und -reflexion abzielen. Es werden sowohl Aufgaben zu spezifischen Textstellen als auch Schreibaufgaben vorgeschlagen, um das Verständnis und die Auseinandersetzung mit dem Werk zu vertiefen. Diese Aufgaben sollen die Schüler aktiv in den Lernprozess einbinden und ihnen ermöglichen, das Drama auf unterschiedlichen Ebenen zu erschließen.
Wie wird der Umgang mit der Sprache in der Seminararbeit betrachtet?
Die Seminararbeit vergleicht die Alltagssprache mit der literarischen Sprache und thematisiert die damit verbundenen Schwierigkeiten für Schüler. Sie diskutiert die Frage, ob der gesamte Text oder nur Auszüge gelesen werden sollen, und schlägt den textnahen Lesens als Kompromiss zwischen vollständigem Textverständnis und dem Zeitdruck im Schulalltag vor.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Seminararbeit prägnant beschreiben, sind: Iphigenie auf Tauris, Goethe, Klassische Literatur, Deutschunterricht, Didaktik, Textverständnis, Schülermotivation, Arbeitsaufgaben, Antike Mythologie, Frauenrolle.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Zielsetzung der Seminararbeit ist die Entwicklung von effektiven Unterrichtsmethoden für Goethes "Iphigenie auf Tauris", die Vorurteile gegenüber klassischer Literatur abbauen und das Interesse der Schüler wecken. Sie möchte geeignete Zugangsweisen für Schüler entwickeln und konkrete Arbeitsaufgaben zur Textanalyse und -reflexion vorstellen, um ein tiefergehendes Verständnis und Interesse an dem Werk zu fördern.
- Quote paper
- Sanja Leitner (Author), 2015, Klassische Texte im Unterricht. Zugänge zu Goethes "Iphigenie auf Tauris", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352121