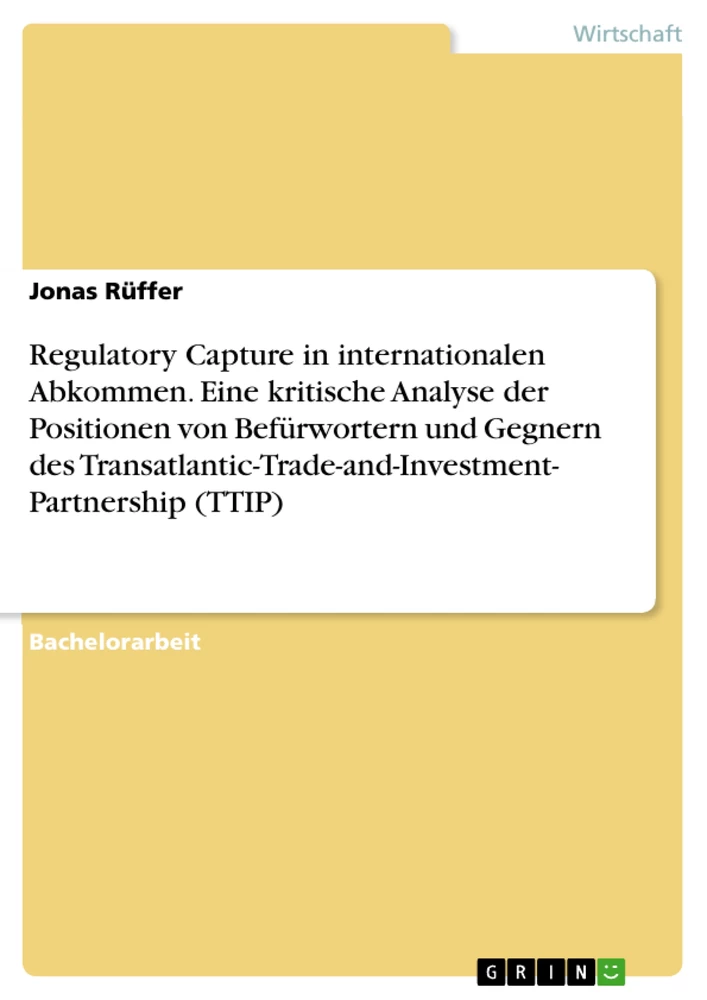Im Zuge dieser Bachelorarbeit soll die Diskussion um das Abkommen vor dem Hintergrund des Regulatory Capture untersucht werden. Ziel ist eine kritische Analyse der Organisationen der Befürworter und Gegner des Freihandelsabkommens unter dem Gesichtspunkt des indirekten, legalen Regulatory Capture, dem Lobbyismus. Bei der kritischen Analyse wird der Hintergrund der zu untersuchenden Organisationen vor der "Revolving-Doors- Theorie" betrachtet. Untersucht werden dabei die Positionen zum Investitionsschutz und zur Standardangleichung.
Das Ergebnis dieser Arbeit soll zur Beantwortung folgender Fragestellung führen: Haben wirtschaftlich orientierte Organisationen eine größere Nähe zur Politik als Verbraucherschutzorganisationen? Haben Wirtschaftsverbände, -vereinigungen, -organisationen aufgrund einer größeren Nähe mehr Einfluss auf die TTIP-Verhandlungen als Verbraucherschutzorganisationen?
Ziel dieser Arbeit ist es nicht, ein Pro- oder Contra-Ergebnis für das TTIP zu erhalten. Die politischen Diskussionen bieten Anlass genug, sich eine Meinung zu bilden. Die Positionen der Organisationen, zutreffend oder nicht, sollen vor dem Hintergrund der Organisation als solcher und ihrer Aufgabe als Interessensvertretung analysiert werden. Auch gäbe es wesentlich mehr Gesichtspunkte zu untersuchen, dazu zählen zum Beispiel die Transparenz der Verhandlungen, die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen des Abkommens und der Zusammenhang zwischen TTIP auf der einen Seite und CETA, TPP und TISA auf der anderen. Diese Punkte werden in dieser Arbeit aufgrund der Maximalbegrenzung der Seitenanzahl nicht behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie - Regulatory Capture
- Klassische Theorie
- Korruption
- Revolving-Doors
- Lobbyismus
- Angleichung von Standards
- Investitionsschutz
- Analyse der Organisationen
- VDA
- foodwatch
- BDI
- BUND
- Transatlantic Business Council
- "Stop TTIP"
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert kritisch die Positionen von Befürwortern und Gegnern des Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)-Abkommens. Ziel ist es, das Phänomen des Regulatory Capture im Kontext des TTIP zu untersuchen und zu beleuchten, wie verschiedene Organisationen dieses Abkommen wahrnehmen und beeinflussen.
- Regulatory Capture im Kontext des TTIP
- Analyse der Positionen verschiedener Interessengruppen (z.B. VDA, foodwatch, BDI)
- Bewertung der Auswirkungen des TTIP auf Standards und Investitionsschutz
- Rolle von Lobbyismus im TTIP-Prozess
- Harmonisierung von Standards und deren potenzielle Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema TTIP ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Positionen von Befürwortern und Gegnern des Abkommens dar. Sie beschreibt das Abkommen, seine Ziele und den aktuellen Verhandlungsstand, unterstreicht dabei die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Ratifizierungsprozesse auf nationaler Ebene. Die Einleitung erwähnt auch widersprüchliche öffentliche Äußerungen von führenden Politikern zu den Standards, die durch das Abkommen beeinflusst werden könnten. Diese Diskrepanz in den Aussagen unterstreicht die Komplexität und den Konfliktpotential des Themas.
Theorie - Regulatory Capture: Dieses Kapitel liefert einen theoretischen Rahmen für die Analyse des TTIP. Es beschreibt verschiedene Aspekte von Regulatory Capture, darunter die klassische Theorie, Korruption, "Revolving Doors"-Phänomene, Lobbyismus, die Angleichung von Standards und den Investitionsschutz. Jeder dieser Punkte wird detailliert erläutert und seine Relevanz für die spätere Analyse der Positionen verschiedener Organisationen im Kontext des TTIP-Abkommens begründet. Der Abschnitt legt die Grundlage für das Verständnis der Mechanismen, durch welche Interessengruppen die Regulierung beeinflussen können.
Analyse der Organisationen: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Analyse der Positionen verschiedener Organisationen bezüglich des TTIP-Abkommens. Es untersucht die Standpunkte des VDA (Verband der Automobilindustrie), foodwatch, des BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie), des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland), des Transatlantic Business Council und der "Stop TTIP"-Bewegung. Für jede Organisation wird ihre Haltung zur Harmonisierung von Standards, zum Investitionsschutz und zur Rolle des Lobbyismus im TTIP-Prozess ausführlich beschrieben und analysiert. Die Unterschiede in den Ansichten und die zugrunde liegenden Interessen werden herausgearbeitet, um ein umfassendes Bild der verschiedenen Perspektiven auf das Abkommen zu zeichnen. Die Analyse vergleicht und kontrastiert die Strategien der einzelnen Organisationen in Bezug auf die Einflussnahme auf den politischen Prozess.
Schlüsselwörter
TTIP, Regulatory Capture, Lobbyismus, Harmonisierung von Standards, Investitionsschutz, Freihandelsabkommen, Interessengruppen, VDA, foodwatch, BDI, BUND, "Stop TTIP", EU, USA.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Analyse des TTIP-Abkommens im Kontext von Regulatory Capture
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit analysiert kritisch die Positionen von Befürwortern und Gegnern des Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)-Abkommens. Der Fokus liegt auf dem Phänomen des Regulatory Capture und wie verschiedene Organisationen das Abkommen wahrnehmen und beeinflussen.
Welche Organisationen werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert die Positionen des VDA (Verband der Automobilindustrie), foodwatch, des BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie), des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland), des Transatlantic Business Council und der "Stop TTIP"-Bewegung bezüglich des TTIP-Abkommens.
Welche Aspekte des TTIP werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht Regulatory Capture im Kontext des TTIP, die Positionen verschiedener Interessengruppen, die Auswirkungen des TTIP auf Standards und Investitionsschutz, die Rolle des Lobbyismus im TTIP-Prozess und die Harmonisierung von Standards und deren potenzielle Folgen.
Was ist Regulatory Capture und wie wird es in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Aspekte von Regulatory Capture, darunter die klassische Theorie, Korruption, "Revolving Doors"-Phänomene, Lobbyismus, die Angleichung von Standards und den Investitionsschutz. Diese Aspekte werden detailliert erläutert und ihre Relevanz für die Analyse der Positionen verschiedener Organisationen im Kontext des TTIP-Abkommens begründet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Theorie des Regulatory Capture, ein Kapitel zur Analyse der Positionen verschiedener Organisationen und eine Zusammenfassung. Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage. Das Kapitel zur Theorie liefert den theoretischen Rahmen. Das Kapitel zur Analyse der Organisationen präsentiert detaillierte Analysen der jeweiligen Positionen. Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: TTIP, Regulatory Capture, Lobbyismus, Harmonisierung von Standards, Investitionsschutz, Freihandelsabkommen, Interessengruppen, VDA, foodwatch, BDI, BUND, "Stop TTIP", EU, USA.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Phänomen des Regulatory Capture im Kontext des TTIP zu untersuchen und zu beleuchten, wie verschiedene Organisationen dieses Abkommen wahrnehmen und beeinflussen. Sie analysiert die Positionen von Befürwortern und Gegnern des Abkommens und bewertet die Auswirkungen des TTIP auf Standards und Investitionsschutz.
Wie wird die Position der einzelnen Organisationen analysiert?
Für jede Organisation wird ihre Haltung zur Harmonisierung von Standards, zum Investitionsschutz und zur Rolle des Lobbyismus im TTIP-Prozess ausführlich beschrieben und analysiert. Die Unterschiede in den Ansichten und die zugrundeliegenden Interessen werden herausgearbeitet, um ein umfassendes Bild der verschiedenen Perspektiven auf das Abkommen zu zeichnen.
- Citation du texte
- Jonas Rüffer (Auteur), 2015, Regulatory Capture in internationalen Abkommen. Eine kritische Analyse der Positionen von Befürwortern und Gegnern des Transatlantic-Trade-and-Investment- Partnership (TTIP), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352134