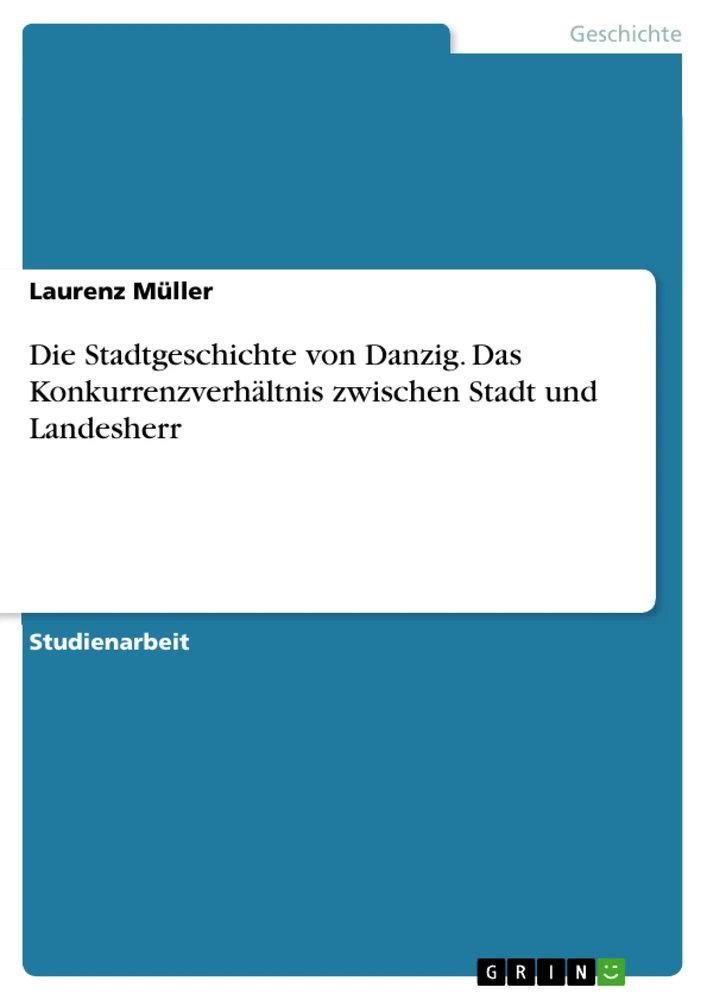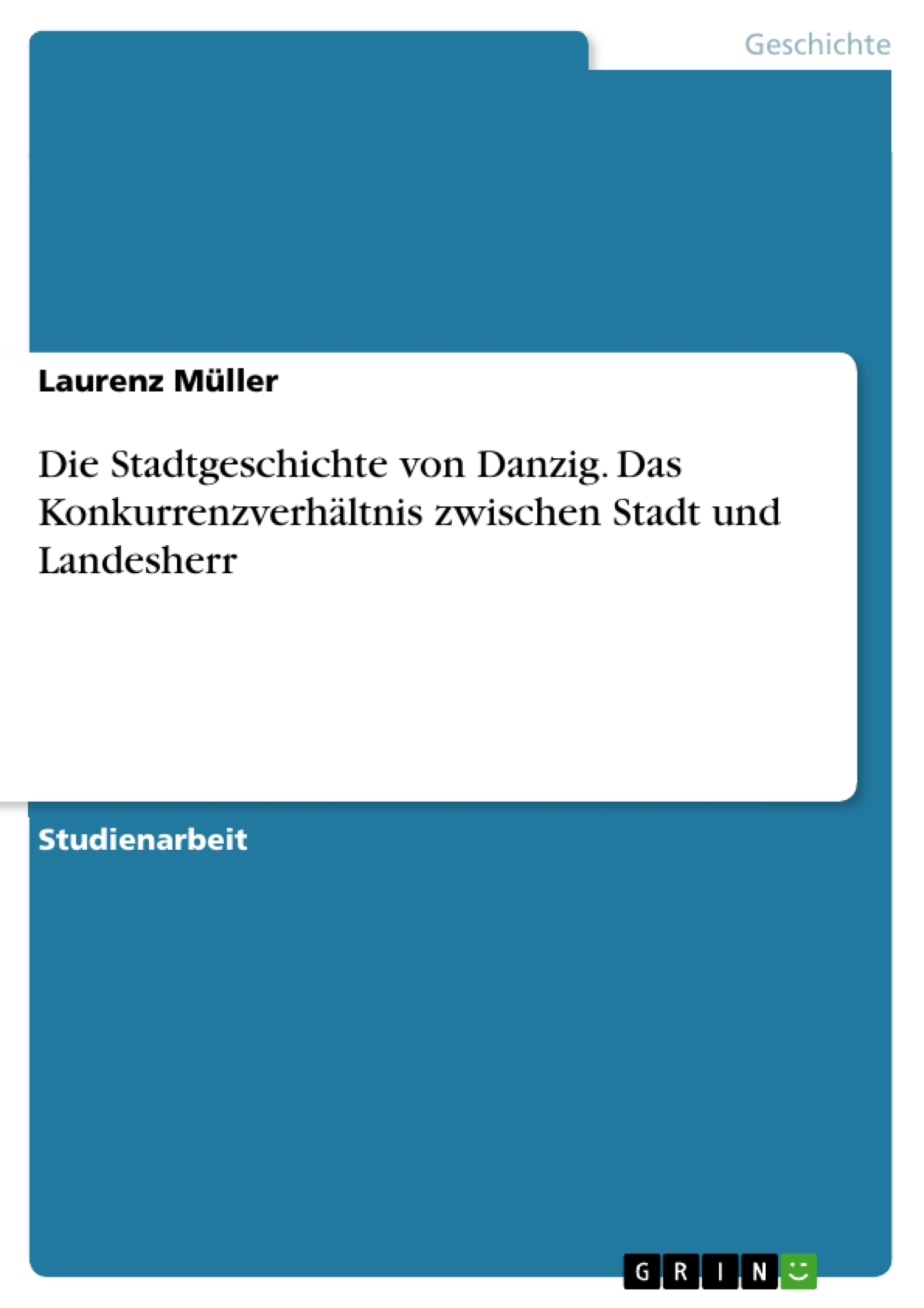Für die Erforschung einer Stadtgeschichte, aber auch für die Frage nach den Verhältnissen zwischen Stadt und Stadtherren, lassen sich mit Untersuchungen zur stadtrechtlichen Entwicklung vielfältige Erkenntnisse sammeln. Denn gerade in dieser Entwicklung spiegelt sich noch vor der baulichen Entwicklung die Entstehung der stadttypischen Bauten wie Rathaus, Pfarrkirche, Markt und Befestigungen wieder.
Im Falle Danzigs wechselte nicht nur der Stadtherr häufig, es kam auch zu mehrmaligen Änderungen im Stadtrecht und auch die Struktur der Stadt sowie ihre Symbolik am Beispiel des Stadtsiegels, sind von diesen Rechtsverleihungen geprägt. Mit der Stadtrechtsverleihung trat die Stadt in eine gewisse Unabhängigkeit oder Autonomie. Diese Begrifflichkeit muss zunächst geklärt werden.
Es soll dann in dieser Arbeit aufgezeigt werden, wie sich diese Entwicklung und Autonomiebestrebungen bzw. Beschränkungen abzeichneten. Nach einem Überblick zur Forschungs- und Quellenlage, sollen kurz die Standortfaktoren sowie die ersten Siedlungen bis zur slawischen Burgstadt thematisiert werden, da hier zum einen am Schluss der erste Stadtrechtsverleiher auftritt und zum anderen diese Voraussetzungen maßgebend für die spätere Struktur der Stadt waren.
Den Schwerpunkt der Arbeit bildet das Konkurrenzverhältnis zwischen Stadt und Landesherr im Falle des Deutschen Ordens ab 1308. Zur Verdeutlichung werden am Ende auch kurz die wesentlichen Rechtsänderungen unter polnischer Herrschaft ab 1454 skizziert. Die Stadtgeschichte ist dementsprechend in drei größere Teile gegliedert, wobei einige Sprünge zu verzeichnen sind, deren detaillierte Darstellung der Rahmen der Arbeit nicht zuließ.
Dem untergeordnet wird ein Einblick in die bauliche Geschichte gegeben, wobei ein kleiner Exkurs zum Artushof den Machtzuwachs einer bürgerlichen Oberschicht verdeutlichen soll, da diese Oberschicht zum späteren selbstbewussten Auftreten der Stadt und zum Ausbau der Rechte unter polnischer Herrschaft beigetragen haben wird.
Die politischen Machtkämpfe unter den Landesherren sollen zur besseren Einordnung des Geschehens erwähnt, aber nicht näher thematisiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriff: Autonomie
- Quellenlage und Forschungspositionen
- Voraussetzungen und naturräumliche Gegebenheiten
- Der Stadtentstehungs- und Ausbauprozess in fünf Teilen
- Die slawische Burgstadt
- Von einer deutschen Kaufmannssiedlung zur Stadt nach deutschem Recht
- Politische Unruhen bis zur Eroberung durch den Deutschen Orden
- Ausbau und Entwicklung Danzigs unter dem Deutschen Orden
- Die Rechtstadt
- Die Neustadt
- Die Vorstadt
- Die Altstadt
- Die Jungstadt
- Rechts- und Verwaltungsänderungen nach 1454
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Autonomie Danzigs im Mittelalter, insbesondere die Beziehungen zwischen der Stadt und ihrem Stadtherrn im Kontext der städtebaulichen Entwicklung und des Stadtrechts. Dabei soll die Frage beantwortet werden, wie sich die städtische Autonomie im Laufe der Zeit durchgesetzt hat, welche Faktoren dazu beigetragen haben und welche Beschränkungen die Autonomie der Stadt erfuhr.
- Die Bedeutung des Stadtrechts für die Entwicklung der städtischen Autonomie
- Die historischen Prozesse der Stadtwerdung Danzigs von der slawischen Burgstadt bis zur deutschen Stadt
- Das Konkurrenzverhältnis zwischen Stadt und Stadtherrn im Falle des Deutschen Ordens
- Die Rolle des Artushofs im Kontext des Machtzuwachses der bürgerlichen Oberschicht
- Die Auswirkungen der Rechtsänderungen unter polnischer Herrschaft auf die Stadt Danzig
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung der Untersuchung städtebaulicher Entwicklung für das Verständnis der Beziehungen zwischen Stadt und Stadtherrn heraus. Sie beleuchtet die Besonderheit Danzigs im Kontext des Kulmischen Rechts und erläutert die Gliederung der Arbeit.
- Begriff: Autonomie: Das Kapitel behandelt den Begriff „Autonomie“ in seinen verschiedenen Kontexten und definiert die konstitutiven Merkmale der Autonomie einer mittelalterlichen Stadt nach Isenmann.
- Quellenlage und Forschungspositionen: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Quellenlage und die Forschungspositionen zur Geschichte Danzigs, wobei die unterschiedlichen Interpretationen des „Danziger Blutbads“ von 1308 als Beispiel für die politisch motivierten Gegensätze in der Forschung dienen.
- Voraussetzungen und naturräumliche Gegebenheiten: Das Kapitel beleuchtet die geographischen und historischen Voraussetzungen für die Entstehung der Stadt Danzig, einschließlich der ersten Siedlungen und der slawischen Burgstadt.
- Die slawische Burgstadt: Dieses Kapitel widmet sich der slawischen Burgstadt Danzig und ihren Besonderheiten.
- Von einer deutschen Kaufmannssiedlung zur Stadt nach deutschem Recht: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Stadt Danzig von einer deutschen Kaufmannssiedlung hin zu einer Stadt nach deutschem Recht.
- Politische Unruhen bis zur Eroberung durch den Deutschen Orden: Das Kapitel thematisiert die politischen Unruhen in Danzig, die zur Eroberung der Stadt durch den Deutschen Orden führten.
- Ausbau und Entwicklung Danzigs unter dem Deutschen Orden: Dieses Kapitel beleuchtet den Ausbau und die Entwicklung der Stadt Danzig während der Herrschaft des Deutschen Ordens, unterteilt in die Bereiche Rechtstadt, Neustadt, Vorstadt, Altstadt und Jungstadt.
- Rechts- und Verwaltungsänderungen nach 1454: Dieses Kapitel skizziert die Rechts- und Verwaltungsänderungen in Danzig nach dem Übergang unter polnische Herrschaft im Jahr 1454.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Autonomie, Stadtrecht, Stadtentwicklung, Stadtgeschichte, Danzig, Deutscher Orden, Kulmisches Recht, Stadtwerdungsprozess, Bürgergemeinde, städtebauliche Entwicklung, Artushof, slawische Burgstadt, Rechts- und Verwaltungsänderungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Untersuchung zur Stadtgeschichte Danzigs?
Die Arbeit untersucht das Konkurrenzverhältnis zwischen der Stadt Danzig und ihren Landesherren, insbesondere dem Deutschen Orden, sowie die Entwicklung der städtischen Autonomie durch das Stadtrecht.
Welche Rolle spielt das Kulmische Recht für Danzig?
Das Kulmische Recht war maßgeblich für die Rechtsverleihungen und die strukturelle Entwicklung der Stadt, die Danzig eine gewisse Unabhängigkeit und Autonomie gegenüber dem Stadtherrn verlieh.
Wie beeinflusste der Deutsche Orden die Entwicklung der Stadt ab 1308?
Unter der Herrschaft des Deutschen Ordens kam es zu einem massiven Ausbau der Stadtteile (Rechtstadt, Altstadt, Jungstadt), aber auch zu Spannungen und Machtkämpfen um die städtische Selbstverwaltung.
Was symbolisiert der Artushof in der Danziger Geschichte?
Der Artushof dient als Beispiel für den Machtzuwachs der bürgerlichen Oberschicht, die maßgeblich zum selbstbewussten Auftreten der Stadt gegenüber den Landesherren beitrug.
Welche Veränderungen ergaben sich für Danzig nach 1454?
Nach 1454 trat Danzig unter polnische Herrschaft, was zu bedeutenden Rechts- und Verwaltungsänderungen führte und den Ausbau der städtischen Rechte weiter vorantrieb.
- Arbeit zitieren
- Laurenz Müller (Autor:in), 2016, Die Stadtgeschichte von Danzig. Das Konkurrenzverhältnis zwischen Stadt und Landesherr, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352143