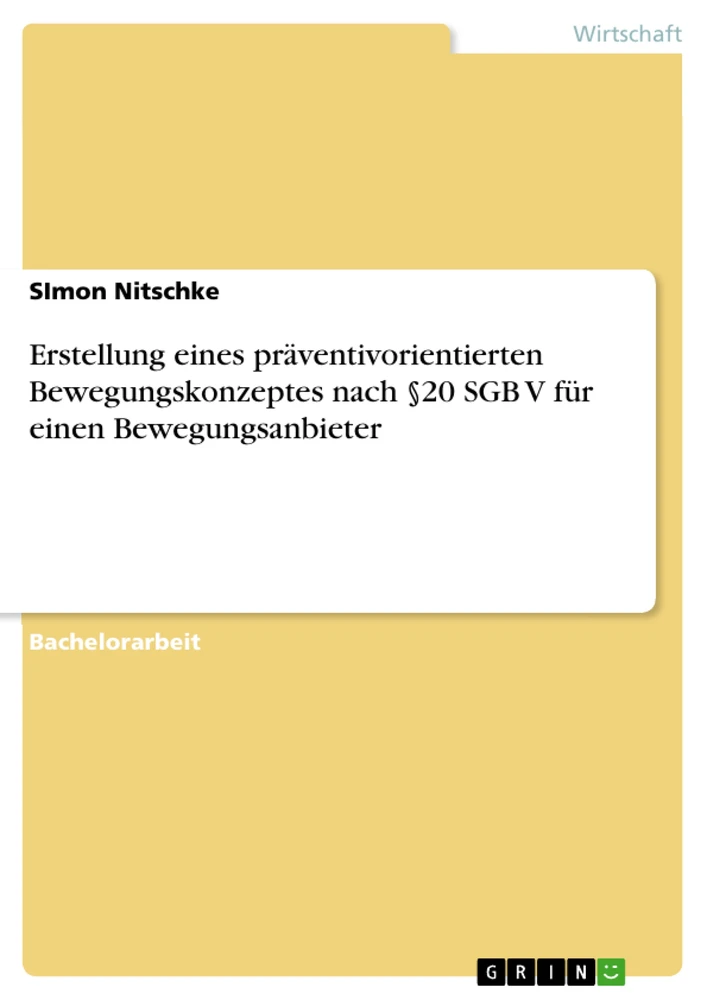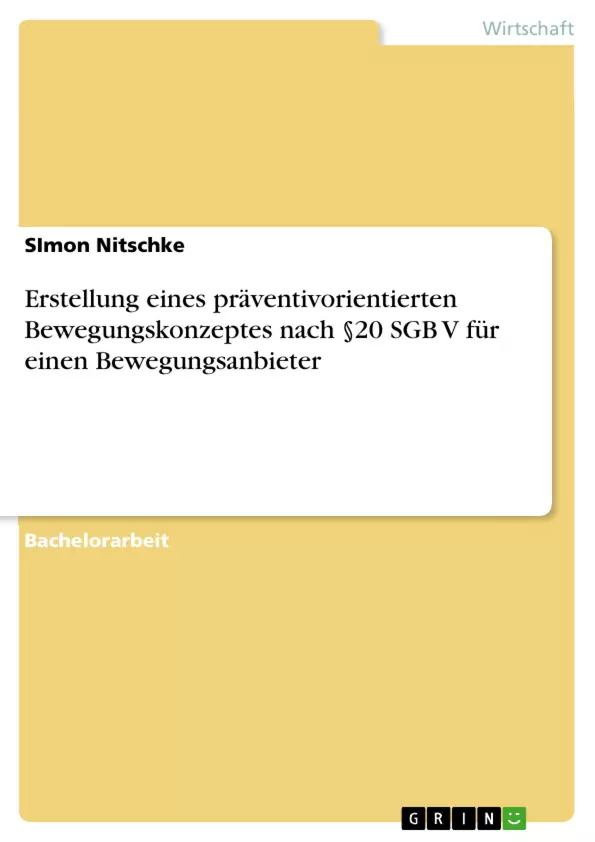Rückenbeschwerden sind, besonders in Industrieländern, ein weit verbreitetes Thema und verursachen hohe Kosten für das gesamte System. Die hohen Kosten setzen sich aus Arbeitsunfähigkeit, Inanspruchnahme Medizinischer Maßnahmen, Frührente oder Erwerbsminderung zusammen. Des Weiteren fand das Robert-Koch Institut (RKI) heraus, „dass etwa 60-80 Prozent der Erwachsenen über Rückenschmerzen klagen“ (Robert-Koch Institut, 2012, S. 19).
Folgende Fragestellungen werden daher in dieser Arbeit behandelt: Wie kann man diesen hohen Kosten entgegengewirkt werden? Kann ein Bewegungskurs Rückenbeschwerden präventiv vorbeugen und somit den erhöhten Krankenstand und die hohen volkswirtschaftlichen Kosten senken? Gibt es bevorzugte Zielgruppen, welche einen besonders hohen Bedarf an Präventionskursen haben?
Neben den hohen Kosten für die Volkswirtschaft, müssen auch die Konzeptkosten und der Break-Even Point berechnet und betrachtet werden. Wie hoch sind die Ausgaben um einen Präventionskurs durchzuführen und ab welcher Teilnehmerzahl decken sich die Einnahmen mit den Ausgaben.
Des Weiteren stellt sich die Frage, ob das Kurskonzept wie geplant durchgeführt werden kann, oder ob Barrieren und Probleme entstehen können. In diesem Zusammenhang wird ermittelt, welche Barrieren und Probleme auftreten können und wie Sie behoben bzw. von vornherein vermieden werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Problemstellung
- 2 Zielsetzung
- 2.1 Allgemeine Zielsetzung
- 2.2 Zielgruppe
- 3 Gegenwärtiger Kenntnisstand
- 3.1 Präventionsgesetz und Leitfaden Prävention
- 3.1.1 Präventionsgesetz
- 3.1.2 Leitfaden Prävention
- 3.1.3 Präventionsbericht 2014
- 3.2 Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Rückenschmerzen und Prävention
- 3.2.1 Rückenschmerzen in Deutschland
- 3.2.2 Risikofaktoren für Rückenschmerzen
- 3.2.3 Studien zu bereits durchgeführten Rückenschulkonzepten
- 3.2.4 Das bio-psycho-soziale Schmerzkonzept
- 3.2.5 Teilnehmer der Präventionskurse
- 3.1 Präventionsgesetz und Leitfaden Prävention
- 4 Methodik
- 4.1 Grobplanung des Konzepts
- 4.2 Berechnung des Break-Even Point
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Präventionskurs nach §20 SGB V
- 5.2 Break-Even Point
- 6 Diskussion
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt auf die Erstellung eines präventiv orientierten Bewegungskonzeptes nach §20 SGB V für einen Bewegungsanbieter ab. Sie untersucht die Notwendigkeit und wirtschaftliche Machbarkeit eines solchen Konzepts im Kontext der hohen Kosten von Rückenschmerzen in Deutschland.
- Prävention von Rückenschmerzen durch Bewegung
- Analyse des deutschen Präventionsgesetzes und relevanter Leitfäden
- Entwicklung eines kosteneffektiven Bewegungskonzeptes
- Identifizierung relevanter Zielgruppen für Präventionskurse
- Berechnung des Break-Even-Points des Konzepts
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Problemstellung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Erstellung eines präventiv orientierten Bewegungskonzeptes nach §20 SGB V ein. Es beleuchtet die demografische Entwicklung und den Wandel des Krankheitsspektrums als Begründung für die Notwendigkeit von Prävention. Die hohen volkswirtschaftlichen Kosten durch Rückenschmerzen werden hervorgehoben, und die Fragestellungen der Arbeit, wie diesen Kosten entgegengewirkt werden kann und ob ein Bewegungskurs präventiv wirken kann, werden formuliert. Die Notwendigkeit der Berechnung der Konzeptkosten und des Break-Even-Points wird ebenfalls betont, ebenso wie die möglichen Barrieren und Probleme bei der Umsetzung des Konzepts.
2 Zielsetzung: Dieses Kapitel beschreibt die allgemeine und kursspezifische Zielsetzung des geplanten Präventionskurses nach §20 SGB V. Es definiert die Zielgruppe, die der Kurs ansprechen soll, und legt die Grundlage für die weitere Entwicklung des Konzepts.
3 Gegenwärtiger Kenntnisstand: Dieses Kapitel untersucht den aktuellen Stand der Forschung und Praxis im Bereich der Rückenschmerzprävention. Es analysiert das Präventionsgesetz, den Leitfaden Prävention und relevante Statistiken zu Rückenschmerzen in Deutschland. Es beleuchtet Risikofaktoren, Studien zu bereits durchgeführten Rückenschulkonzepten und das bio-psycho-soziale Schmerzkonzept. Die Analyse dient als Grundlage für die Entwicklung des eigenen Präventionskonzeptes.
4 Methodik: In diesem Kapitel wird die Methodik zur Entwicklung des Bewegungskonzeptes beschrieben, inklusive der Grobplanung des Konzepts und der Berechnung des Break-Even-Points. Es erläutert den methodischen Ansatz zur Entwicklung und Bewertung des Präventionsprogramms.
5 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse des entwickelten Präventionskurses nach §20 SGB V und die Berechnung des Break-Even-Points. Es fasst die zentralen Ergebnisse des Projekts zusammen, die im vorherigen Abschnitt detailliert beschrieben wurden.
6 Diskussion: (Da die Zusammenfassung der Diskussion potenziell Spoiler enthalten kann, wird diese hier ausgelassen.)
Schlüsselwörter
Prävention, Rückenschmerzen, §20 SGB V, Bewegungskonzept, Gesundheitsförderung, Kosten-Nutzen-Analyse, Break-Even-Point, Zielgruppenanalyse, Präventionsgesetz, Leitfaden Prävention.
Häufig gestellte Fragen zum präventiv orientierten Bewegungskonzept nach §20 SGB V
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Erstellung eines präventiv orientierten Bewegungskonzeptes nach §20 SGB V für einen Bewegungsanbieter. Sie untersucht die Notwendigkeit und wirtschaftliche Machbarkeit eines solchen Konzepts angesichts der hohen Kosten von Rückenschmerzen in Deutschland.
Welche Ziele werden in dieser Arbeit verfolgt?
Die Arbeit zielt auf die Entwicklung eines kosteneffektiven Bewegungskonzeptes zur Prävention von Rückenschmerzen ab. Es werden die relevanten Zielgruppen identifiziert und der Break-Even-Point berechnet. Die Analyse des deutschen Präventionsgesetzes und relevanter Leitfäden ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Prävention von Rückenschmerzen durch Bewegung, Analyse des deutschen Präventionsgesetzes und relevanter Leitfäden, Entwicklung eines kosteneffektiven Bewegungskonzeptes, Identifizierung relevanter Zielgruppen für Präventionskurse und Berechnung des Break-Even-Points des Konzepts.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung und Problemstellung, Zielsetzung, Gegenwärtiger Kenntnisstand, Methodik, Ergebnisse, Diskussion und Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Bewegungskonzeptes, beginnend mit der Einführung des Themas und endend mit einer umfassenden Diskussion der Ergebnisse.
Was wird im Kapitel "Gegenwärtiger Kenntnisstand" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert den aktuellen Stand der Forschung und Praxis im Bereich der Rückenschmerzprävention. Es untersucht das Präventionsgesetz, den Leitfaden Prävention, relevante Statistiken zu Rückenschmerzen in Deutschland, Risikofaktoren, Studien zu bereits durchgeführten Rückenschulkonzepten und das bio-psycho-soziale Schmerzkonzept.
Wie wird die Methodik zur Entwicklung des Bewegungskonzeptes beschrieben?
Das Kapitel "Methodik" beschreibt die Vorgehensweise bei der Entwicklung des Bewegungskonzeptes, inklusive der Grobplanung und der Berechnung des Break-Even-Points. Es erläutert den methodischen Ansatz zur Entwicklung und Bewertung des Präventionsprogramms.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert den entwickelten Präventionskurs nach §20 SGB V und die Berechnung des Break-Even-Points. Es fasst die zentralen Ergebnisse des Projekts zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Prävention, Rückenschmerzen, §20 SGB V, Bewegungskonzept, Gesundheitsförderung, Kosten-Nutzen-Analyse, Break-Even-Point, Zielgruppenanalyse, Präventionsgesetz, Leitfaden Prävention.
Welche Zielgruppe wird mit dem Bewegungskonzept angesprochen?
Die Zielgruppe des geplanten Präventionskurses nach §20 SGB V wird im Kapitel "Zielsetzung" definiert. Sie bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung des Konzepts.
Wie wird die Wirtschaftlichkeit des Konzepts bewertet?
Die Wirtschaftlichkeit wird durch die Berechnung des Break-Even-Points ermittelt und im Kapitel "Ergebnisse" präsentiert. Dies zeigt die Machbarkeit des Konzepts auf.
- Citar trabajo
- SImon Nitschke (Autor), 2016, Erstellung eines präventivorientierten Bewegungskonzeptes nach §20 SGB V für einen Bewegungsanbieter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/352333