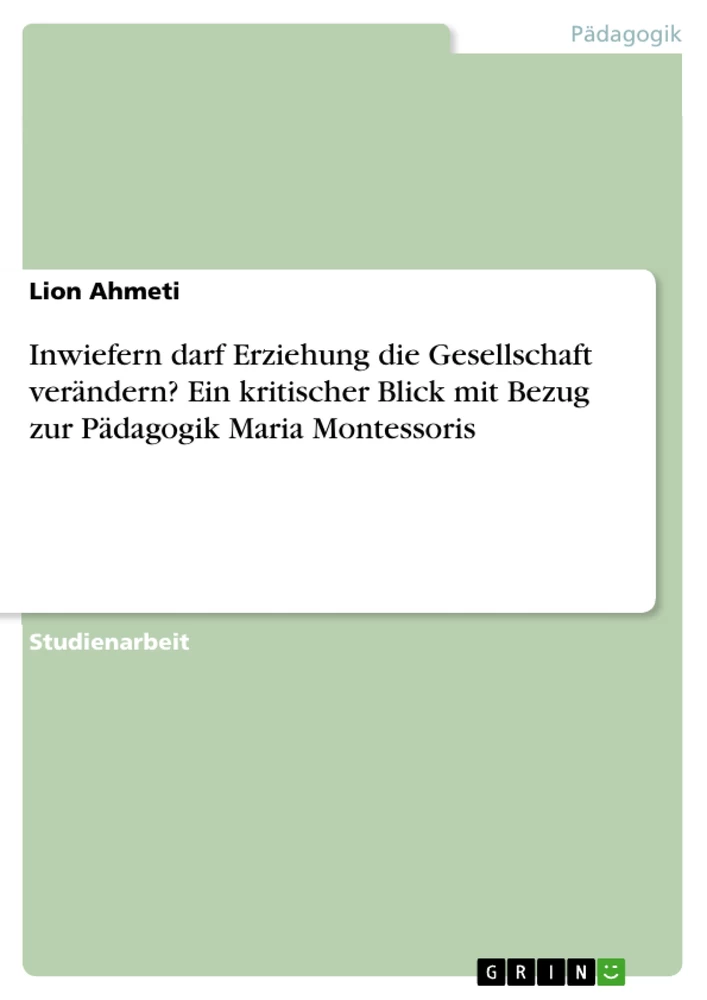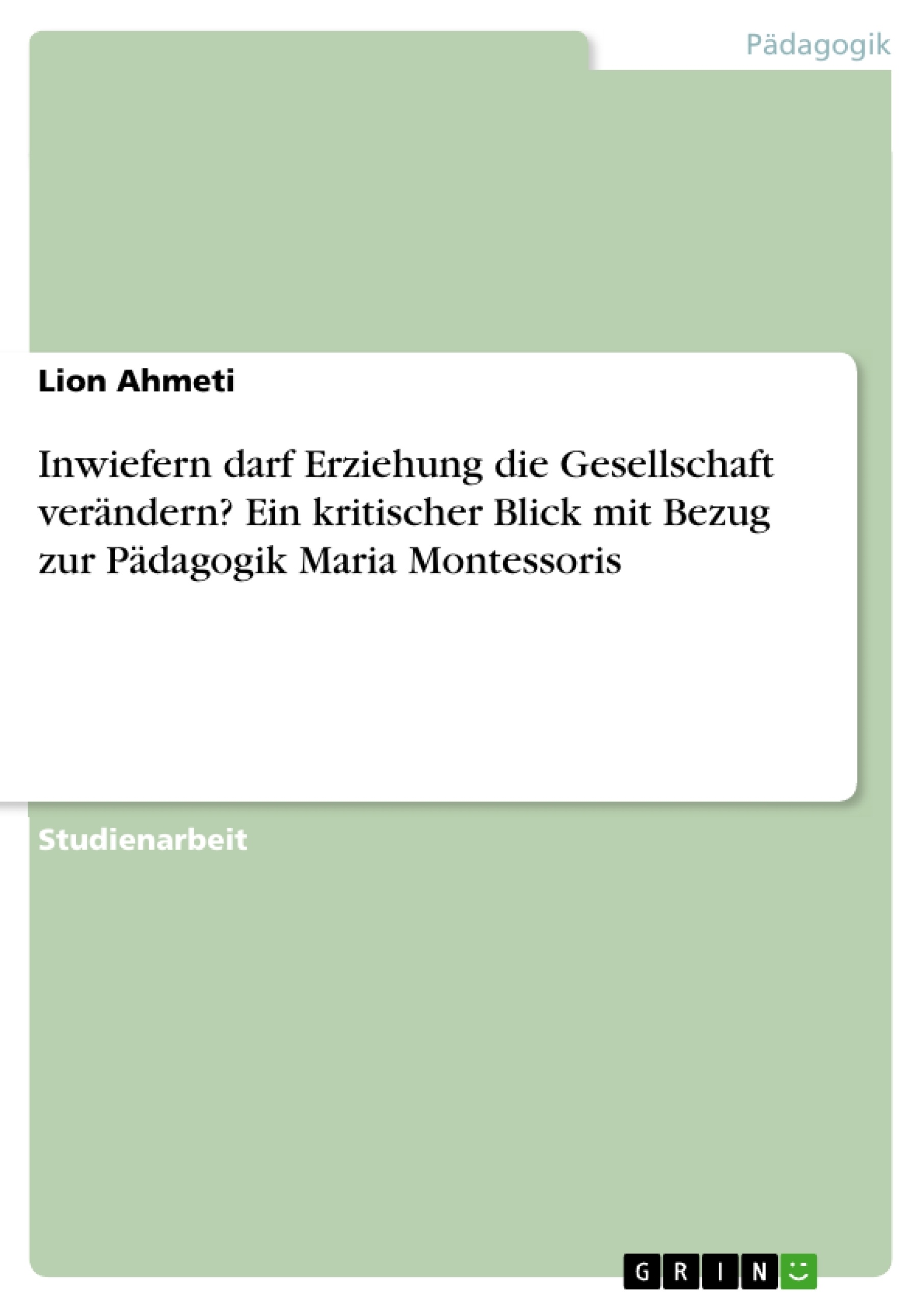Darf Erziehung die Gesellschaft verändern? Bei Bejahung weiterhin die Frage: Inwiefern darf Erziehung die Gesellschaft verändern? Wo findet sie ihre Grenzen? Um diese Fragen zu beantworten, werden zunächst die Begrifflichkeiten „Erziehung“ und „Gesellschaft“ aus Sicht der Erziehungswissenschaft analysiert und im Hinblick auf ihre Legitimation betrachtet.
Anschließend soll die diesbezügliche Problematik des Verhältnisses von Erziehung und Gesellschaft untersucht werden. Dabei werden Erziehung und Gesellschaft, zunächst jeweils einseitig gesetzt, betrachtet, und anschließend im Verhältnis zueinander. Zudem müssten historische Entwicklungen sowie kulturelle Besonderheiten berücksichtigt werden, was jedoch in dem eingeschränkten Rahmen einer Hausarbeit kaum möglich ist. Aufgrund des Bezuges zur Pädagogik Montessoris muss hierbei dennoch im späteren Verlauf ein Blick auf den historischen Kontext der Reformpädagogik geworfen werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Zum Begriff Erziehung und Gesellschaft
- 2.1 Bedeutung und Verwendung von Erziehung
- 2.2 Bedeutung und Verwendung von Erziehung nach Montessori
- 2.3 Bedeutung und Verwendung von Gesellschaft
- 3. Erziehung und Gesellschaft
- 3.1 Die Erziehung als Funktion der Gesellschaft
- 3.2 Die Gesellschaft als Funktion der Erziehung
- 3.3 Interdependenz von Erziehung und Gesellschaft
- 3.4 Legitimität der Pädagogik Montessoris
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern Erziehung die Gesellschaft verändern darf und untersucht dabei die Beziehung zwischen Erziehung und Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der Pädagogik Maria Montessoris. Im Vordergrund steht die Analyse der komplexen Interdependenz zwischen diesen beiden Bereichen und die Beantwortung der Frage, wo die Grenzen der erzieherischen Einflussnahme auf die Gesellschaft liegen.
- Definition des Begriffs „Erziehung“ und „Gesellschaft“ im Kontext der pädagogischen Diskussion
- Analyse der wechselseitigen Beziehung zwischen Erziehung und Gesellschaft
- Bedeutung der Pädagogik Montessoris im Hinblick auf die Frage der gesellschaftlichen Veränderung durch Erziehung
- Legitimität und Grenzen der erzieherischen Einflussnahme auf die Gesellschaft
- Historische und gesellschaftliche Entwicklungen im Verhältnis von Erziehung und Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und verdeutlicht die Problematik der Beziehung zwischen Erziehung und Gesellschaft anhand eines Zitats von Schleiermacher. Die Einleitung betont die Notwendigkeit, die einseitige Setzung von Erziehung oder Gesellschaft zu vermeiden und stattdessen die wechselseitige Abhängigkeit und die damit verbundenen Herausforderungen zu betrachten.
- Kapitel 2: Zum Begriff Erziehung und Gesellschaft: In diesem Kapitel werden die Begriffe „Erziehung“ und „Gesellschaft“ aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Der Begriff „Erziehung“ wird dabei als vielschichtig und interpretationsbedürftig dargestellt. Es werden verschiedene Definitionen und Konzepte von Erziehung vorgestellt, die von Fremdbestimmung bis hin zu freiwilliger Begleitung reichen. Ebenso wird der Begriff „Gesellschaft“ in seiner Vielschichtigkeit betrachtet und seine Bedeutung für Erziehung und Bildung im Allgemeinen beleuchtet.
- Kapitel 3: Erziehung und Gesellschaft: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse des Verhältnisses von Erziehung und Gesellschaft. Dabei werden zunächst die beiden Bereiche jeweils für sich betrachtet und ihre jeweiligen Funktionen innerhalb des Gesamtsystems untersucht. Anschließend wird die wechselseitige Abhängigkeit von Erziehung und Gesellschaft herausgearbeitet und die Frage nach der Legitimität erzieherischer Einflussnahme auf die Gesellschaft gestellt. Im Besonderen wird die pädagogische Theorie Maria Montessoris in den Kontext der Frage nach der Veränderungsmöglichkeit von Erziehung auf die Gesellschaft gestellt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen „Erziehung“, „Gesellschaft“ und „Pädagogik Maria Montessoris“. Im Mittelpunkt stehen die Interdependenz von Erziehung und Gesellschaft, die Legitimität der erzieherischen Einflussnahme auf die Gesellschaft, die Rolle von Reformpädagogik in der gesellschaftlichen Entwicklung sowie die Frage, inwiefern Erziehung die Gesellschaft verändern darf. Diese Themen werden anhand von Definitionen, historischen Entwicklungen und der Analyse der pädagogischen Theorie von Maria Montessori beleuchtet.
- Quote paper
- Lion Ahmeti (Author), 2016, Inwiefern darf Erziehung die Gesellschaft verändern? Ein kritischer Blick mit Bezug zur Pädagogik Maria Montessoris, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353026