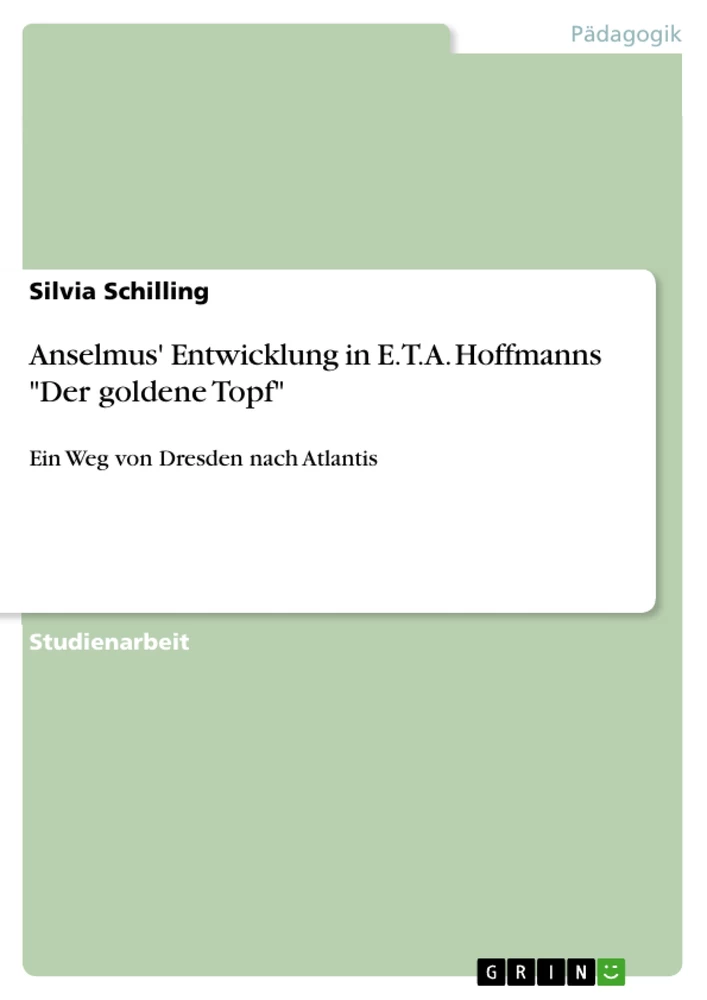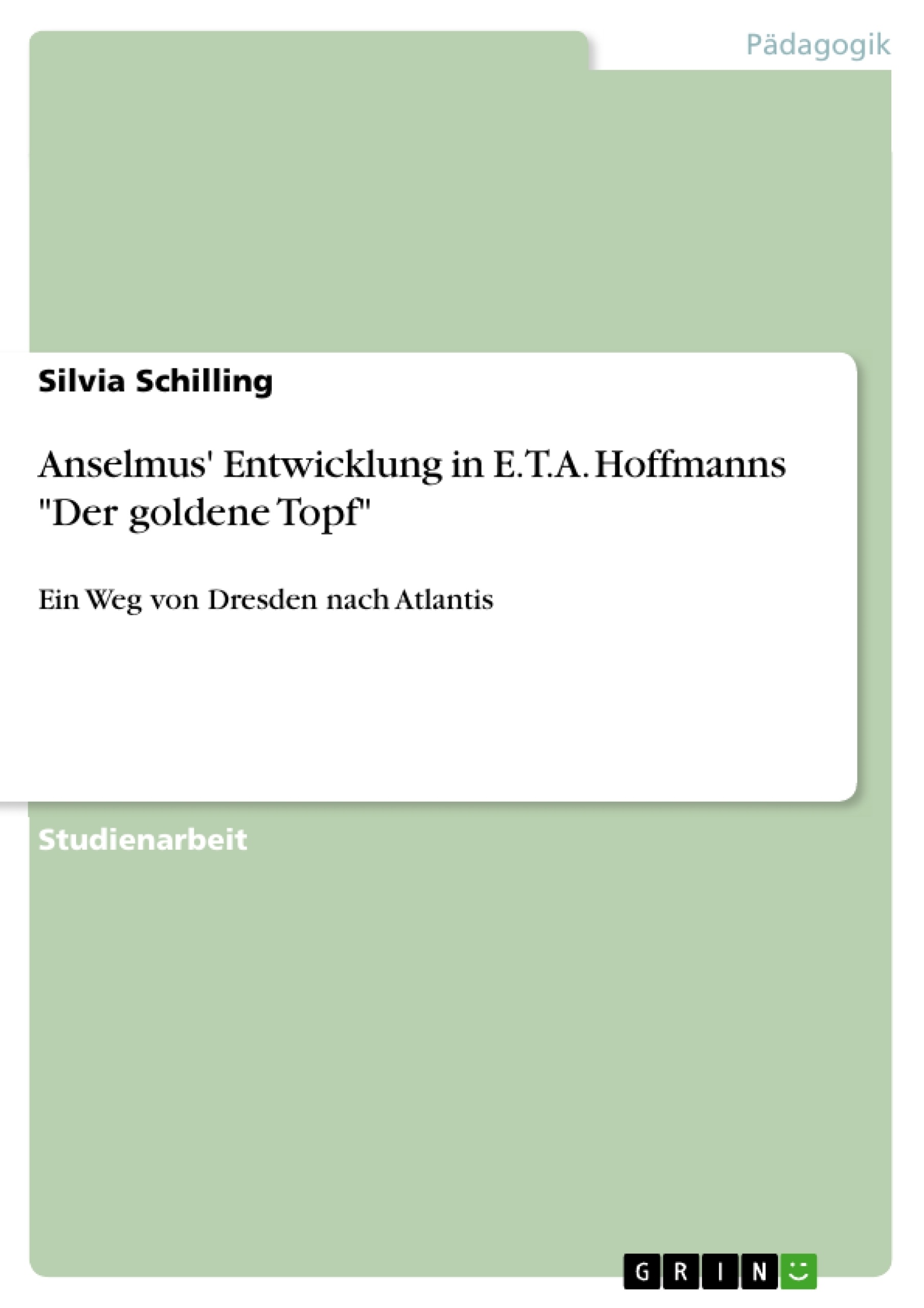E.T.A. Hoffmanns "Fantasiestücke in Callot's Manier" umfassen eine Reihe von Geschichten beziehungsweise Märchen, die sich mt Grenzgängen zwischen Imagination und Wirklichkeit beschäftigen. Diese Hausarbeit analysiert eines dieser Märchen, "Den goldenen Topf" in Bezug auf die Entwicklung des Protagonisten Anselmus, welcher sich fortwährend zwischen Wirklichkeit und Fantasie bewegt.
Zunächst wird hierbei Anselmus' Position in der Spannung zwischen bürgerlichem Rationalismus und dem Fantastischen bestimmt. Im weiteren Verlauf wird diese Spannung, dieses Zerrissen-Sein dann auch auf Anselmus' Beziehungen zu anderen Figuren übertragen, insbesondere im Bezug auf zwei weibliche Wesen: Serpentina und Veronika Paulmann. In einem weiteren Kapitel wird beschrieben, dass Anselmus sich für eine der Welten entscheiden muss und dass ihn nur die Wahl der fantastischen Welt zu einem wahren Künstler machen kann. Nach der vollständigen Analyse dieser Entwicklung und des Ausgangs wird auch auf die Diskrepanzen und Ähnlichkeiten zwischen Anselmus und dem Erzähler der Geschichte hingewiesen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung.
- Anselmus zwischen zwei Welten
- Anselmus – Ein gewöhnlicher Student?.
- Bürgerliches Unverständnis
- Anselmus zwischen zwei Frauen
- Serpentina
- Veronika Paulmann
- Die Figuren im Hintergrund: Archivarius Lindhorst und Frau Rauerin.
- Auf Umwegen zum wahren Künstler
- Anselmus auf bürgerlichen Abwegen
- Der Fall: Anselmus als Philister.
- Der Eintritt nach Atlantis
- Anselmus und der Erzähler – ein Kontrast
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Der Text analysiert die Entwicklung des Protagonisten Anselmus im E.T.A. Hoffmanns Kunstmärchen „Der goldene Topf“. Die Arbeit konzentriert sich darauf, wie Anselmus durch das Wechselspiel von bürgerlichen und fantastischen Elementen beeinflusst wird und letztendlich zu einem wahren Künstler heranwächst.
- Die Konfrontation Anselmus' mit zwei Welten: die bürgerliche und die fantastische.
- Die Rolle von weiblichen Figuren als Repräsentanten der beiden Welten: Serpentina und Veronika.
- Die Auswirkungen von Anselmus' Andersartigkeit auf seine Wahrnehmung und Entwicklung.
- Der Einfluss des Bürgerlichen auf Anselmus' Verhalten und Selbstverständnis.
- Die Suche nach der eigenen Identität und dem Künstlerdasein.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Einleitung: Die Einleitung stellt den Beginn von E.T.A. Hoffmanns „Der goldene Topf“ vor und führt in die Konfrontation des Protagonisten Anselmus mit der fantastischen Welt ein. Die Arbeit soll untersuchen, wie diese beiden Welten Anselmus' Entwicklung beeinflussen.
Anselmus zwischen zwei Welten: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Anselmus als Student, dessen bürgerliches Leben durch fantastische Elemente beeinflusst wird. Anselmus' Andersartigkeit und sein Mangel an Souveränität in der bürgerlichen Welt werden beleuchtet.
Anselmus zwischen zwei Frauen: Dieses Kapitel fokussiert auf die weiblichen Figuren im Werk, Serpentina und Veronika, und wie sie die beiden Welten repräsentieren, zwischen denen Anselmus hin- und hergerissen ist.
Auf Umwegen zum wahren Künstler: In diesem Kapitel werden Anselmus' Bemühungen, sich in die bürgerliche Welt einzugliedern, und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, beleuchtet. Sein Konflikt zwischen der bürgerlichen und der fantastischen Welt wird weiter untersucht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie der Doppelwelt, die sich aus der bürgerlichen und der fantastischen Welt zusammensetzt. Die Auseinandersetzung mit der Andersartigkeit, die sowohl durch Anselmus' Persönlichkeit als auch durch die fantastischen Elemente repräsentiert wird, sowie die Konfrontation mit den beiden weiblichen Figuren Serpentina und Veronika, stehen im Fokus der Analyse. Weitere wichtige Begriffe sind Kunst, Künstlerdasein, Entwicklung, Selbstfindung und der Einfluss von Fantasie auf die Realität.
Häufig gestellte Fragen
Welche Entwicklung durchläuft Anselmus im „Goldenen Topf“?
Anselmus entwickelt sich von einem tollpatschigen Studenten zwischen bürgerlichem Rationalismus und Fantasie hin zu einem wahren Künstler in Atlantis.
Wofür stehen Serpentina und Veronika?
Serpentina repräsentiert die fantastische, poetische Welt, während Veronika Paulmann das bürgerliche, materielle Leben verkörpert.
Was bedeutet „bürgerliches Unverständnis“ im Märchen?
Es beschreibt die Unfähigkeit der Philister (Bürger), das Wunderbare und Fantastische in ihrer Alltagswelt wahrzunehmen.
Wer sind die Gegenspieler in der Geschichte?
Der Archivarius Lindhorst (als Vertreter der Poesie) steht der Frau Rauerin (als Vertreterin der dunklen, erdgebundenen Mächte) gegenüber.
Wie endet die Geschichte für Anselmus?
Er entscheidet sich für die fantastische Welt und erlangt durch die Verbindung mit Serpentina das ewige Glück im Geisterreich Atlantis.
- Citation du texte
- Silvia Schilling (Auteur), 2014, Anselmus' Entwicklung in E.T.A. Hoffmanns "Der goldene Topf", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353114