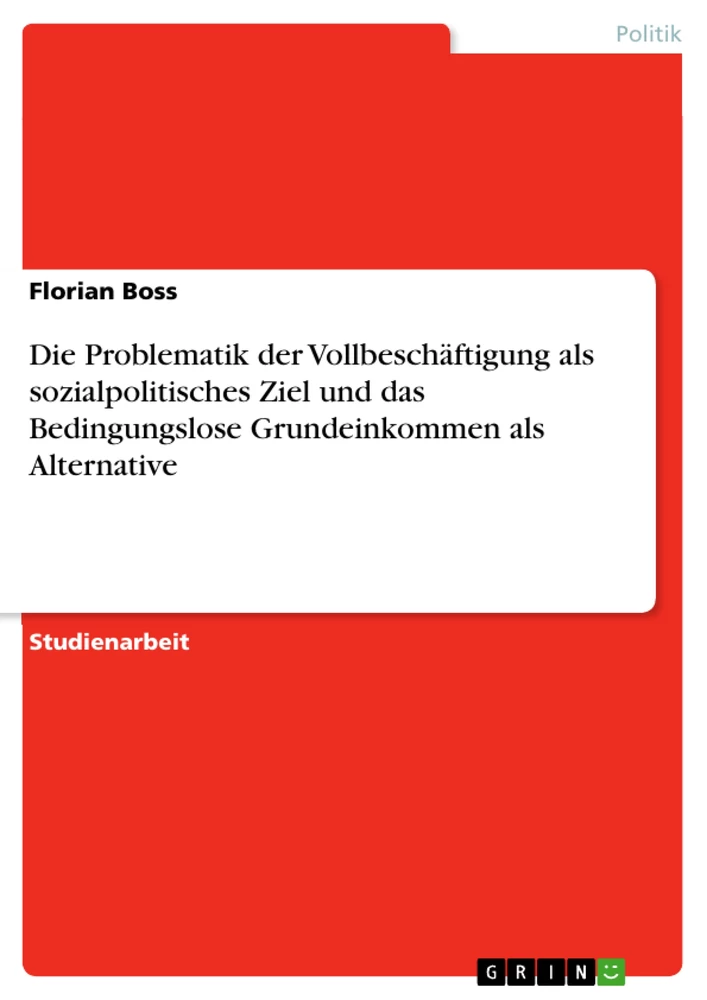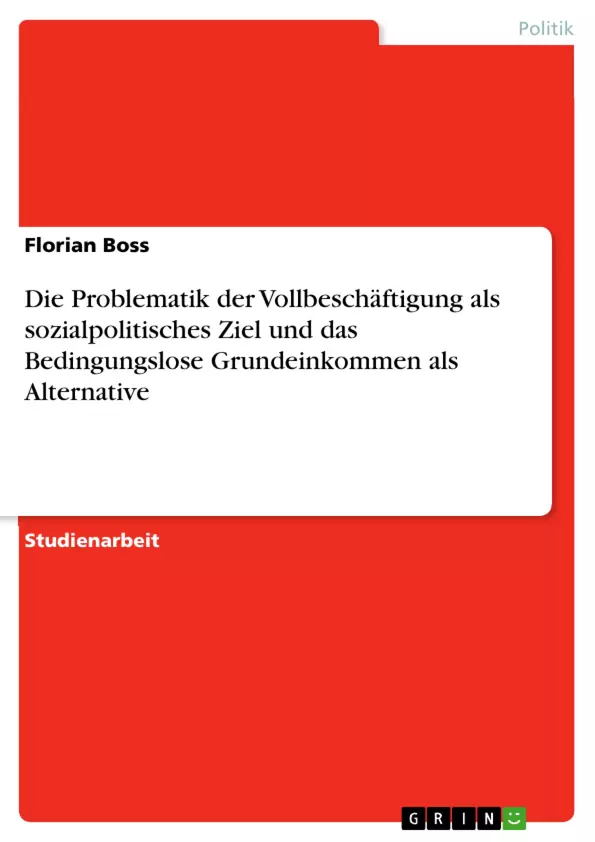Die Popularität des Bedingungslosen Grundeinkommens und der zunehmende aktionistische Charakter der Bewegung verlangt nach einer tieferen Auseinandersetzung mit dem Thema. Wie lauten die Kritikpunkte an den jetzigen Arbeitsverhältnissen und der aktuellen Arbeitsmarktpolitik, die letztlich zu dieser Idee hinführen? Wie lässt sich beschäftigungspolitisch argumentieren? Eine Kritik der Vollbeschäftigung als wichtigstes wirtschaftspolitisches Ziele ist hier ein wichtiger Argumentationsstrang. Die zentrale Frage des ersten Abschnitts der Arbeit ist deshalb: Wieso ist Vollbeschäftigung unmöglich (geworden)? Einer kurzen Definition des Ziels der Vollbeschäftigung folgt die Erkenntnis, dass wir uns seit über dreißig Jahren immer weiter davon zu entfernen scheinen. Grund genug für alle großen Parteien, zur Bundestagswahl 2009 eine massive Arbeitsplatzbeschaffung bis hin zur Vollbeschäftigung zu versprechen. Dem zugrunde liegt ein Zeitgeist, der in den Veränderungen des Sozialrechts durch die Hartz-Reformen Ausdruck findet. Abgesehen davon, dass das erklärte Ziel der Hartz-Kommission, durch die Reformen Vollbeschäftigung herzustellen, bisher nicht einmal ansatzweise erfüllt wurde, stellt sich dann die Frage, ob es überhaupt heutzutage Sinn macht, alle Menschen in Arbeit zu bringen. Dem Ziel der Vollbeschäftigung liegt nämlich ein grundsätzlicher Denkfehler zugrunde, der später näher erläutert wird.
Doch wie können alternative Ziele aussehen? Beim Versuch einer Antwort kommt man am Bedingungslosen Grundeinkommen nicht vorbei: dieser Idee widmet sich der zweite Abschnitt der Arbeit. Einer kurzen Vorstellung folgt das größte Pro-Argument, das der Autonomie des Menschen. Die Reaktionen vieler, die von der Idee das erste Mal hören, sind: „Das ist nicht bezahlbar!“ und: „Dann würden viele nicht mehr arbeiten, das ist ungerecht!“ Diese Hauptzweifel, wenn auch offensichtlich zu pauschal, sind nicht von der Hand zu weisen. In späteren Abschnitten werde ich sie jedoch etwas differenzierter betrachten, was uns zu einem zentralen Realisationsdilemma der Idee führt. Auf die Haltbarkeit der gesellschaftlichen und ökonomischen Befürchtungen gehe ich in den letzten zwei Unterpunkten ein. Schließlich wendet sich die Arbeit drittens der Frage zu, wie die Idee in Europa diskutiert wird und wie wahrscheinlich eine Änderung des aktuellen Politikkurses angesichts der offensichtlichen Notwendigkeit ist.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Vorwort
- 1. Vollbeschäftigungsnorm versus Realität
- 1.1. Was ist Vollbeschäftigung?
- 1.2. Realität auf dem Arbeitsmarkt
- 1.3. Vollbeschäftigung als aktuelles wirtschaftspolitisches Ziel
- 1.4. Zeitgeist Hartz IV
- 1.5. Ein Recht auf Arbeit für alle?
- 1.6. Das Ende der Vollbeschäftigung.
- 2. Das Bedingungslose Grundeinkommen als Alternative
- 2.1. Was ist das BGE?
- 2.2. Neue Arbeit und das Autonomieargument
- 2.3. Finanzierbarkeit
- 2.3.1. Die Höhe der Leistung.
- 2.3.2. Die langfristigen Kosteneinsparungen
- 2.4. Gerechtigkeit des BGE
- 2.5. Realisation und Durchsetzbarkeit
- 2.6. Ökonomische Auswirkungen
- 3. Aussichten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit befasst sich mit der Problematik der Vollbeschäftigung als sozialpolitisches Ziel und beleuchtet das Bedingungslose Grundeinkommen als alternative Lösung. Der Fokus liegt auf der Kritik an den aktuellen Arbeitsverhältnissen und der Arbeitsmarktpolitik, die zur Idee des BGE führen.
- Kritik an der Vollbeschäftigungsnorm als unrealistisches Ziel
- Das Bedingungslose Grundeinkommen als alternative Zukunftsvision
- Autonomie des Menschen als zentrales Argument für das BGE
- Finanzierbarkeit und Gerechtigkeit des BGE
- Ökonomische und gesellschaftliche Auswirkungen des BGE
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Der erste Abschnitt analysiert das Konzept der Vollbeschäftigung und stellt fest, dass diese seit den 1970er Jahren in Deutschland nicht mehr erreicht wurde. Er beleuchtet die aktuellen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt, die durch die Hartz-Reformen verschärft wurden und die Frage aufwirft, ob Vollbeschäftigung als Ziel überhaupt sinnvoll ist.
Der zweite Abschnitt untersucht das Bedingungslose Grundeinkommen als alternative Lösung. Er präsentiert das Konzept des BGE, diskutiert die Argumentation der Autonomie des Menschen und widmet sich den Fragen der Finanzierbarkeit und Gerechtigkeit.
Schlüsselwörter (Keywords)
Vollbeschäftigung, Bedingungsloses Grundeinkommen, Arbeitsmarktpolitik, Autonomie, Finanzierbarkeit, Gerechtigkeit, Ökonomische Auswirkungen, Sozialpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird das Ziel der Vollbeschäftigung in der Arbeit kritisiert?
Die Arbeit argumentiert, dass Vollbeschäftigung in der heutigen Zeit ein unrealistisches und teils unmögliches Ziel geworden ist.
Was ist das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE)?
Ein sozialpolitisches Konzept, bei dem jeder Bürger unabhängig von seiner wirtschaftlichen Lage eine gesetzlich festgelegte finanzielle Zuwendung erhält.
Was ist das Hauptargument für das BGE?
Das zentrale Pro-Argument ist die Steigerung der individuellen Autonomie und Freiheit des Menschen.
Welche Zweifel bestehen an der Finanzierbarkeit des BGE?
Kritiker befürchten hohe Kosten und die Frage, ob Menschen ohne Arbeitszwang weiterhin produktiv tätig sein würden.
Welchen Einfluss hatten die Hartz-Reformen auf die Debatte?
Die Arbeit sieht in Hartz IV einen Zeitgeist, der den Druck zur Erwerbsarbeit erhöht hat, ohne das Ziel der Vollbeschäftigung zu erreichen.
- Quote paper
- Florian Boss (Author), 2009, Die Problematik der Vollbeschäftigung als sozialpolitisches Ziel und das Bedingungslose Grundeinkommen als Alternative, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353136