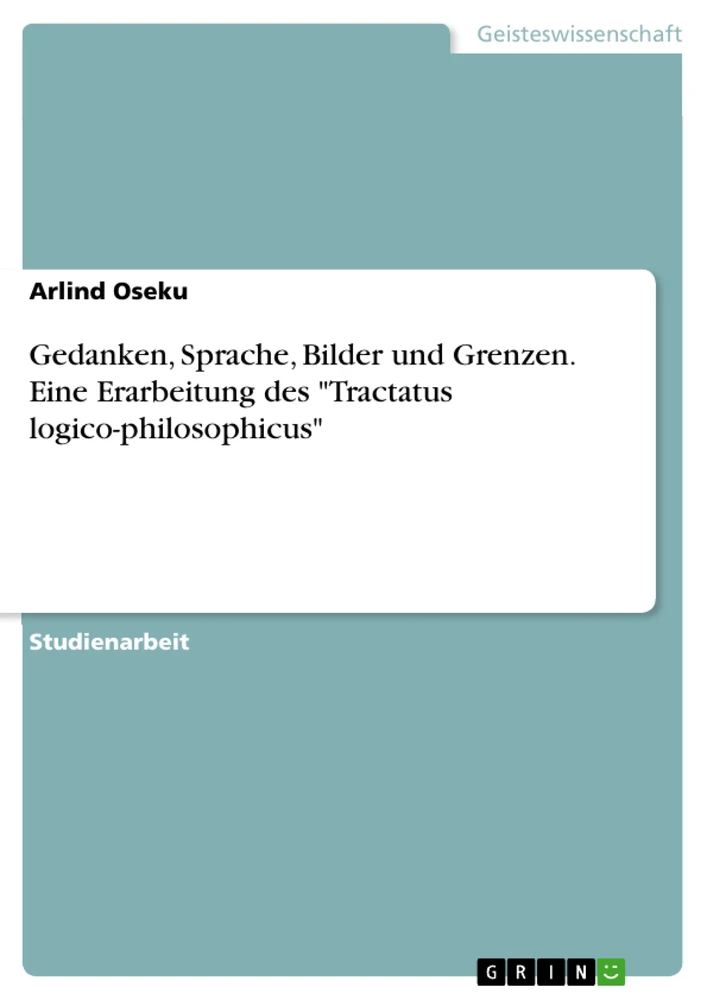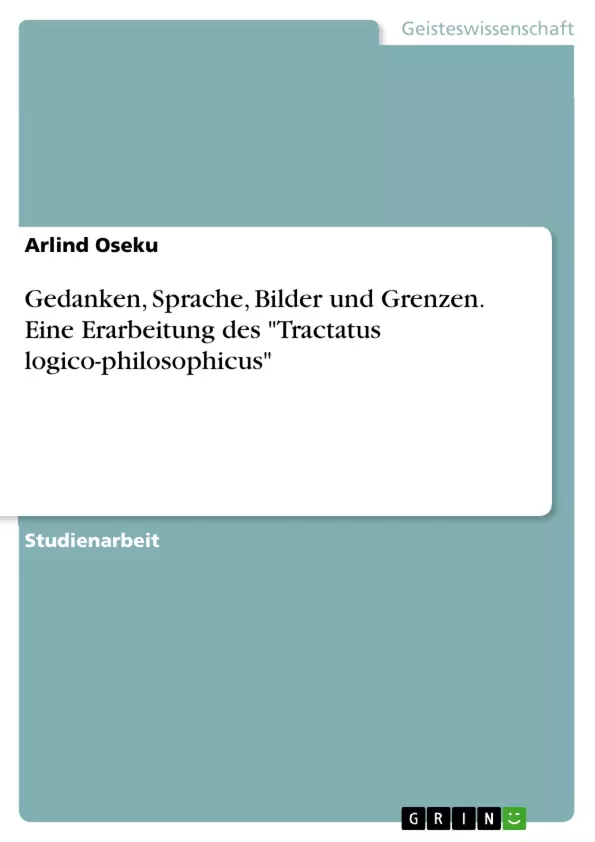Ein kurzer Blick auf die Biografie Wittgensteins soll in dieser Hausarbeit dazu dienen, zu verstehen, welche Motivationsgründe er wohlmöglich gehabt hat, den "Tractatus logico-philosophicus" zu schreiben.
Der "Tractatus logico-philosophicus" besitzt kein Inhaltsverzeichnis. Dennoch kann man anhand der Begriffe, denen sich Wittgenstein widmet und die er zu definieren versucht, Themenschwerpunkte erkennen.
Ludwig Wittgensteins erster Hauptgedanke über die Welt ist: „Die Welt ist alles, was der Fall ist“. Er bezieht sich somit auf alle Sachverhalte in der Welt. Man kann die Welt bestimmen, indem man alle Tatsachen aufzählt.
Das Bild ist ein wesentlicher Bestandteil Wittgensteins Gedanken und Grundlage seiner Abbildtheorie der Bedeutung. Die Sätze werden dadurch wahr, dass ihnen in der Welt etwas entspricht.
Wittgenstein knüpft an den dritten Hauptsatz „Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke“ an, indem er in Satz 4 schreibt: „Der Gedanke ist der sinnvolle Satz" Und mit dem folgenden Satz „Die Gesamtheit der Sätze ist die Sprache“ kommt er auf sein eigentliches Interesse im "Tractatus logico-philosophicus" zu sprechen, nämlich die Sprache.
Inhaltsverzeichnis
- Biografie
- Entstehung & Gliederung - Tractatus logico-philosophicus
- Über die Welt, Tatsachen, Gegenstände und Sachverhalte
- Über das Bild, den Satz und seinen Sinn
- Wittgensteins Bildtheorie und der Zweck der Philosophie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit soll die zentralen Ideen und Argumentationslinien des Tractatus logico-philosophicus von Ludwig Wittgenstein erarbeiten und beleuchten. Sie soll einen Einblick in Wittgensteins philosophische Grundannahmen und die zentralen Themenbereiche seiner Argumentation bieten, ohne dabei in eine detaillierte Analyse der einzelnen Argumente und Kritikpunkte einzugehen.
- Die Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit
- Die Bedeutung der Logik und der logischen Sprache
- Die Grenzen der Sprache und des Denkens
- Die Rolle der Philosophie in der Erschließung und Darstellung der Welt
- Die Kritik an traditionellen philosophischen Problemen und Denkweisen
Zusammenfassung der Kapitel
Biografie
Dieser Abschnitt bietet einen kurzen Einblick in das Leben von Ludwig Wittgenstein und beleuchtet die Einflüsse, die seine philosophischen Ansätze prägten. Es werden seine frühen Interessen an Technik, sein Studium der Mathematik und Logik sowie sein späterer Fokus auf die Philosophie beleuchtet.
Entstehung & Gliederung - Tractatus logico-philosophicus
In diesem Kapitel wird die Entstehung und Struktur des Tractatus logico-philosophicus vorgestellt. Es werden Informationen zur Entstehungszeit des Werkes, den vielfältigen Überarbeitungen und der finalen Struktur des Werkes gegeben. Wittgenstein nutzte ein deduktives Nummerierungssystem, um die Sätze des Tractatus zu ordnen und ihr logisches Gewicht hervorzuheben.
Über die Welt, Tatsachen, Gegenstände und Sachverhalte
Hier werden die grundlegenden philosophischen Konzepte Wittgensteins zur Welt und ihren Bestandteilen behandelt. Es wird erläutert, wie Wittgenstein die Welt als die Gesamtheit aller Tatsachen und Sachverhalte versteht, die aus einer Verbindung von Gegenständen bestehen. Dieser Abschnitt bildet die Grundlage für die weiteren Ausführungen des Tractatus.
Über das Bild, den Satz und seinen Sinn
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Wittgensteins Theorie des Bildes, die als Theorie der Darstellung interpretiert werden kann. Es wird die Funktion des Satzes als Bild der Wirklichkeit und die Beziehung zwischen Satz und Sinn erläutert. Wittgenstein argumentiert, dass die Sprache nur die Struktur der Welt abbilden kann und bestimmte Aspekte der Wirklichkeit nicht adäquat darstellen kann.
Schlüsselwörter
Schlüsselbegriffe des Tractatus logico-philosophicus sind: Logische Sprache, Sachverhalte, Gegenstände, Bildtheorie, Sinn, Unsinn, Sprache, Grenzen der Sprache, Philosophie, Welt, Tatsachen, Sprache, Logik, Wittgenstein.
- Arbeit zitieren
- Arlind Oseku (Autor:in), 2016, Gedanken, Sprache, Bilder und Grenzen. Eine Erarbeitung des "Tractatus logico-philosophicus", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353681