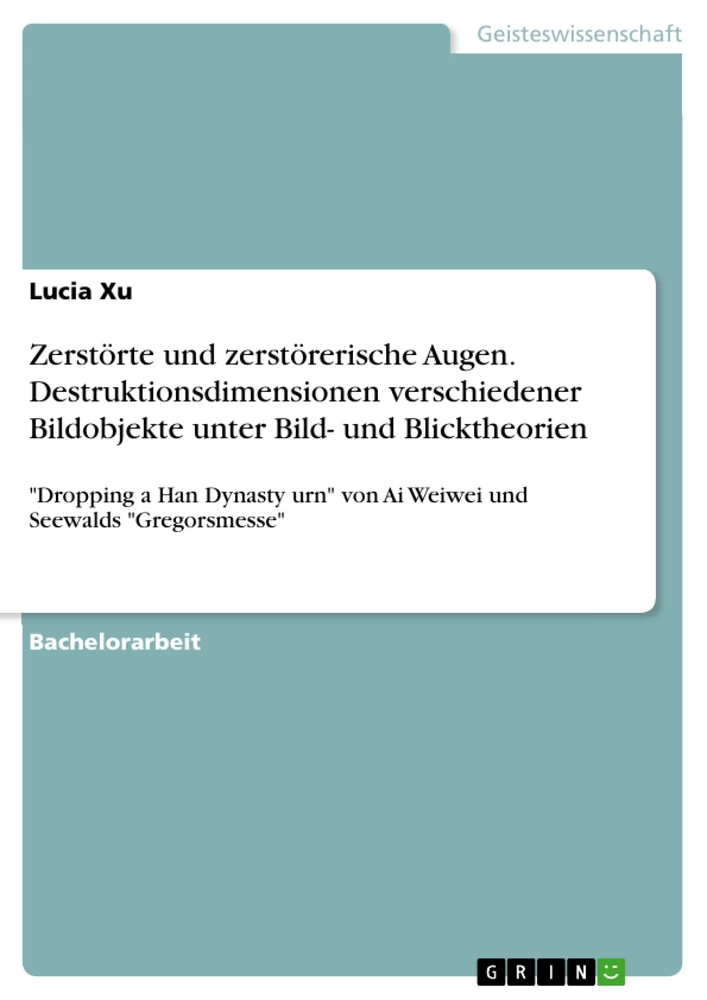Ikonoklasmen treffen, genau wie Bilder, gezielte Aussagen, denn die Information des Zerstörers wird durch das Bildmedium zugänglich gemacht. Norbert Schnitzler schreibt in Bezug auf die Bilderstürme in Norddeutschland, dass „die Täter in der Regel selektiv vorgingen und ihr Handeln spezifischen Spielregeln folgte.“ Der Bilderstürmer, so Schnitzler weiter, handele kontrolliert und wähle Bilddarstellungen gezielt aus. Der ganze ikonoklastische Akt bekommt dadurch eine demonstrative Geste und einen appellativen Charakter. Es scheint, als ob diese Beobachtungen nicht nur den norddeutschen Bildersturm beschreiben, sondern eine allgemeine Gültigkeit zumindest zu manchen Zeiten und in vielen Kulturräumen entfalten.
In dieser Arbeit geht es allerdings nicht um das allgemeine Phänomen des Ikonoklasmus, sondern um die Zerstörungsdimensionen des Blicks, die vor allem durch ikonoklastische Akte sichtbar gemacht und verarbeitet werden. Bildzerstörung bedeutet in diesem Fall, dass die Bildobjekte entstellt weiter als solche existieren. Die Zerstörung wird also sinnenfällig gemacht, anstatt das gesamte Medium zu beseitigen. Bis heute beobachten wir täglich Veränderungen von öffentlichen Bildobjekten durch das Defacing. Ausgestochene, übermalte oder ausgeschwärzte Augen sind jedoch schon sehr viel früher in ikonoklastischen Akten zu beobachten. Wofür steht diese Art der Bildzerstörung und welche Auswirkungen hat sie auf das Bild und den Betrachter?
Mit Hilfe von zwei Fallbeispielen möchte ich eine Art wissenschaftliche Hängung ähnlich wie Aby Warburg in seinem Bilderatlas durchführen und einen assoziativen Raum kreieren, indem einerseits die visuellen und andererseits die blicktheoretischen Strömungen der Bildobjekte gegenübergestellt werden sollen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Zerstörte Augen: Seewalds Gregorsmesse im Kontext des Münsteraner Bildersturms
- Repräsentation, Substitution und Vision im Bild
- Neue Symbolik der ikonographischen Sprache
- Bild und Betrachter unter dem augenlosen Blick
- Zerstörerische Augen: Ai Weiweis Dropping a Han Dynasty Urn
- Die fallende Vase
- Macht des Bildblicks
- Bild und Betrachter unter dem direkten Blick
- Interaktion der Bildobjekte
- Der Verweis auf den Körper
- Konzeptionelle Gegenüberstellung
- Ausblick: Verschiebung auf medialer Achse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Zerstörungsdimensionen des Blicks, die durch ikonoklastische Akte sichtbar werden, insbesondere im Kontext der Entstellung von Bildobjekten, bei denen die Zerstörung manifest ist, anstatt das Medium vollständig zu beseitigen. Der Fokus liegt auf der Analyse von zerstörten und zerstörerischen Augen in Bildern, die durch ikonoklastische Akte hervorgehoben werden. Durch die Gegenüberstellung von Seewalds "Gregorsmesse" und Ai Weiweis "Dropping a Han Dynasty Urn" wird eine assoziative Analyse durchgeführt, um die visuellen Strömungen und die Bedeutung des Bildblicks in Bezug auf ikonoklastische Handlungen zu untersuchen.
- Das Phänomen der Bildzerstörung und die Rolle von Augen als Zielscheibe
- Die Bedeutung von Repräsentation, Substitution und Vision in der bildlichen Kommunikation
- Der Einfluss von ikonoklastischen Akten auf die Interpretation von Bildern und die Rolle des Betrachters
- Die Auswirkungen des Bildblicks auf die Bildinterpretation und das Verständnis von Machtstrukturen
- Die medialen Verschiebungen im Kontext des Ikonoklasmus und die Bedeutung von Fotografie im Vergleich zu traditionellen Bildmedien
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel analysiert Seewalds "Gregorsmesse" im Kontext des Münsteraner Bildersturms. Es untersucht die Bedeutung der ausgestochenen Augen im Gemälde und setzt diese in Verbindung mit dem substitutiven Bildverständnis und den historischen Umständen des Gemäldes.
Das zweite Kapitel analysiert Ai Weiweis "Dropping a Han Dynasty Urn" und betrachtet den ikonoklastischen Akt des Werkes, der in einem weiteren Ikonoklasmus resultierte. Es untersucht, ob der direkte Blick des Zerstörers als Initiator eines zerstörerischen Akts verstanden werden kann und inwiefern dieser Aspekt mit dem Motiv des bösen Blicks der Medusa in Verbindung steht.
Das dritte Kapitel untersucht die Interaktion zwischen den beiden Bildobjekten und erörtert den Verweis auf den Körper, die konzeptionelle Gegenüberstellung der Werke und die Auswirkungen der medialen Verschiebung auf das Verständnis des Ikonoklasmus.
Schlüsselwörter (Keywords)
Bildzerstörung, Ikonoklasmus, Augen, Blick, Repräsentation, Substitution, Vision, Seewald, Gregorsmesse, Münsteraner Bildersturm, Ai Weiwei, Dropping a Han Dynasty Urn, Bildblick, Medusa, Körper, mediale Verschiebung, Fotografie.
- Quote paper
- Lucia Xu (Author), 2016, Zerstörte und zerstörerische Augen. Destruktionsdimensionen verschiedener Bildobjekte unter Bild- und Blicktheorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353730