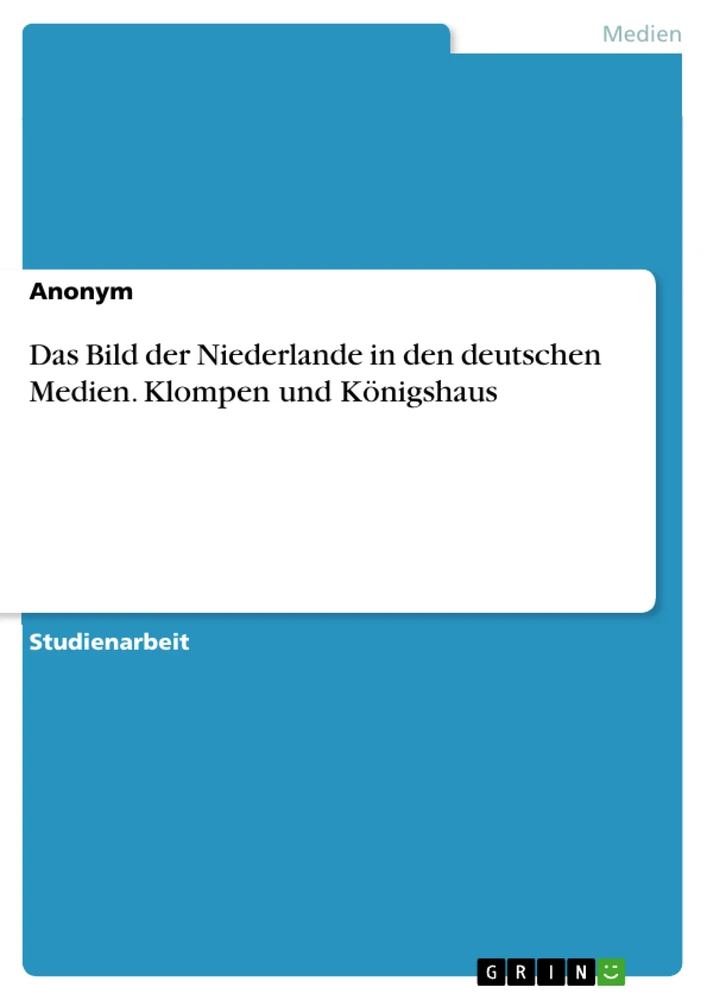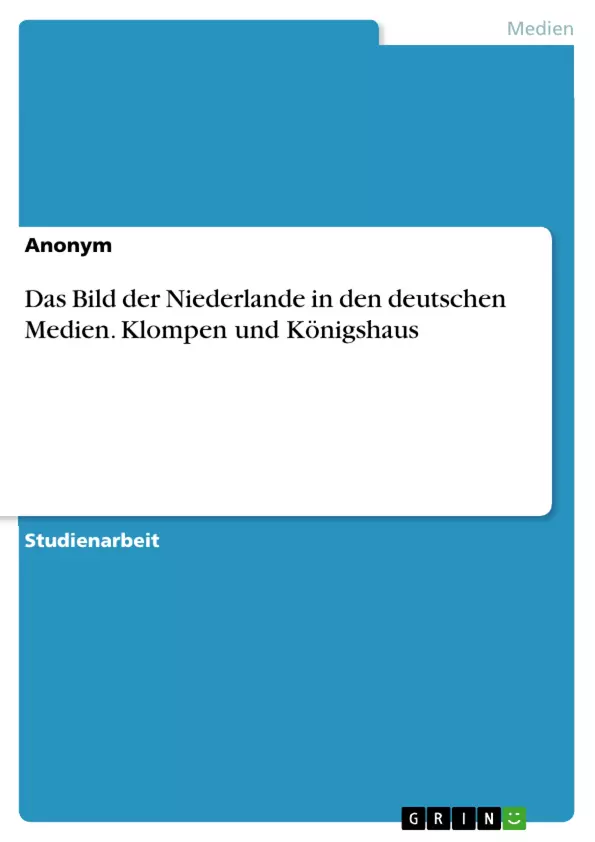In der Fachliteratur wird oft über Ressentiments geschrieben, die die Niederländer vermeintlich oder tatsächlich gegenüber den Deutschen haben. Weniger gut untersucht sind jedoch die Vorurteile der Deutschen gegenüber der Niederlande und den Niederländern. Doch auch sie bestehen – mehr oder weniger ausgeprägt – mindestens seit dem 18. Jahrhundert. Damals wie heute sind die Vorurteile natürlich nicht bei jeder Person gleichermaßen ausgeprägt. Jedoch kann man festhalten, dass die Stereotypen allgemein bekannt sind und zumindest unterbewusst einen gewissen Effekt erzeugen. Dies ist vor allem bei Deutschen zu beobachten, die keinen oder kaum Bezug zu den Niederlanden oder den Niederländern haben.
Aus der deutschen Perspektive ist die Niederlande eines von vielen Nachbarländern, welches weder als bedrohlich, noch als besonders exotisch wahrgenommen wird. Die Deutschen kennen die Niederlande vom Urlaub an der Nordsee oder der Hauptstadt Amsterdam, welche oft mit dem weniger bekannten Rest des Landes gleichgesetzt wird und aus der Werbung der niederländischen Milchwirtschaft, die den holländischen Käse mit Frau Antje nach Deutschland bringt. Weiter schätzen die Deutschen die talentierten niederländischen Fußballer und die traditionsreichen Duelle der beiden Nationalmannschaften. Lange galten die Niederlande in Deutschland gesellschaftlich und politisch als tolerant und links. Diese Wahrnehmung ist vor allem durch die Drogen-, Abtreibungs- und Sterbehilfepolitik zu erklären und wird je nach dem persönlichen politischen Standpunkt als positiv oder negativ erachtet. Dieses liberale Bild von der Niederlande verändert sich aktuell allerdings, da Berichte über die Rechtspopulisten Pim Fortuyn und Geert Wilders sowie die Ermordung des Regisseurs Theo van Gogh durch einen Islamisten für Irritationen über die vermeintlich multikulturelle Niederlande sorgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das historische Niederlandebild der Deutschen
- Die Clingendael-Studie 1993
- Beispiele aus den Medien
- "Frau Antje in den Wechseljahren"
- "Kiffen, Kicken, Käse - Unser drolliger Nachbar"
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das deutsche Bild von den Niederlanden und den Niederländern nach 1990. Sie beleuchtet die Gründe und Hintergründe für diese Bildformungen und berücksichtigt die Auswirkungen der deutschen Wiedervereinigung. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Bildes im Kontext gesellschaftlicher und politischer Veränderungen.
- Das historische deutsche Niederlandebild
- Die Clingendael-Studie als Schlüsselereignis
- Die Darstellung der Niederlande in deutschen Medien
- Der Einfluss von Stereotypen und Vorurteilen
- Die Diskrepanz zwischen Bild und Realität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach dem deutschen Bild von den Niederlanden und den Niederländern nach 1990. Sie betont die Bedeutung der Untersuchung von Vorurteilen und Stereotypen und deren Einfluss auf die Wahrnehmung. Die Autorin hebt die Bedeutung der deutschen Wiedervereinigung als Wendepunkt hervor und erläutert die Notwendigkeit einer aktuellen Betrachtung des Themas aufgrund der veränderten politischen und gesellschaftlichen Landschaft.
Das historische Niederlandebild der Deutschen: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über das deutsche Niederlandebild, beginnend mit Zitaten von Immanuel Kant, Ernst Moritz Arndt, Ludolf Wienbarg und Georg Forster. Es zeigt, dass bereits im 18. und 19. Jahrhundert etablierte Stereotype über die Niederländer existierten, die von Ordentlichkeit und Fleiß bis hin zu Starrheit und Geiz reichten. Diese historischen Perspektiven verdeutlichen die Kontinuität bestimmter Vorurteile über die Jahrhunderte hinweg und legen die Grundlage für die Analyse des modernen Bildes.
Die Clingendael-Studie 1993: Dieses Kapitel analysiert die Clingendael-Studie von 1993, die das niederländische Deutschlandbild untersuchte. Obwohl der Fokus zunächst auf dem niederländischen Blick auf Deutschland liegt, wird die Bedeutung dieser Studie für das deutsche Selbstbild und die deutsch-niederländischen Beziehungen hervorgehoben. Die Studie initiierte einen Transformationsprozess und rief gesellschaftliche und politische Reaktionen in Deutschland hervor, um das eigene Image im Nachbarland zu verbessern. Der wechselseitige Einfluss der beiden Bilder wird betont, wobei die Medien eine wichtige Rolle in der Gestaltung der Fremdwahrnehmung und des deutschen Niederlandebildes spielten.
Beispiele aus den Medien: Dieses Kapitel präsentiert zwei Beispiele aus deutschen Medien, die das deutsche Niederlandebild widerspiegeln: einen Artikel des "Spiegel" (1994) mit einer eher negativen Darstellung und einen Artikel des "Stern" (2008) mit einer positiveren Sichtweise. Die Analyse dieser Beispiele, inklusive der dazugehörigen Karikaturen und Cover, ermöglicht eine vertiefte Untersuchung der Entwicklung des deutschen Niederlandebildes in den Medien und dessen Fluktuation zwischen positiven und negativen Perspektiven.
Schlüsselwörter
Niederlandebild, Deutschlandbild, Vorurteile, Stereotype, Clingendael-Studie, Medien, deutsch-niederländische Beziehungen, historische Wahrnehmung, gesellschaftliche Wahrnehmung, politische Wahrnehmung, Wiedervereinigung.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Das deutsche Bild der Niederlande nach 1990
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das deutsche Bild von den Niederlanden und den Niederländern nach 1990. Sie analysiert die Entstehung dieses Bildes, die zugrundeliegenden Gründe und Hintergründe sowie den Einfluss der deutschen Wiedervereinigung. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Bildes im Kontext gesellschaftlicher und politischer Veränderungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das historische deutsche Niederlandebild, die Bedeutung der Clingendael-Studie von 1993, die Darstellung der Niederlande in deutschen Medien, den Einfluss von Stereotypen und Vorurteilen sowie die Diskrepanz zwischen Bild und Realität. Es werden sowohl positive als auch negative Aspekte des deutschen Niederlandebildes beleuchtet.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf historische Quellen (z.B. Schriften von Kant, Arndt, Wienbarg und Forster), die Clingendael-Studie von 1993 und Beispiele aus deutschen Medien (z.B. Spiegel und Stern), inklusive deren Karikaturen und Cover. Die Analyse dieser Quellen ermöglicht eine umfassende Untersuchung der Entwicklung des deutschen Niederlandebildes.
Wie wird das historische deutsche Niederlandebild dargestellt?
Das Kapitel zum historischen Niederlandebild zeigt, dass bereits im 18. und 19. Jahrhundert etablierte Stereotype über die Niederländer existierten, die von Ordentlichkeit und Fleiß bis hin zu Starrheit und Geiz reichten. Dies verdeutlicht die Kontinuität bestimmter Vorurteile über die Jahrhunderte hinweg.
Welche Rolle spielt die Clingendael-Studie?
Die Clingendael-Studie von 1993, obwohl primär auf das niederländische Deutschlandbild fokussiert, wird als Schlüsselereignis für das deutsche Selbstbild und die deutsch-niederländischen Beziehungen betrachtet. Sie initiierte einen Transformationsprozess und gesellschaftliche Reaktionen in Deutschland, um das eigene Image in den Niederlanden zu verbessern.
Wie werden Medien dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Darstellung der Niederlande in deutschen Medien anhand von Beispielen aus dem Spiegel (1994) und dem Stern (2008), die unterschiedliche, sowohl positive als auch negative Perspektiven zeigen. Die Analyse der Medienbeiträge verdeutlicht die Fluktuation des deutschen Niederlandebildes im Laufe der Zeit.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die Entwicklung des deutschen Niederlandebildes nach 1990, den Einfluss von Stereotypen und Vorurteilen und die Bedeutung der Medien in der Gestaltung dieses Bildes. Sie beleuchtet die komplexen Beziehungen zwischen historischer Wahrnehmung, gesellschaftlicher und politischer Wahrnehmung sowie der deutschen Wiedervereinigung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Niederlandebild, Deutschlandbild, Vorurteile, Stereotype, Clingendael-Studie, Medien, deutsch-niederländische Beziehungen, historische Wahrnehmung, gesellschaftliche Wahrnehmung, politische Wahrnehmung, Wiedervereinigung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Das Bild der Niederlande in den deutschen Medien. Klompen und Königshaus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353773