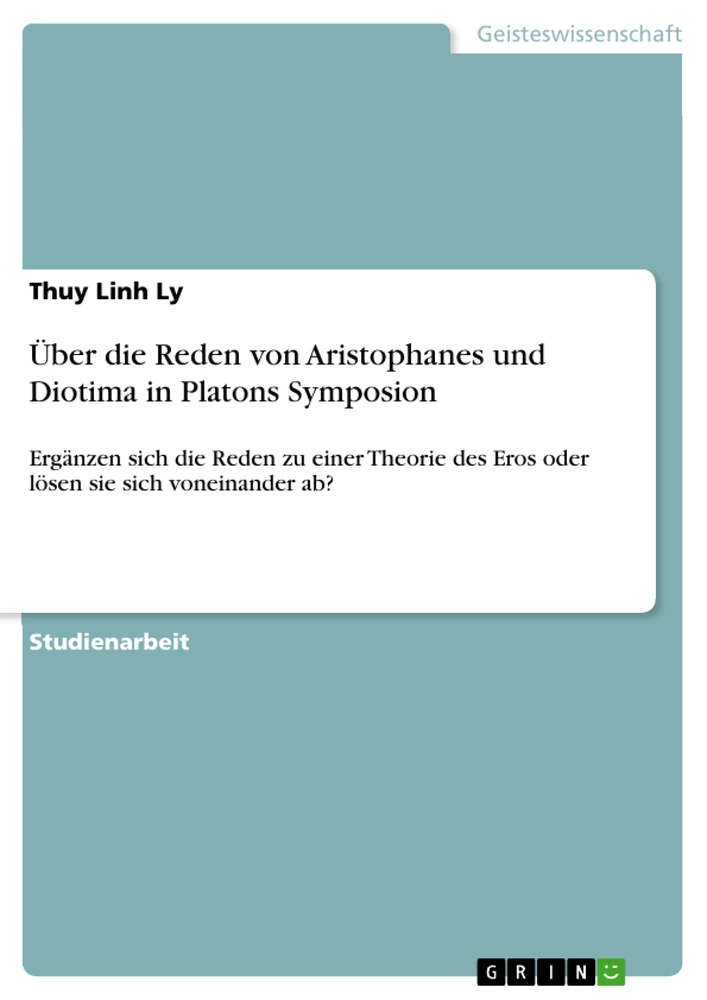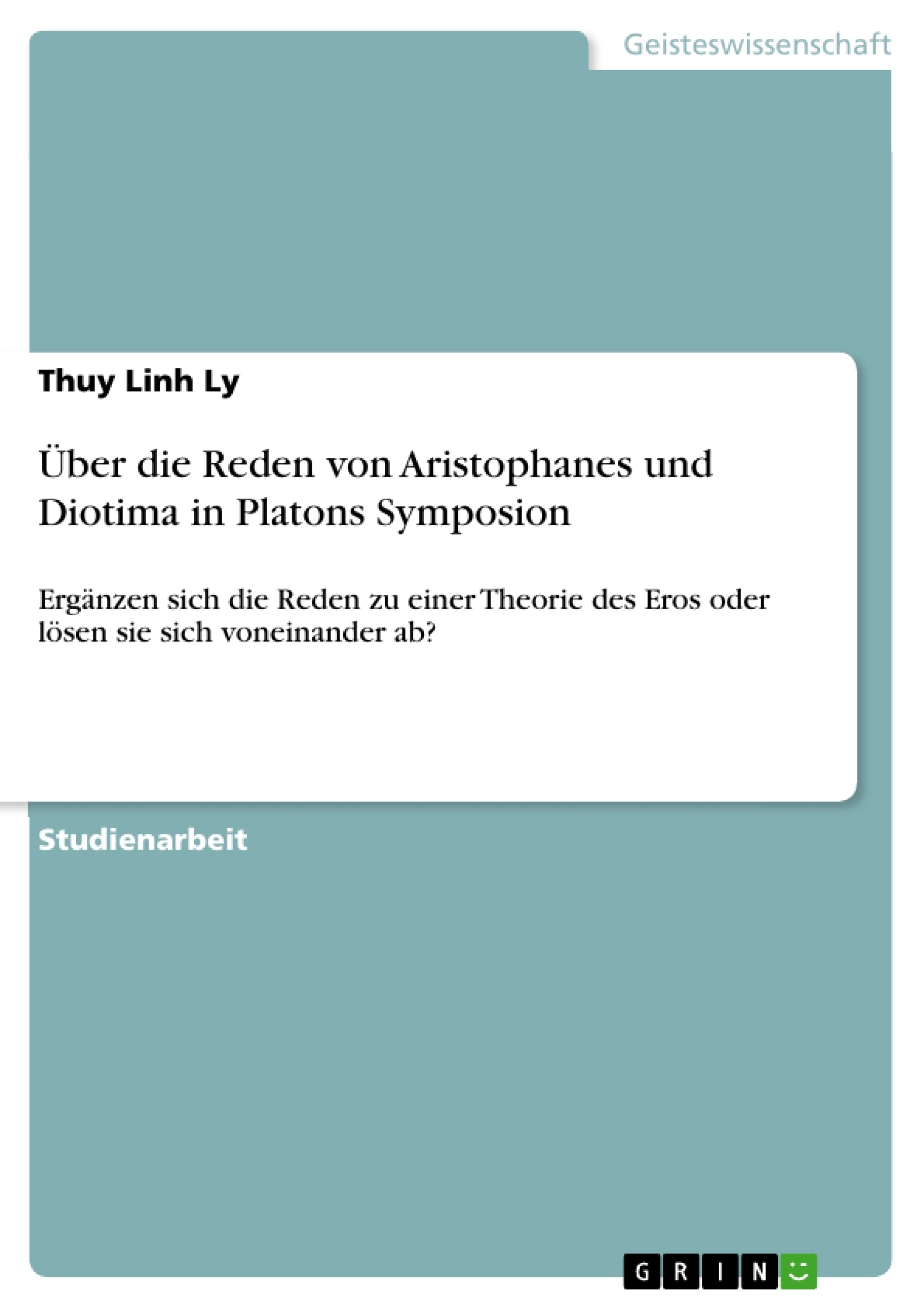Zu Ehren des Tragödiendichters Agathon findet das „Symposion“, auch bekannt als „das Gastmahl“, statt. Dieses Gastmahl unterscheidet sich jedoch deutlich von den gewöhnlichen Trinkgelagen: Die Flötenspielerin soll nicht auftreten und auch auf das große Trinken wird verzichtet, um sich den ernsten Gesprächen widmen zu können. So wird schließlich auf Wunsch des Eryximachos, und mit Zustimmung der anderen Gäste, beschlossen, dass alle Teilnehmer des Gastmahls Lobreden auf den Eros halten sollen.
Die folgende Arbeit beschäftigt sich hierbei mit den Reden des Aristophanes und des Sokrates bzw. der Diotima. Thematisiert wird das Verhältnis zwischen diesen beiden Reden, um dann zu diskutieren, ob sich die Reden zu einer Theorie des Eros ergänzen oder sie sich eher voneinander ablösen.
Die Arbeit beginnt mit einer ausführlichen Darstellung der beiden Reden, um zunächst einmal eine Grundlage für die spätere Diskussion zu schaffen. Nach dieser Darstellung werden Ausführungen von Bernd Manuwald und Alessandra Fussi dargelegt, die genau auf das Verhältnis zwischen diesen beiden Reden eingehen. Hierbei wird sowohl auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Reden als auch auf Kritikpunkte eingegangen. Mithilfe dieser Ausführungen wird dann im folgenden Schritt diskutiert, wie die beiden Reden zueinander stehen. So wird der Frage nachgegangen, ob sich die beiden Reden zu einer Theorie des Eros ergänzen oder sie sich doch eher voneinander ablösen. Im letzten Schritt dieser Arbeit kommt es zu einem abschließenden Fazit.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Die Rede des Aristophanes
- Einbettung in den Kontext
- Über die Natur des Menschen
- Konsequenzen für das heutige Leben
- Die Rede der Diotima
- Einbettung in den Kontext
- Das Wesen des Eros
- Über das Streben des Eros
- Das Verlangen nach Unsterblichkeit
- Der Aufstieg zur Schau des Schönen
- Das Verhältnis der beiden Reden
- Ergänzung oder Unvereinbarkeit?
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit analysiert die Reden des Aristophanes und des Sokrates (vertreten durch Diotima) im Platonschen Symposion und untersucht, ob sich diese Reden zu einer Theorie des Eros ergänzen oder ob sie sich voneinander ablösen. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Reden und der Analyse ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
- Die Natur des Eros im Kontext der beiden Reden
- Die philosophischen Ansätze des Aristophanes und Diotimas
- Das Verhältnis der Reden zu einer Theorie des Eros
- Die Bedeutung der Reden für die philosophische Auseinandersetzung mit dem Eros
- Die Relevanz des Eros für das heutige Leben
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Verhältnis der Reden von Aristophanes und Diotima im Symposion. Anschließend wird der methodische Aufbau der Arbeit erläutert.
Kapitel 2 beleuchtet die Rede des Aristophanes. Zunächst wird die Rede in den Kontext des Symposions eingebunden, indem der Auftritt des Aristophanes und die Vorgeschichte seiner Rede dargestellt werden. Anschließend wird die Rede des Aristophanes selbst analysiert, die sich mit der Natur des Menschen und der Entstehung des Eros auseinandersetzt.
Kapitel 3 widmet sich der Rede der Diotima. Hierbei wird zunächst die Einbettung der Rede in den Kontext des Symposions dargestellt. Es folgt eine ausführliche Analyse der Rede, die das Wesen des Eros sowie seine Entwicklung und sein Streben nach Unsterblichkeit behandelt. Die Rede der Diotima gipfelt in der Darstellung des Aufstiegs zur Schau des Schönen.
Kapitel 4 behandelt das Verhältnis der Reden von Aristophanes und Diotima. Hierbei wird die Frage nach der Ergänzung oder Unvereinbarkeit der Reden aufgeworfen und diskutiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Platon, Symposion, Eros, Aristophanes, Diotima, Liebe, Philosophie, Theorie des Eros, Geschlechter, Seelenverwandtschaft, Aufstieg zur Schau des Schönen
- Quote paper
- Thuy Linh Ly (Author), 2016, Über die Reden von Aristophanes und Diotima in Platons Symposion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353788