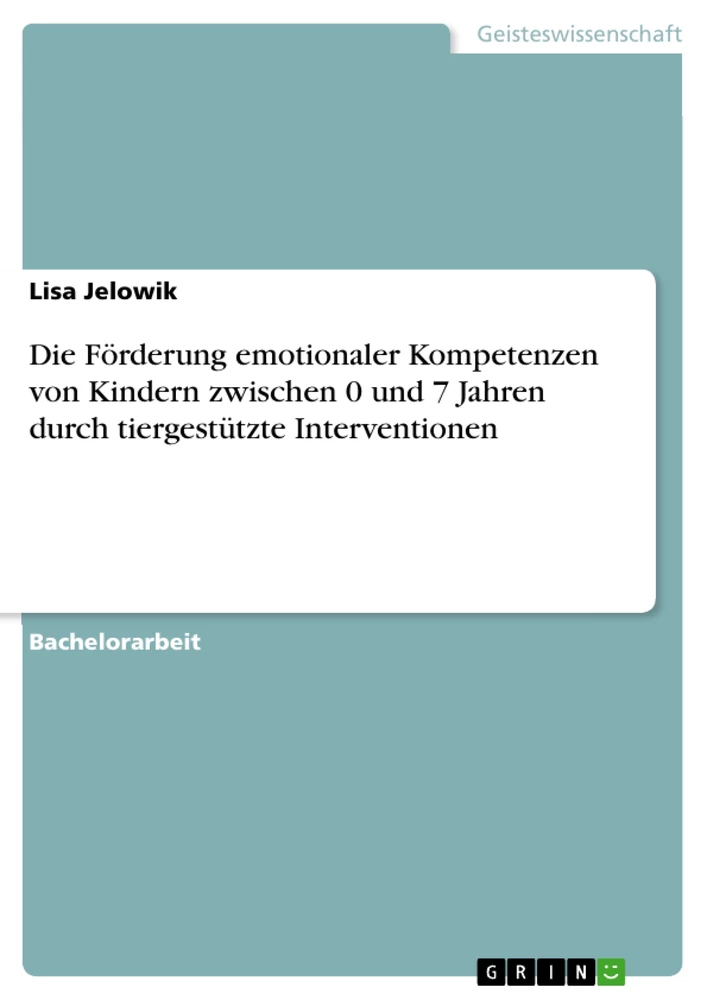Schon seit jeher ist die Beziehung zu Tieren für den Menschen von großer Bedeutung. Sie wurden mal vergöttert und mal geächtet, aber sie beeinflussten den Menschen schon immer. Grund für die starke und auf Gegenseitigkeit beruhende Bindung zwischen Mensch und Tier ist die gut zueinander passende soziale Veranlagung. Mensch und Tier „teilen speziesübergreifende, konservative Hirnstrukturen und ähnliche Prinzipien der Verhaltensorganisation; sie verfügen über vergleichbare Bindungsmechanismen und emotionale Systeme; sie haben ein ähnliches Stressmanagement und ähnliche Persönlichkeitsvariabilitäten“ (Saumweber 2009).
Die Begegnung mit einem Tier kann sich positiv auf unsere Lebensqualität auswirken. Dabei ist weniger das Tier an sich entscheidend, sondern vielmehr die freie Begegnung und der Dialog mit diesem, denn dadurch werden Emotionen und Hormone angesprochen und ein Impuls für einen möglichen heilenden Prozess gesetzt. Wie dies bewusst in der Sozialpädagogik eingesetzt und durch die / den SozialpädagogIn unterstützt werden kann, soll diese Arbeit klären. Dabei wird zunächst die Entwicklung der emotionalen Kompetenzen geschildert, um anschließend die Wirkungsweise tiergestützter Interventionen zu beschreiben. Darauf aufbauend wird speziell die Förderung emotionaler Kompetenzen durch tiergestützte Interventionen erläutert, was abschließend in einer Fall- und Feldanalyse auf die Praxis bezogen wird. Dabei ist es auch ein Anliegen dieser Arbeit, zu zeigen, wie die theoretischen Überlegungen und Forschungsergebnisse in der Praxis umgesetzt werden können und welche Herausforderungen sich dadurch möglicherweise ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Emotionale Kompetenzen
- Definition emotionaler Kompetenzen
- Abgrenzung zu sozialen Kompetenzen
- Entwicklung emotionaler Kompetenzen
- Empathie
- tiergestützte Interventionen
- Definition tiergestützter Interventionen
- Wirkungsspektrum tiergestützter Interventionen auf Kinder
- Die Wahl des Tieres
- Bedeutung der Beziehung zwischen Tier, KlientIn und SozialpädagogIn
- Förderung emotionaler Kompetenzen
- Methoden zur Förderung emotionaler Kompetenzen durch tiergestützte Interventionen
- Auswirkungen der tiergestützten Interventionen auf emotionale Kompetenzen
- Einschränkungen der tiergestützten Interventionen
- Fall - und Feldanalyse
- Forschungsdesign
- Untersuchungsziel
- Methode und Auswertungsverfahren
- Interview
- Entwicklung und Aufbau des Leitfadens
- Stichprobe
- Ablauf und Durchführung
- Auswertungsverfahren
- Transkription des Interviews
- qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010)
- Entwicklung des Kategoriensystems
- Vorstellung der Ergebnisse
- emotionale Kompetenzen
- Definition und Bedeutung emotionaler Kompetenzen
- Unterschiede in den sozio- emotionalen Kompetenzen
- tiergestützte Interventionen
- Bedeutung tiergestützter Interventionen
- Methoden tiergestützter Interventionen
- Auswirkungen tiergestützter Interventionen auf emotionale Kompetenzen
- Einschränkungen tiergestützter Interventionen
- Wahl des Tieres
- weitere Auswirkungen tiergestützter Interventionen auf Kinder
- emotionale Kompetenzen
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- kritische Reflexion des Interviews und der Auswertung
- Forschungsdesign
- Diskussion und Kritik
- Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Förderung emotionaler Kompetenzen von Kindern im Alter zwischen 0 und 7 Jahren durch tiergestützte Interventionen. Die Arbeit untersucht, wie tiergestützte Interventionen in der Praxis umgesetzt werden, welche Auswirkungen sie auf die emotionale Entwicklung haben und welche Herausforderungen sich dabei stellen.
- Die Bedeutung emotionaler Kompetenzen für die soziale Entwicklung von Kindern
- Die verschiedenen Arten und Methoden tiergestützter Interventionen
- Die Auswirkungen tiergestützter Interventionen auf emotionale Kompetenzen, wie z.B. Empathie, Selbstregulation und Sozialverhalten
- Die Herausforderungen und Chancen der tiergestützten Pädagogik in der Praxis
- Die Rolle der Tiere als Co-Pädagogen in der Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung der Mensch-Tier-Beziehung und den aktuellen Stand der Forschung zur Förderung emotionaler Kompetenzen beleuchtet. Anschließend wird im zweiten Kapitel der Begriff der emotionalen Kompetenz definiert und die Entwicklung sowie die Abgrenzung zu sozialen Kompetenzen erläutert. Kapitel drei beschäftigt sich mit tiergestützten Interventionen. Es wird definiert, was unter tiergestützter Aktivität, Pädagogik und Therapie verstanden wird und wie die jeweiligen Methoden eingesetzt werden. Außerdem werden die Wirkungen von tiergestützten Interventionen auf Kinder im Allgemeinen sowie die Bedeutung der Beziehung zwischen Tier, KlientIn und SozialpädagogIn beschrieben. Kapitel vier behandelt die Förderung emotionaler Kompetenzen durch tiergestützte Interventionen. Es werden Methoden zur Förderung, wie z.B. die freie, gelenkte und ritualisierte Interaktion sowie die Gruppenarbeit, beschrieben und es wird untersucht, welche Auswirkungen diese auf die emotionale Entwicklung haben. Kapitel fünf enthält eine Fall- und Feldanalyse, in der anhand eines Interviews mit einer ehemaligen Leiterin einer Kinder- und Jugendfarm untersucht wird, wie tiergestützte Interventionen in der Praxis umgesetzt werden. Die Ergebnisse des Interviews werden mit der Literatur verglichen und kritisch diskutiert. Die Arbeit endet mit einer Diskussion und Kritik der Ergebnisse, die die Bedeutung von weiteren Forschungsprojekten und einer einheitlichen Ausbildung für die Durchführung tiergestützter Interventionen hervorhebt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie emotionaler Kompetenz, tiergestützte Interventionen, Pädagogik, Therapie, Empathie, Selbstregulation, Sozialverhalten, Co-Pädagogen, Mensch-Tier-Beziehung, Praxis, Herausforderungen, Chancen.
- Citation du texte
- Lisa Jelowik (Auteur), 2017, Die Förderung emotionaler Kompetenzen von Kindern zwischen 0 und 7 Jahren durch tiergestützte Interventionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/353971