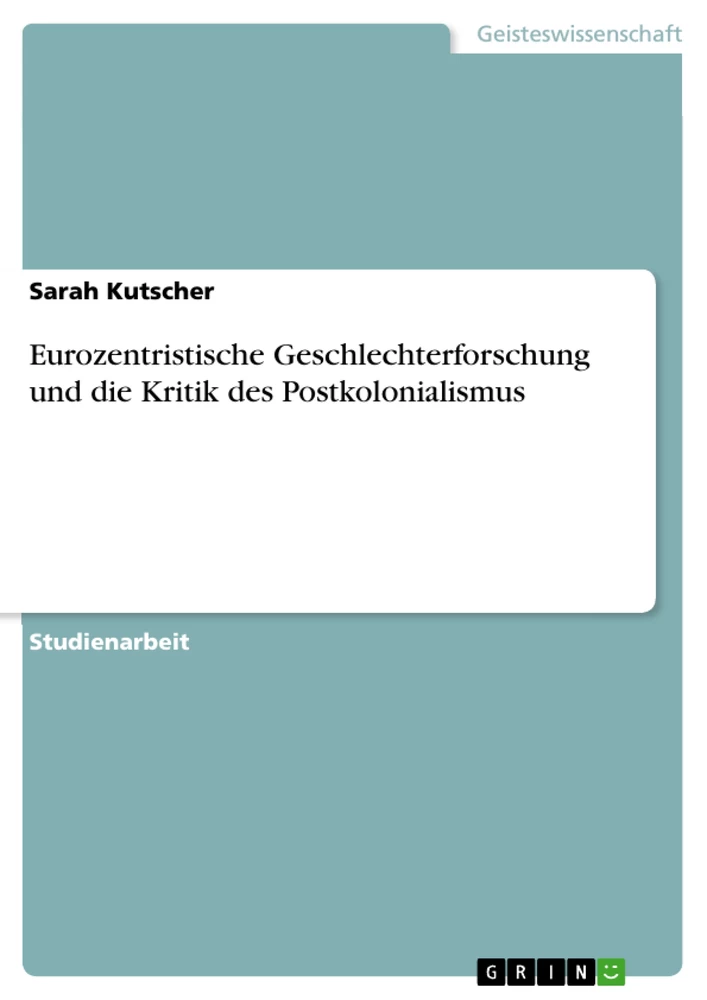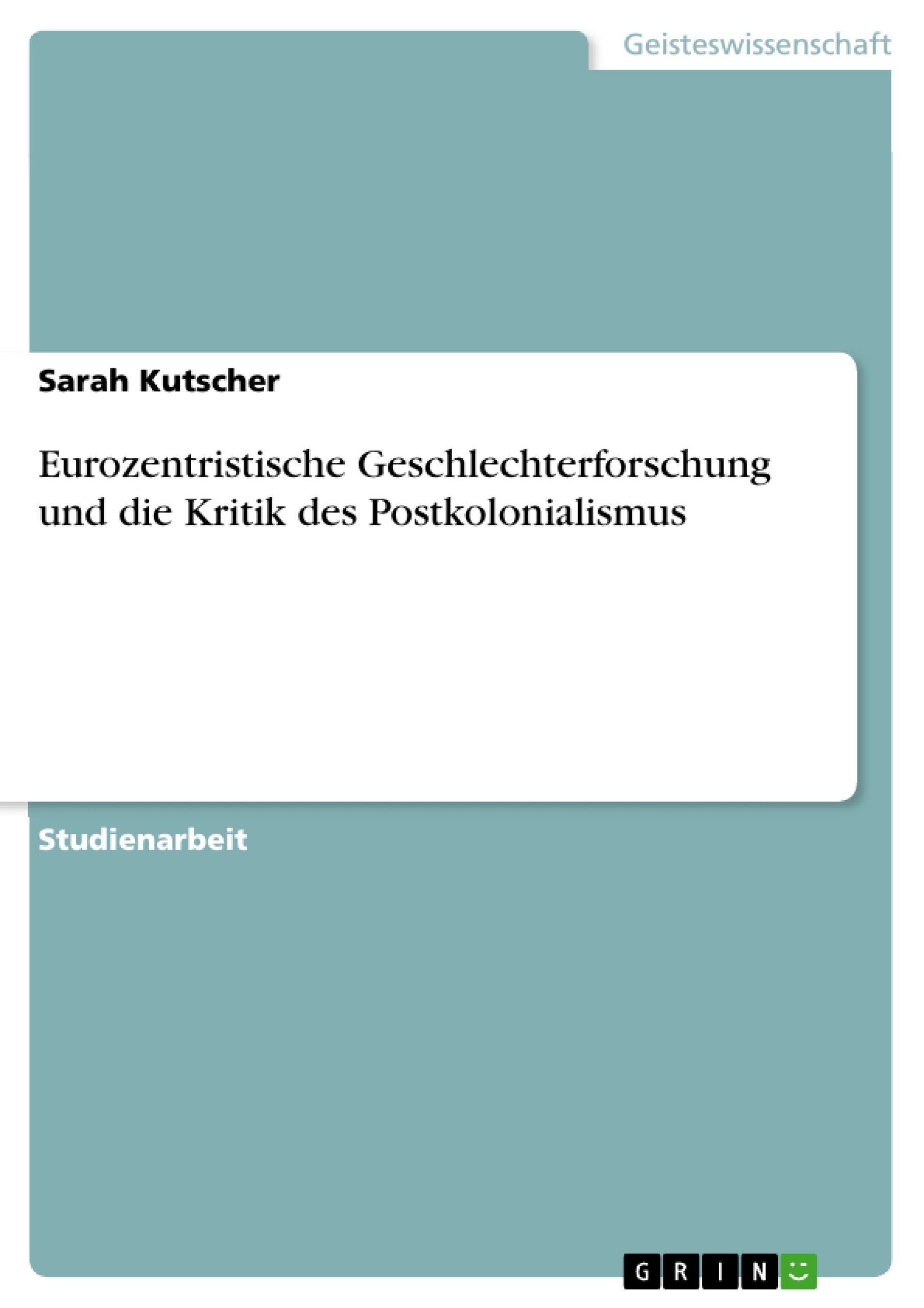Gerhard Hauck beschäftigt sich in der Einleitung zu seinem Buch „Die Gesellschaft und ihr Anderes“ mit der Problematik des Eurozentrismus in den Sozialwissenschaften. Er kritisiert die Vorgehensweisen und die eingeschränkten Perspektiven der heutigen westlichen Forschung vor allem in Bezug auf andere Kulturen. „Sie [die Forscher/ Sozialwissenschaftler] implantieren den Handlungen der Menschen, die sie untersuchen, ungeprüft und unhinterfragt den Sinn, den sie selbst entsprechend den Festlegungen ihrer eigenen Kultur in ihnen sehen[…]“ (Hauck, 2003 S. 12f) Das bedeutet, dass Wissenschaftler ihre Forschung unreflektiert und unkritisch in ihre Theorien umwandeln und diese dann auf die gesamte Welt übertragen.
Ob dieser von Hauck eingebrachte Vorwurf auch auf die Geschlechterforschung beziehungsweise auf Teile der Geschlechterforschung zu übertragen ist, damit wird sich diese Arbeit beschäftigen. Zuerst wird in der Arbeit das Konzept des Eurozentrismus vorgestellt, dabei wird auch auf den konzeptuellen Gegenpart, den Ethnozentrismus eingegangen. Anschließend soll die Forschungsfrage „Tritt in der modernen Geschlechterforschung Eurozentrismus ebenfalls auf?“ beantwortet werden.
Hierbei kann allerdings nur ein Teil der Geschlechterforschung untersucht werden, da es ansonsten den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Eine Untersuchung der gesamten Geschlechterforschung ist auch nicht nötig, da nur das Auftreten, nicht aber das Ausmaß des Eurozentrismus untersucht werden soll.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Eurozentrismus
- Definition Eurozentrismus
- Auftreten des Eurozentrismus in der Geschlechterforschung
- Eurozentristische Geschlechterforschung
- Postkoloniale Kritik an der Eurozentristischen Geschlechterforschung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit untersucht das Auftreten von Eurozentrismus in der Geschlechterforschung und betrachtet dabei die Kritik des Postkolonialismus. Sie analysiert, ob und inwiefern die Geschlechterforschung von eurozentrischen Perspektiven geprägt ist und wie dies von postkolonialen Theoretikern kritisiert wird.
- Definition und Abgrenzung von Eurozentrismus und Ethnozentrismus
- Analyse des Eurozentrismus in der Geschlechterforschung
- Kritik des Postkolonialismus an der eurozentristischen Geschlechterforschung
- Postkoloniale Ansätze zur Überwindung des Eurozentrismus
- Die Konstruktion von Geschlechterbildern und die Rolle des Postkolonialismus
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema Eurozentrismus in den Sozialwissenschaften ein und stellt die Forschungsfrage nach seinem Auftreten in der Geschlechterforschung. Das zweite Kapitel erläutert das Konzept des Eurozentrismus, definiert ihn, grenzt ihn vom Ethnozentrismus ab und untersucht seine Hauptmerkmale, wie Universalität und Überlegenheitscharakter.
Das dritte Kapitel fokussiert auf den Eurozentrismus in der Geschlechterforschung und beleuchtet, wie eurozentristische Tendenzen zu Geschlechtsbildern führen, die als universal gültig gelten. Im vierten Kapitel wird die postkoloniale Kritik an der eurozentristischen Geschlechterforschung erörtert. Arbeiten von Spivak, Mohanty und anderen Autorinnen werden analysiert, die auf die Problematik des Eurozentrismus im Kontext von Gender hinweisen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Eurozentrismus, Ethnozentrismus, Geschlechterforschung, Postkolonialismus, Kritik, Universalität, Überlegenheitscharakter, Geschlechtsbilder, Dritte-Welt-Frau, Subaltern, Feminismus, Feministische Wissenschaftskritik, Epistemologie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Eurozentrismus in der Forschung?
Eurozentrismus beschreibt die unkritische Übertragung westlicher kultureller Maßstäbe und Theorien auf die gesamte Welt.
Wie äußert sich Eurozentrismus in der Geschlechterforschung?
Indem westliche Vorstellungen von Geschlechterrollen und Emanzipation als universell gültig betrachtet werden, ohne lokale kulturelle Kontexte zu berücksichtigen.
Was ist die postkoloniale Kritik an diesem Ansatz?
Postkoloniale Theoretikerinnen kritisieren, dass die Erfahrungen von Frauen im globalen Süden oft ignoriert oder durch eine westliche "Brille" verzerrt dargestellt werden.
Was bedeutet der Begriff "Dritte-Welt-Frau" in der Kritik?
Chandra Mohanty kritisiert, dass westliche Forschung Frauen im globalen Süden oft als homogene, unterdrückte Gruppe ohne eigene Handlungsmacht (Agency) konstruiert.
Was ist der Unterschied zwischen Eurozentrismus und Ethnozentrismus?
Ethnozentrismus ist die allgemeine Neigung, die eigene Gruppe als Zentrum zu sehen; Eurozentrismus ist die spezifisch westliche Machtform dieses Denkens.
Welche Rolle spielt Gayatri Spivak in dieser Debatte?
Spivak prägte den Begriff der "Subalternen" und hinterfragt, ob die marginalisierten Gruppen innerhalb eurozentrischer wissenschaftlicher Diskurse überhaupt "sprechen" können.
- Citation du texte
- Sarah Kutscher (Auteur), 2014, Eurozentristische Geschlechterforschung und die Kritik des Postkolonialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354046