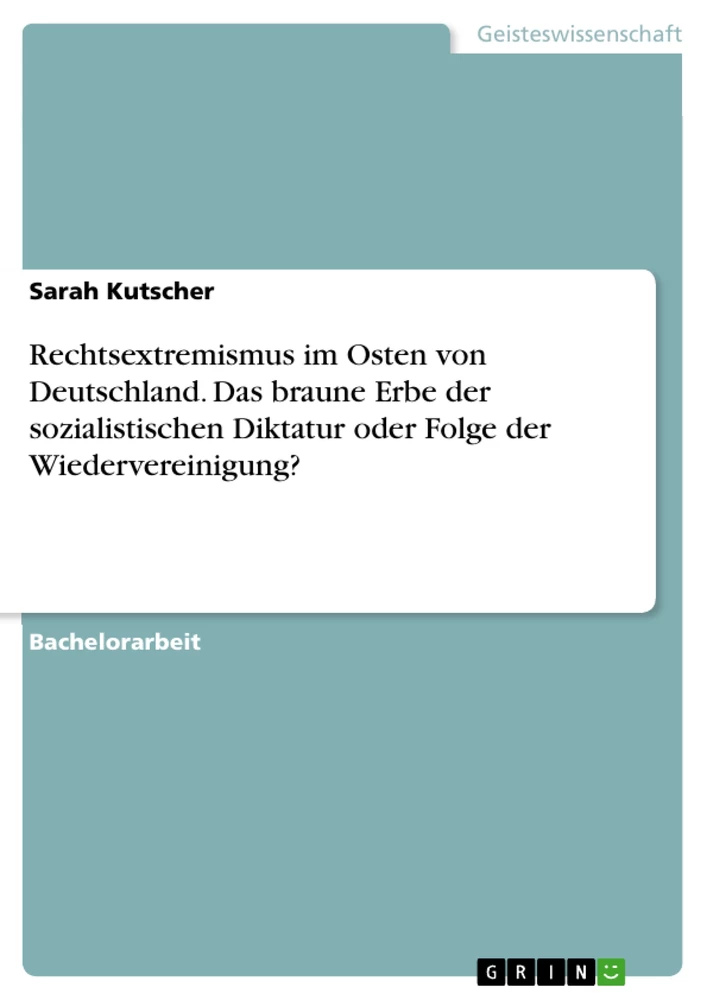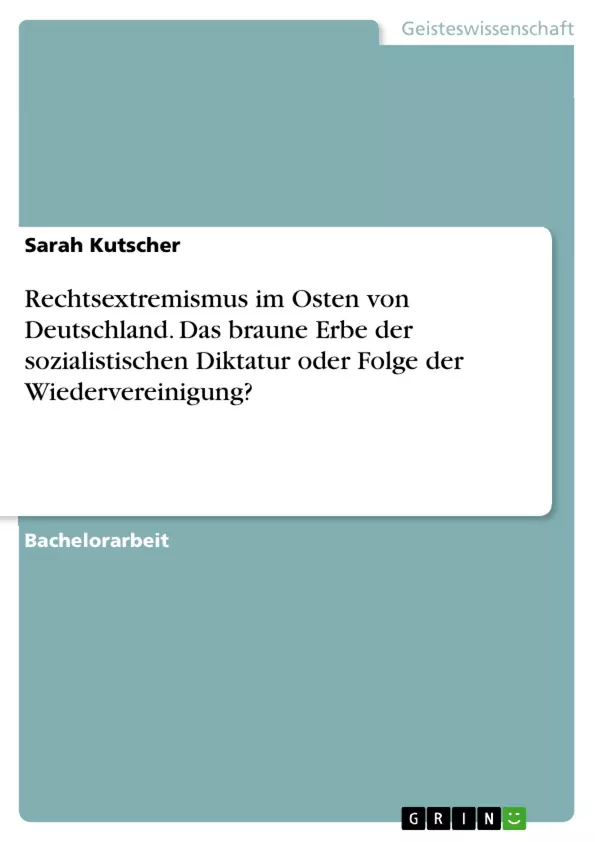Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Eberswalde, Cottbus, Hünxe, Mölln, Solingen etc. – die Liste der Orte, die Anfang der 1990er Jahre traurige Berühmtheit erlangten, ist lang. Gerade die Jahre, die für Deutschland eigentlich Hoffnung und Freude bedeuten sollten, da ab diesem Zeitpunkt „zusammenwächst, was zusammen gehört“ (Willy Brandt), wurden von Gewalttaten, Hass, Wut, Trauer, Fremdenfeindlichkeit und Hilflosigkeit überschattet. Warum ereignen sich diese Übergriffe so häufig in Ostdeutschland, obwohl sich die DDR als einziger deutscher antifaschistischer Staat definierte?
Den Schwerpunkt meiner Arbeit setze ich auf diesen Aspekt. Im Kontext wird erörtert, ob die rechtsextreme Orientierung von Menschen in Ostdeutschland das Erbe der sozialistischen Diktatur in der DDR oder das Ergebnis der neuen Lebensumstände nach der Wiedervereinigung ist.
Kamen die Ausschreitungen, die Deutschland in Angst versetzten und auch in der Welt die Angst entfachten, dass das vereinigte Deutschland erneut zum Nationalismus zurück kehrt, tatsächlich überraschend? Oder war ‚die Wende‘ nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte?
Um diese Frage beantworten zu können, muss als erstes der Begriff ‚Rechtsextremismus‘ geklärt und definiert werden. Daran anschließend werden die Entstehungstheorien erörtert, wobei sich aus programmatischen Gründen auf die drei einschlägigsten konzentriert wird. Dabei handelt es sich um die Theorien der sozialen Desintegration, der relativen Deprivation und die Autoritarismus-Theorie, die in der vorliegenden Arbeit kontrastiv gegenübergestellt werden.
Der dritte Teil geht auf die ‚Erblast-These‘ ein, bei der die sozialen Lebensbedingungen, der staatlich verordneten Antifaschismus und die Situation der AusländerInnen in der DDR erläutert und analysiert werden. Hierfür wurden im Vorfeld Interviews mit ehemaligen DDR-BürgerInnen geführt. Im vierten Teil der Arbeit wird die ‚Wiedervereinigungsthese‘ anhand von rechtsextremen Kampagnen und dem „Arbeitsplan Ost“ in den 1990er Jahren geprüft. Außerdem werden Statistiken zur sozialen Desintegration und der relativen Deprivation herangezogen. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und bewertet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Definition Rechtsextremismus
- Dimensionen des Rechtsextremismus
- Theorien zur Entstehung von Rechtsextremismus
- Autoritarismus-Theorie
- Soziale Desintegration
- Relative Deprivation
- Rechtsextremismus als Erblast der DDR
- Soziale Lebensbedingungen in der DDR
- Staatlich verordneter Antifaschismus
- AusländerInnen in der DDR
- Rechtsextremismus als Folge der Wiedervereinigung
- Rechtsextreme Strategien nach dem Mauerfall
- Soziale Desintegration
- Relative Deprivation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, ob der Rechtsextremismus in Ostdeutschland das Erbe der sozialistischen Diktatur der DDR oder das Ergebnis der neuen Lebensumstände nach der Wiedervereinigung ist. Es soll analysiert werden, welche Faktoren zur Entstehung und Zunahme des Rechtsextremismus in der ehemaligen DDR beigetragen haben.
- Definition und Dimensionen des Rechtsextremismus
- Theorien zur Entstehung von Rechtsextremismus
- Rechtsextremismus in der DDR: Soziale Lebensbedingungen, staatlich verordneter Antifaschismus, AusländerInnen in der DDR
- Rechtsextremismus nach der Wiedervereinigung: Rechtsextreme Strategien, soziale Desintegration, relative Deprivation
- Bewertung der Erblast-These und der Wiedervereinigungsthese
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik des Rechtsextremismus in Ostdeutschland vor und beleuchtet die hohe Anzahl von rechtsextremen Gewalttaten in den neuen Bundesländern. Es wird die Frage gestellt, ob die Rechtsextreme Orientierung in Ostdeutschland die Erblast der DDR oder die Folge der Wiedervereinigung ist.
- Definition Rechtsextremismus: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs Rechtsextremismus und den Schwierigkeiten, dieses Phänomen eindeutig zu kategorisieren. Es werden verschiedene Definitionen vorgestellt, die den Begriff Rechtsextremismus in Bezug auf Einstellungen, Verhaltensweisen und Aktionen betrachten.
- Theorien zur Entstehung von Rechtsextremismus: Hier werden die wichtigsten Theorien zur Entstehung von Rechtsextremismus vorgestellt, darunter die Autoritarismus-Theorie, die Soziale Desintegration und die Relative Deprivation. Diese Theorien liefern verschiedene Erklärungsmuster, die das Auftreten von Rechtsextremismus in unterschiedlichen Kontexten erläutern können.
- Rechtsextremismus als Erblast der DDR: Dieses Kapitel beleuchtet die „Erblast-These“, die den Rechtsextremismus in Ostdeutschland als Folge der DDR-Vergangenheit sieht. Es werden die sozialen Lebensbedingungen, die staatlich verordnete Antifaschismus-Ideologie und der Umgang mit AusländerInnen in der DDR untersucht.
- Rechtsextremismus als Folge der Wiedervereinigung: Dieses Kapitel widmet sich der „Wiedervereinigungsthese“ und analysiert die Entwicklungen im Rechtsextremismus nach dem Mauerfall. Es wird die Rolle der Rechtsextremen Strategien, die soziale Desintegration und die relative Deprivation in der ehemaligen DDR beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit behandelt das Thema Rechtsextremismus in Ostdeutschland und beleuchtet die verschiedenen Ursachen und Faktoren, die zum Entstehen und zur Verbreitung des Rechtsextremismus beigetragen haben. Wichtige Begriffe sind: Rechtsextremismus, DDR-Sozialisation, Antifaschismus, Wiedervereinigung, soziale Desintegration, relative Deprivation, Ausländerfeindlichkeit, nationalistische Ideologien, Gewaltbereitschaft.
Häufig gestellte Fragen
Ist Rechtsextremismus im Osten ein Erbe der DDR?
Die Arbeit untersucht die „Erblast-These“, nach der soziale Lebensbedingungen und ein staatlich verordneter Antifaschismus in der DDR den Boden für spätere rechtsextreme Einstellungen bereitet haben könnten.
Welche Rolle spielt die Wiedervereinigung beim Rechtsextremismus?
Die „Wiedervereinigungsthese“ besagt, dass die Umbrüche nach 1989, soziale Desintegration und relative Deprivation zu einer Zunahme rechtsextremer Gewalt führten.
Was besagt die Theorie der sozialen Desintegration?
Diese Theorie erklärt Rechtsextremismus als Folge des Verlusts von stabilen sozialen Bindungen und gesellschaftlicher Teilhabe während radikaler Umbruchphasen.
Wie wurde in der DDR mit Ausländern umgegangen?
Die Arbeit analysiert die Situation von AusländerInnen in der DDR und wie die mangelnde Integration zur Entstehung von Fremdenfeindlichkeit beigetragen haben könnte.
Was ist die Autoritarismus-Theorie?
Sie ist ein Erklärungsmodell für Rechtsextremismus, das auf der Annahme basiert, dass bestimmte Erziehungsmuster und soziale Strukturen autoritäre Persönlichkeitsstrukturen fördern.
- Citation du texte
- Sarah Kutscher (Auteur), 2016, Rechtsextremismus im Osten von Deutschland. Das braune Erbe der sozialistischen Diktatur oder Folge der Wiedervereinigung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354048