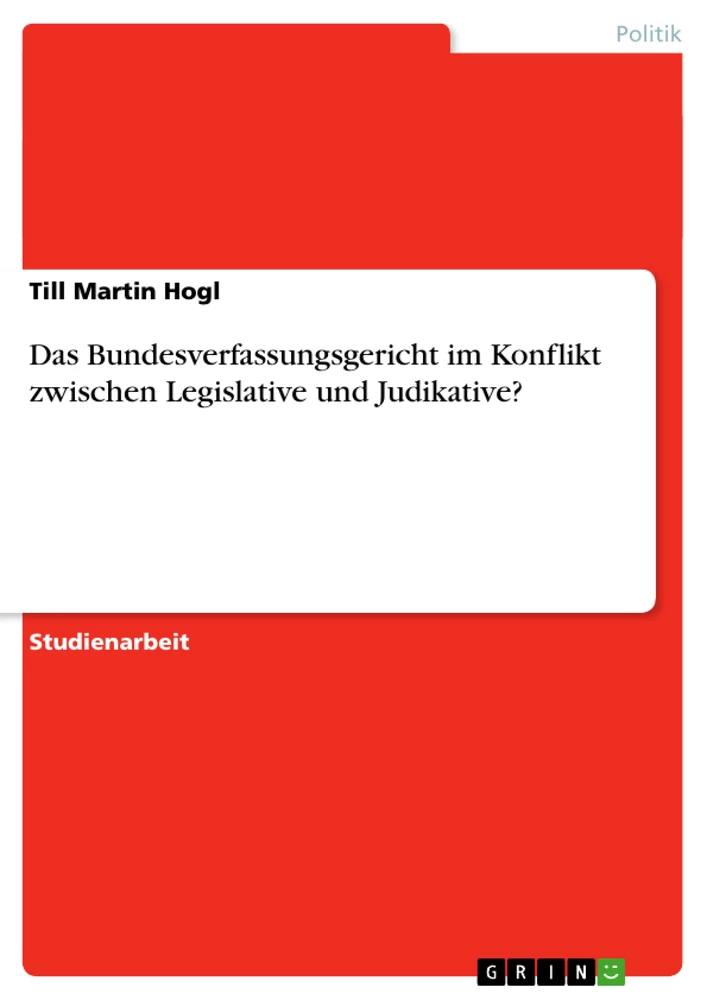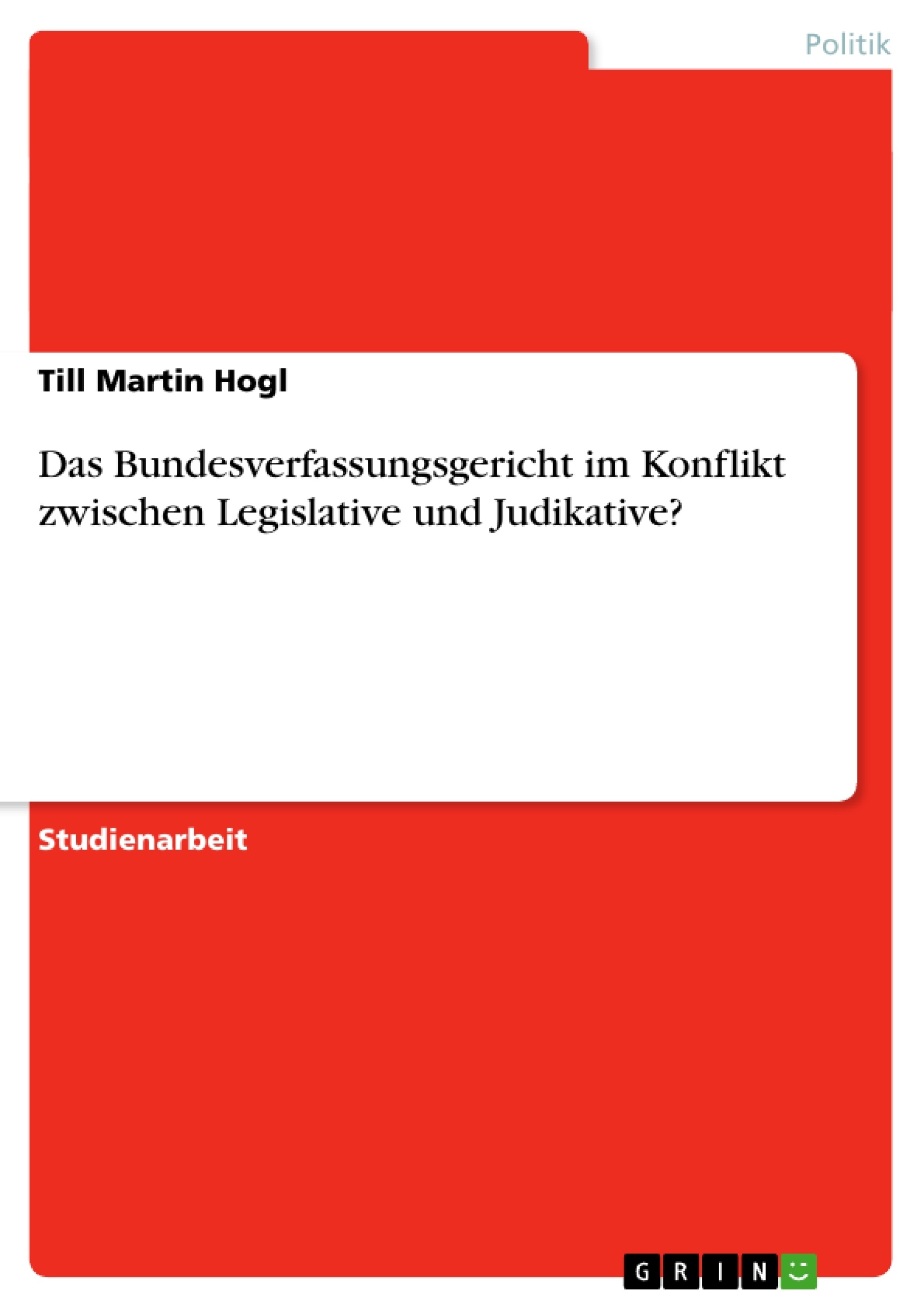Die Geschichte des Bundesverfassungsgerichts ist stets mit dem Vorwurf von Grenzund Kompetenzüberschreitungen im politischen Bereich verbunden. Kritiker des Gerichts waren in nahezu jedem Jahrzehnt davon überzeugt, daß der verfassungsrichterliche Aktivismus überproportional zunehme und letztendlich die Gestaltungsfreiheit der Politik mehr und mehr beschneide. Gerade die Verlierer eines Rechtsstreites vor dem Bundesverfassungsgericht profilierten sich als scharfe Kritiker.1 Der Vorwurf als „Ersatzgesetzgeber“ oder sogar als „Gegenregierung“ aufzutreten, fällt mit einer gewissen Kontinuität in der kontroversen Debatte um das oberste deutsche Gericht.2 Maßgeblich kam diese Kritik zur Zeit der sozial – liberalen Koalition auf, in den Jahren 1976 bis 1982, mit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Reform des § 218 StGB, der Kriegsdienstverweigerung oder auch der Hochschulpolitik. Mitte der neunziger Jahre keimte erneut massive Kritik auf. Es handelte sich dabei um die Entscheidungen zum Tucholsky Zitat „Soldaten sind Mörder“, dem Maastricht – Vertrag und erneut am § 218. In diesem Zusammenhang stellt sich also die Frage nach der „Justizialisierung“3 von Politik, folglich die Wirkung auf den politischen Entscheidungsprozeß, inwieweit begrenzt das Bundesverfassungsgericht die Politik und in welchem Maße wird sie beeinflußt? Letztendlich bedeutet dies, daß die Kritik am Bundesverfassungsgericht sich in folgenden Punkten zusammenfassen lässt, das BVerfG begrenzt den Gestaltungsfreiraum der Politik entscheidend durch die Justizialisierung von Politik und die daraus resultierenden Einflüsse auf den Gesetzgebungsprozeß.4 Christine Landfried ging 1984 mit ihren empirischen Forschungen zum Thema „Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber“ explizit auf diese Fragen ein. [...] 1 vgl. Limbach, Jutta: Das Bundesverfassungsgericht im Grenzbereich von Recht und Politik, Freie Universität Berlin, 1998 2 vgl. u.a. Reutter, Werner: Das Bundesverfassungsgericht als Teil des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, in: Verfassungspolitik und Verfassungswandel, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 2001, S. 99; Scholz, Rupert in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 16, 1999, S.3 3 vgl. Landfried, Christine: Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1984 4 vgl. Landfried, Christine; Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1984, S. 69
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Justizialisierung der Politik
- 2.1 Bedeutung der abstrakten Normenkontrolle als Druckmittel
- 2.2 Richterliche Selbstbeschränkung und Kompetenzüberschreitung
- 2.3 Parteipolitische Beeinflussung des Verfassungsgerichts
- 2.4 Einflußnahme des Gerichts auf politische Entscheidungen und Entwicklungen
- 3. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Konflikt zwischen dem Bundesverfassungsgericht und den politischen Organen (Legislative und Exekutive). Sie analysiert, inwieweit das Gericht die Politik durch seine Entscheidungen beeinflusst und den Gestaltungsspielraum der Politik einschränkt. Die Arbeit basiert auf der bestehenden Literatur und beleuchtet aktuelle Kontroversen um das Gericht.
- Justizialisierung der Politik und ihre Auswirkungen
- Die Rolle der abstrakten Normenkontrolle als politisches Druckmittel
- Richterliche Selbstbeschränkung versus Kompetenzüberschreitung
- Parteipolitische Einflüsse auf das Bundesverfassungsgericht
- Einflußnahme des Gerichts auf politische Entscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die anhaltende Kritik am Bundesverfassungsgericht (BVerfG) wegen angeblicher Kompetenzüberschreitungen und Eingriffe in den politischen Prozess. Sie verweist auf verschiedene Zeitpunkte massiver Kritik, etwa während der sozialliberalen Koalition (1976-1982) und Mitte der 1990er Jahre, und führt die zentralen Kritikpunkte zusammen: Das BVerfG schränke den Gestaltungsspielraum der Politik durch die Justizialisierung der Politik ein und beeinflusse den Gesetzgebungsprozess. Die Arbeit zielt darauf ab, anhand der Literatur den Konflikt zwischen Recht und Politik im Handeln des BVerfG zu untersuchen und den Einfluss des Gerichts auf politische Entscheidungen zu beleuchten.
2. Justizialisierung der Politik: Dieses Kapitel definiert Justizialisierung als Verrechtlichung der Politik, wobei politische Fragen durch Gerichtsentscheidungen konkretisiert werden. Das BVerfG übernimmt somit politische Entscheidungsfunktionen. Es wird im Detail die Bedeutung der abstrakten Normenkontrolle als Druckmittel erörtert und analysiert, wie politische Akteure diese Möglichkeit strategisch nutzen können, um politische Ziele zu erreichen und Kompromisse auf juristischem Wege zu erzwingen. Die Arbeit betrachtet auch konkrete Beispiele wie die Urteile zum "Kruzifix" und "Soldaten sind Mörder", um die politische Brisanz verfassungsgerichtlicher Entscheidungen zu illustrieren und deren Wirkung auf die politischen Prozesse aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Bundesverfassungsgericht, Justizialisierung, Politik, Normenkontrolle, Richterliche Selbstbeschränkung, Kompetenzüberschreitung, Gesetzgebung, politische Entscheidungsprozesse, Parteipolitik, Rechtsprechung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Justizialisierung der Politik und das Bundesverfassungsgericht
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Konflikt zwischen dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) und den politischen Organen (Legislative und Exekutive). Im Mittelpunkt steht die Analyse, inwieweit das BVerfG die Politik durch seine Entscheidungen beeinflusst und den Gestaltungsspielraum der Politik einschränkt. Die Arbeit beleuchtet aktuelle Kontroversen um das Gericht und basiert auf der bestehenden Literatur.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Justizialisierung der Politik und ihre Auswirkungen, die Rolle der abstrakten Normenkontrolle als politisches Druckmittel, richterliche Selbstbeschränkung versus Kompetenzüberschreitung, parteipolitische Einflüsse auf das BVerfG und den Einfluss des Gerichts auf politische Entscheidungen.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Justizialisierung der Politik mit Unterkapiteln zur abstrakten Normenkontrolle, richterlicher Selbstbeschränkung/Kompetenzüberschreitung und parteipolitischer Beeinflussung, sowie eine Schlussbetrachtung. Die Einleitung skizziert die anhaltende Kritik am BVerfG und die zentralen Kritikpunkte. Das Hauptkapitel analysiert im Detail die Justizialisierung der Politik und die Rolle der abstrakten Normenkontrolle als Druckmittel, unter Einbezug konkreter Beispiele.
Was versteht die Arbeit unter "Justizialisierung der Politik"?
Die Arbeit definiert Justizialisierung als Verrechtlichung der Politik, wobei politische Fragen durch Gerichtsentscheidungen konkretisiert werden. Das BVerfG übernimmt somit politische Entscheidungsfunktionen.
Welche Rolle spielt die abstrakte Normenkontrolle?
Die abstrakte Normenkontrolle wird als wichtiges Druckmittel analysiert. Die Arbeit untersucht, wie politische Akteure diese Möglichkeit strategisch nutzen können, um politische Ziele zu erreichen und Kompromisse auf juristischem Wege zu erzwingen.
Welche Beispiele werden zur Veranschaulichung verwendet?
Die Arbeit nennt als Beispiele für die politische Brisanz verfassungsgerichtlicher Entscheidungen die Urteile zum "Kruzifix" und "Soldaten sind Mörder", um deren Wirkung auf die politischen Prozesse aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bundesverfassungsgericht, Justizialisierung, Politik, Normenkontrolle, Richterliche Selbstbeschränkung, Kompetenzüberschreitung, Gesetzgebung, politische Entscheidungsprozesse, Parteipolitik, Rechtsprechung.
- Quote paper
- Till Martin Hogl (Author), 2002, Das Bundesverfassungsgericht im Konflikt zwischen Legislative und Judikative?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35414