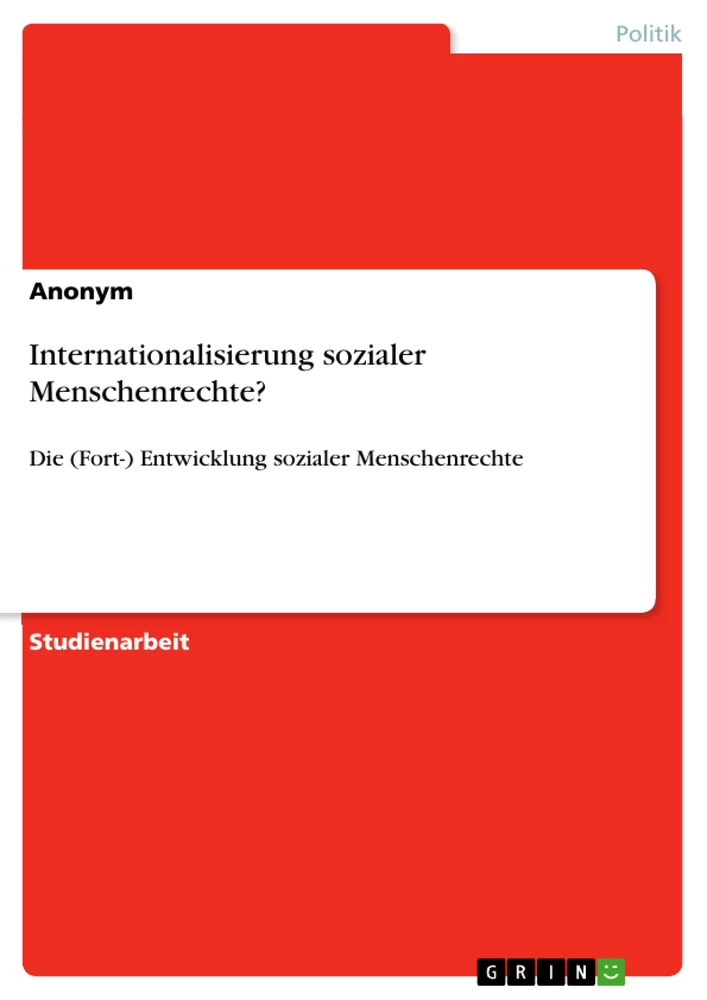In dieser Referatsausarbeitung soll die historische (Fort-) Entwicklung sozialer Menschenrechte, hauptsächlich auf Grundlage des Textes von Franz-Xaver Kaufmann, dargestellt und auf den aktuellen Entwicklungsstand eingegangen werden. Zum Schluss wird kurz bewertet, inwiefern von einer vollständigen Internationalisierung sozialer Menschenrechte gesprochen werden kann.
In der Menschenrechtsliteratur hat sich seit langem die Unterteilung in drei unterschiedliche „Generationen“ eingebürgert. Rechte der ersten Generation bezeichnen hierbei die klassischen bürgerlich-politischen Freiheitsrechte, wie sie schon in frühen Bürgerrechtsdokumenten formuliert wurden. Beispiele für diese Rechte sind das Recht auf Leben, die Religionsfreiheit oder die Meinungsfreiheit. Das Aufkommen der Rechte der zweiten Generation hingegen wird mit der Entstehung der „sozialen Frage“ im 19. Jahrhundert in Verbindung gebracht. Diese Rechte, die zusammengefasst als wsk-Rechte bezeichnet werden, umfassen beispielsweise die Rechte auf Arbeit, Ernährung oder Wohnen. Als Rechte der dritten Generation gelten neuere, kaum kodifizierte und stärker kollektive Rechte wie das Recht auf Entwicklung oder auf eine saubere Umwelt.
Mit der Verwendung des Begriffes Generationen sollte man allerdings nicht von einer strikten zeitlichen Abfolge ausgehen. Zwar tauchen wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte noch nicht in frühen einflussreichen Bürgerrechtsdokumenten auf, doch kann zum Beispiel Eigentumsrecht, das eigentlich ein klassisches Freiheitsrecht ist, auch als wirtschaftliches Recht betrachtet werden. Das früh etablierte Sklaverei-Verbot weist ebenfalls enge Bezüge zum Recht auf frei gewählte Arbeit auf. Des Weiteren geht mit der Rede von Menschenrechts-Generationen eine problematische Gewichtung einher, wonach die klassischen bürgerlich-politischen Rechte die eigentlichen Menschenrechte darstellen, da nur sie grundlegende Abwehr- und Freiheitsrechte darstellen würden, die der Staat zu achten habe, während es sich bei den wsk-Rechten um Leistungs- oder gar Luxusrechte handle, die stets umfassende Staatstätigkeiten verlangten. Aus diesem Grund wurden die wsk-Rechte lange Zeit bloß als politische Ziele und nicht als „echte“ Menschenrechte anerkannt. Über die Zeit hinweg hat sich diese Sichtweise aus unterschiedlichen Gründen gewandelt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Entstehung und Entwicklung wohlfahrtsstaatlicher Programmatik
- 3. Wandelnde Interpretation und Umsetzung sozialer Menschenrechte
- 4. Extraterritoriale Staatenpflichten und Verpflichtungen jenseits des Staates
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Referatsausarbeitung analysiert die historische Entwicklung und den aktuellen Stand sozialer Menschenrechte, insbesondere im Hinblick auf die wohlfahrtsstaatliche Programmatik.
- Die Entstehung und Entwicklung wohlfahrtsstaatlicher Programmatik im Kontext der Industrialisierung
- Die Bedeutung internationaler Organisationen wie der IAO und der Vereinten Nationen bei der Förderung sozialer Menschenrechte
- Die Wandelnde Interpretation und Umsetzung sozialer Menschenrechte im Laufe der Zeit
- Die Herausforderungen und Chancen der Internationalisierung sozialer Menschenrechte
- Die Rolle und Bedeutung von Staatenpflichten und Verpflichtungen jenseits des Staates
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung erläutert die historische Unterteilung von Menschenrechten in drei Generationen: klassische bürgerlich-politische Freiheitsrechte, wirtschaftliche, soziale und kulturelle (wsk) Rechte und neuere, kollektive Rechte. Die Autorin argumentiert, dass die Verwendung des Begriffs "Generationen" nicht auf eine strikte zeitliche Abfolge hindeutet und die traditionelle Unterscheidung von wsk-Rechten als "Leistungs- oder Luxusrechte" problematisch ist.
- Kapitel 2: Entstehung und Entwicklung wohlfahrtsstaatlicher Programmatik: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung sozialer Menschenrechte ausgehend von der Industrialisierung. Es werden die ersten Schritte zur internationalen Verbreitung von Arbeitsschutzrichtlinien im späten 19. Jahrhundert, die Gründung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) im Jahr 1920 und die Bedeutung der Atlantikcharta von 1941 und der Philadelphia Erklärung von 1944 für die Entwicklung einer internationalen Wohlfahrtsverantwortung beschrieben.
- Kapitel 3: Wandelnde Interpretation und Umsetzung sozialer Menschenrechte: Das Kapitel beleuchtet die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948 und die beiden 1966 verabschiedeten Pakte: den Zivilpakt für bürgerlich-politische Menschenrechte und den Sozialpakt für wsk-Rechte. Es werden die Herausforderungen der Zweiteilung in Freiheitsrechte und Sozialrechte sowie die Bedeutung der Europäischen Sozialcharta von 1961 erläutert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Themen der Arbeit sind soziale Menschenrechte, wohlfahrtsstaatliche Programmatik, internationale Zusammenarbeit, IAO, Vereinte Nationen, wirtschaftliche, soziale und kulturelle (wsk) Rechte, Industrialisierung, Menschenrechts-Generationen, Atlantikcharta, Philadelphia Erklärung, Zivilpakt, Sozialpakt und Europäische Sozialcharta.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die drei Generationen der Menschenrechte?
Die erste Generation umfasst bürgerlich-politische Freiheitsrechte, die zweite Generation soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte (wsk-Rechte) und die dritte Generation kollektive Rechte wie das Recht auf Entwicklung.
Warum wurde die Unterscheidung in Generationen kritisiert?
Die Kritik besagt, dass dadurch soziale Rechte oft fälschlicherweise als zweitrangige „Luxusrechte“ gegenüber den klassischen Freiheitsrechten abgewertet wurden.
Welche Rolle spielt die IAO bei den sozialen Menschenrechten?
Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO), gegründet 1920, war maßgeblich an der Verbreitung von Arbeitsschutzrichtlinien und der internationalen Wohlfahrtsverantwortung beteiligt.
Was ist der Unterschied zwischen dem Zivilpakt und dem Sozialpakt von 1966?
Der Zivilpakt schützt bürgerlich-politische Rechte, während der Sozialpakt wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte wie das Recht auf Arbeit und Bildung kodifiziert.
Was bedeutet die Internationalisierung sozialer Menschenrechte?
Es beschreibt den Prozess, soziale Standards über nationale Grenzen hinweg durch Organisationen wie die UN oder die Europäische Sozialcharta rechtlich verbindlich zu machen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, Internationalisierung sozialer Menschenrechte?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354224