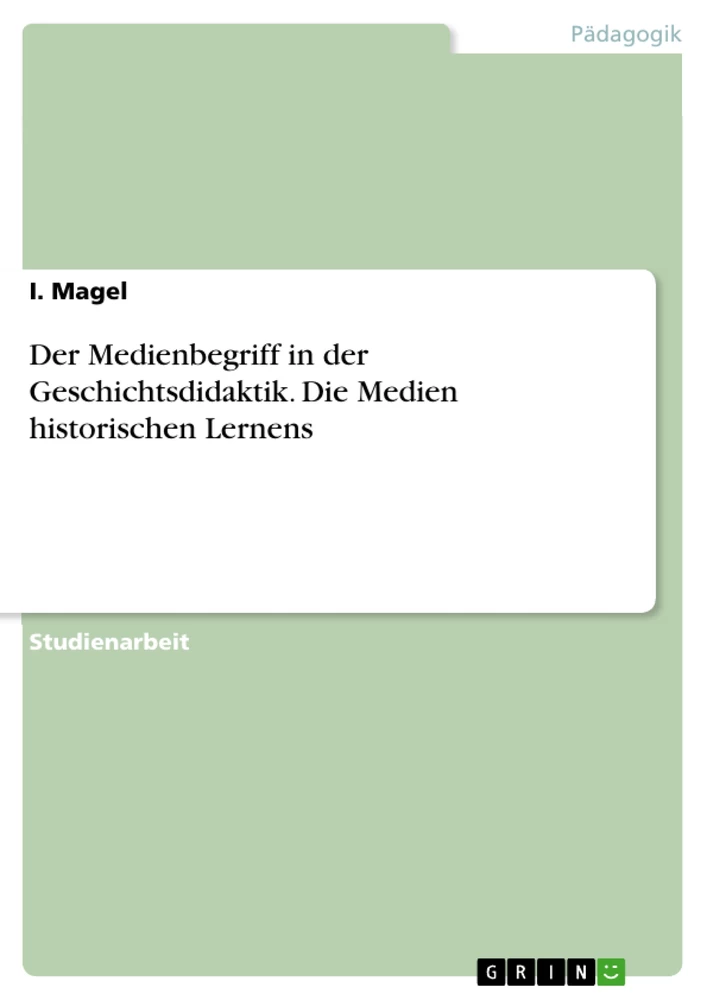In den letzten Jahren haben Medien für Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene eine immer größer werdende Alltagsrelevanz bekommen. Dementsprechend hat auch die Bedeutung der Medien sowie deren Verwendung in der Schule stark zugenommen.
Die folgende Arbeit befasst sich im ersten Teil mit dem Medienbegriff im Allgemeinen, um zu klären, was in unserer heutigen Gesellschaft unter dem Begriff 'Medien' verstanden wird und wie sich dieser im Laufe der Zeit entwickelte. Für diese Klärung werden unterschiedliche Definitionen von verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen herangezogen. Anschließend wird der Medienbegriff aus der Sicht der Pädagogik betrachtet, um schließlich die geschichtsdidaktische Perspektive zu beleuchten und die Frage zu klären, was ein Medium in Bezug auf den Geschichtsunterricht ist.
In einem letzten Schritt gehe ich auf das Lernen mit und an Medien ein und zeige die Forderungen nach Pandel auf, die Medien mit sich bringen sollen. Doch bevor ich im Hauptteil auf die oben aufgeführten Aspekte komme, möchte ich auf das allgemeine Begriffsverständnis von Medien in unserer heutigen Gesellschaft eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff 'Medium/Medien'
- Medienbegriff in der Pädagogik
- Medien im Geschichtsunterricht
- Lernen mit und an Medien
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Seminar befasst sich mit dem Medienbegriff in der Geschichtsdidaktik und untersucht die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Medien im Geschichtsunterricht. Ziel ist es, die Bedeutung von Medien für das historische Lernen zu verstehen und die Reflexion über deren Einsatz im Unterricht zu fördern.
- Der Wandel des Medienbegriffs im Laufe der Zeit
- Die Rolle von Medien im Geschichtsunterricht
- Die Bedeutung von Quellen und Medien im historischen Lernen
- Die verschiedenen Arten von Medien im Geschichtsunterricht
- Die didaktischen Möglichkeiten und Herausforderungen des Einsatzes von Medien
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz von Medien im Alltag und im Bildungsbereich dar. Sie führt ein Zitat von Hans-Jürgen Pandel an, das die Unterscheidung zwischen Quellen und Medien im historischen Lernen verdeutlicht. Die Einleitung skizziert die Zielsetzung des Seminars und die Themen, die im weiteren Verlauf behandelt werden.
- Der Begriff 'Medium/Medien': Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel des Medienbegriffs von seiner ursprünglichen Bedeutung als 'Mittleres' bis hin zu den heutigen Begriffen von 'Massenmedien' und 'Massenkommunikation'. Es werden verschiedene Definitionen des Begriffs aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen vorgestellt und analysiert.
- Medienbegriff in der Pädagogik: In diesem Kapitel wird der Medienbegriff aus der Sicht der Pädagogik betrachtet. Es werden die verschiedenen Arten von Unterrichtsmedien und deren Rolle im Bildungsprozess erläutert.
- Medien im Geschichtsunterricht: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die Bedeutung von Medien im Geschichtsunterricht. Es werden die verschiedenen Arten von Medien, die im Geschichtsunterricht eingesetzt werden können, vorgestellt und ihre didaktischen Möglichkeiten und Herausforderungen beleuchtet.
- Lernen mit und an Medien: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, wie Schülerinnen und Schüler mit und an Medien historisch lernen können. Es werden die Forderungen von Hans-Jürgen Pandel nach Medien im Geschichtsunterricht vorgestellt, die den Fokus auf die Förderung des historischen Denkens und Lernens legen.
Schlüsselwörter
Medienbegriff, Geschichtsdidaktik, Medien im Geschichtsunterricht, Quellen, Darstellungen, Fiktionen, historische Lernprozesse, Didaktik, Unterrichtsmedien, historische Bildung, Medienkompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Medienbegriff in der Geschichtsdidaktik definiert?
In der Geschichtsdidaktik wird der Medienbegriff über seine Funktion als Vermittler zwischen Vergangenheit und Lernenden definiert. Es geht darum, wie historische Inhalte durch verschiedene Träger (Quellen, Darstellungen) zugänglich gemacht werden.
Was unterscheidet Quellen von Medien laut Hans-Jürgen Pandel?
Pandel unterscheidet zwischen Quellen als Überresten der Vergangenheit und Medien als didaktisch aufbereiteten Darstellungen oder Werkzeugen, die im historischen Lernprozess eine vermittelnde Rolle einnehmen.
Welche Arten von Medien kommen im Geschichtsunterricht zum Einsatz?
Zum Einsatz kommen Quellen (Texte, Sachquellen), Darstellungen (Lehrbücher, Dokumentationen), Fiktionen (historische Romane, Spielfilme) sowie moderne digitale Unterrichtsmedien.
Was bedeutet „Lernen mit und an Medien“ im historischen Kontext?
Es beschreibt den Prozess, bei dem Schüler Medien nicht nur als Informationsquelle nutzen (Lernen mit Medien), sondern diese auch kritisch auf ihre Konstruktion und Wirkung hin untersuchen (Lernen an Medien).
Wie hat sich der Medienbegriff im Laufe der Zeit gewandelt?
Der Begriff entwickelte sich von der ursprünglichen Bedeutung als „Mittleres“ hin zu komplexen Konzepten der Massenkommunikation und digitalen Vernetzung, was auch die pädagogischen Anforderungen verändert hat.
- Quote paper
- I. Magel (Author), 2014, Der Medienbegriff in der Geschichtsdidaktik. Die Medien historischen Lernens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354388