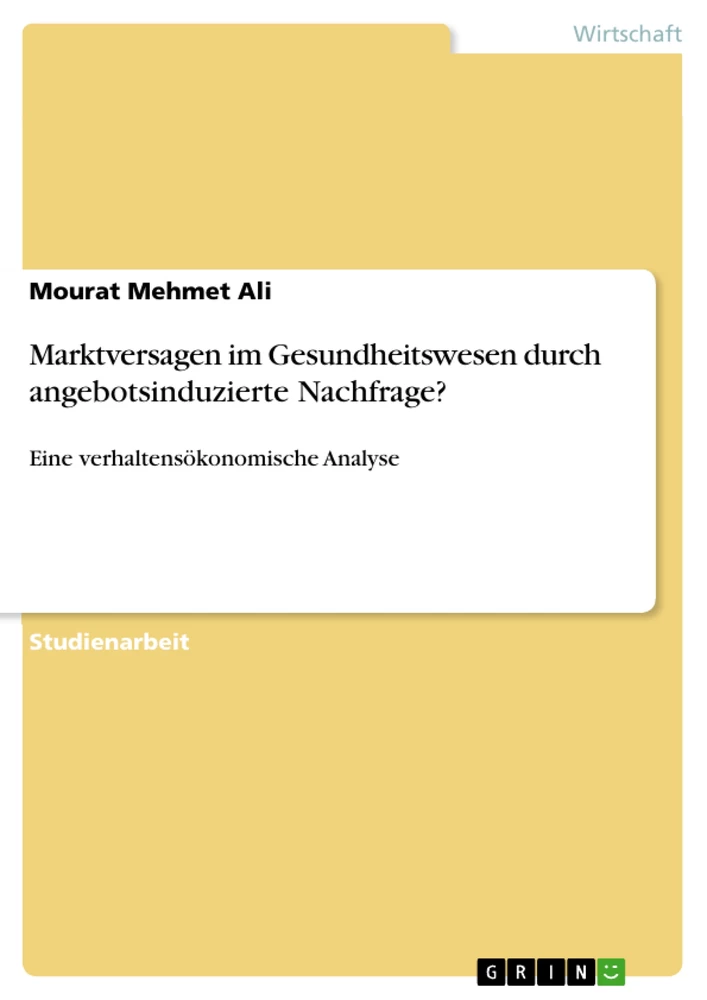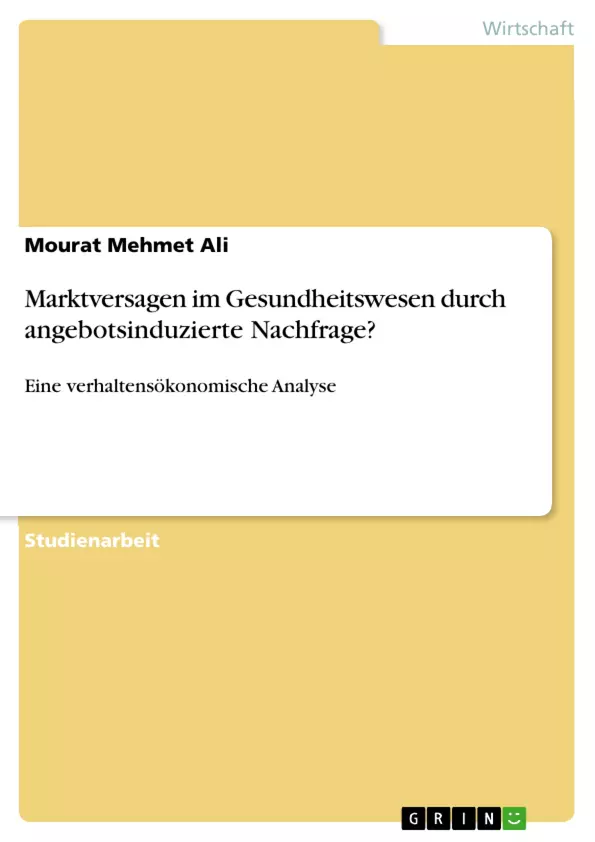Eine ganze Reihe von Gesundheitsreformen haben gezeigt, welcher Dynamik das Gesundheitswesen unterliegt. Der Gesetzgeber muss immer schneller auf Reformvorhaben reagieren und eine beinahe nur in der Theorie gültige uneingeschränkte Reaktionsgeschwindigkeit aufzeigen. Die Gesundheitsökonomie beschäftigt sich nicht nur mit den Ausgaben und Einnahmen auf der Finanzierungsseite, sondern stellt eine wichtige ordnungspolitische Säule dar. Gegenstand der Ordnungspolitik ist die Gestaltung der ethischen, rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen einer Gesellschaft. Sie ist eine Gestaltungsgrundlage für das Verhalten von Wirtschaftssubjekten und politischen Entscheidungsträgern.1 Im Umkehrschluss kann über eine Wirtschaftsordnung auf der einen Seite und über eine Staatsordnung auf der anderen Seite gesprochen werden. Die Ordnungspolitik geht oft mit einem Wirtschaftssystem einher. Wirtschaftssysteme bestimmen die wirtschaftlichen Prozesse einer Volkswirtschaft und sollten das Ziel der optimalen Allokation im Auge haben. Wirtschaftssubjekte handeln meist nach Regeln und Gesetze einer Wirtschaft in denen Sie ihre Güter austauschen, d.h. das Verhalten eines Wirtschaftssubjektes ist durch ein bereits vordefiniertes Wirtschaftssystem gegeben.
Die vorliegende Ausarbeitung beschäftigt sich zunächst mit unterschiedlichen Modellen der Wirtschaftssystemtheorie und beschreibt anschließend weitere Arten. Infolge dessen wird das Phänomen des Marktversagens in der mikro- und makroökonomischen Betrachtung und seine Bedeutung für das Gesundheitswesen näher beschrieben. Im Hinblick auf die Wohlfahrt einer Volkswirtschaft wird die Bedeutung des Gesundheitswesens im Rahmen einer wirtschaftspolitischen Schlussfolgerung näher erläutert. Im Kern dieser Hausarbeit wird auf die Besonderheiten des Gesundheitswesens hingewiesen. Weiterhin wird über den unterschiedlichen Charakter einer Gesundheitsleistung diskutiert und bestimmte Probleme auf dem gegenwärtigen Markt kurz dargestellt.
Im Hauptteil wird die Annahme, dass das Verhalten von Wirtschaftssubjekten stark von einem Wirtschaftssystem und einer Ordnungspolitik abhängig ist, am Beispiel des Verhaltens eines Arztes validiert. Dabei wird ein Modellbeispiel von Breyer, Zweifel und Kifmann veranschaulicht, welches die Inanspruchnahme von ärztlichen Leistungen mit der Ärztedichte einer Region in Verbindung bringt. Das Fazit zum Ende der Ausarbeitung soll eine kritische Würdigung und eine Diskussionsgrundlage bilden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Arten und Modelle der Wirtschaftssystemtheorie
- 3. Marktversagen
- 3.1 Mikroökonomische Betrachtung
- 3.2 Makroökonomische Betrachtung
- 3.3 Wirtschaftspolitische Schlussfolgerung
- 4. Der Gesundheitsmarkt und die angebotsinduzierte Nachfrage
- 4.1 Problemdarstellung auf dem gegenwärtigen Markt
- 4.3 Die Ärztedichte und die Inanspruchnahme von ärztlichen Leistungen
- 4.4 Ein Modell des ärztlichen Verhaltens
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung analysiert das Phänomen des Marktversagens im Gesundheitswesen, insbesondere im Kontext der angebotsinduzierten Nachfrage. Sie beleuchtet die verschiedenen Modelle der Wirtschaftssystemtheorie und untersucht die mikro- und makroökonomischen Aspekte des Marktversagens. Im Hinblick auf die Wohlfahrt einer Volkswirtschaft wird die Bedeutung des Gesundheitswesens im Rahmen einer wirtschaftspolitischen Schlussfolgerung näher erläutert.
- Modelle der Wirtschaftssystemtheorie
- Mikro- und makroökonomische Betrachtung des Marktversagens
- Die Bedeutung des Gesundheitswesens für die Wohlfahrt
- Die angebotsinduzierte Nachfrage im Gesundheitsmarkt
- Wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik des Marktversagens im Gesundheitswesen ein und beleuchtet die dynamischen Prozesse im Gesundheitswesen. Kapitel 2 beschäftigt sich mit verschiedenen Modellen der Wirtschaftssystemtheorie, die als Grundlage für die Analyse des Marktversagens dienen. Kapitel 3 untersucht das Phänomen des Marktversagens aus mikro- und makroökonomischer Perspektive und beleuchtet seine Auswirkungen auf das Gesundheitswesen. Kapitel 4 widmet sich dem Gesundheitsmarkt und analysiert die angebotsinduzierte Nachfrage. Dabei werden insbesondere die Problemdarstellung auf dem gegenwärtigen Markt, die Ärztedichte und die Inanspruchnahme von ärztlichen Leistungen sowie ein Modell des ärztlichen Verhaltens betrachtet.
Schlüsselwörter
Marktversagen, Gesundheitswesen, Wirtschaftssystemtheorie, Mikroökonomie, Makroökonomie, Wohlfahrt, Gesundheitsmarkt, Angebotsinduzierte Nachfrage, Ärztedichte, ärztliches Verhalten, wirtschaftspolitische Schlussfolgerung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist angebotsinduzierte Nachfrage im Gesundheitswesen?
Es beschreibt das Phänomen, dass Leistungserbringer (z.B. Ärzte) aufgrund von Informationsasymmetrien die Nachfrage nach medizinischen Leistungen selbst generieren oder beeinflussen können.
Warum kommt es im Gesundheitsmarkt zu Marktversagen?
Marktversagen entsteht durch Faktoren wie Informationsasymmetrien zwischen Arzt und Patient, externe Effekte und die Besonderheit von Gesundheitsleistungen als „Gut“.
Welchen Einfluss hat die Ärztedichte auf die Inanspruchnahme von Leistungen?
Modelle von Breyer, Zweifel und Kifmann zeigen, dass eine höhere Ärztedichte in einer Region oft zu einer höheren Anzahl an erbrachten Leistungen pro Kopf führt.
Was ist das Ziel der Ordnungspolitik im Gesundheitswesen?
Sie soll die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen so gestalten, dass eine optimale Allokation von Ressourcen und eine gerechte Versorgung gewährleistet sind.
Handeln Ärzte rein ökonomisch?
Die Arbeit analysiert das Verhalten von Ärzten als Wirtschaftssubjekte, die innerhalb eines vordefinierten Wirtschaftssystems auf Anreize reagieren.
Was unterscheidet mikro- und makroökonomisches Marktversagen?
Die mikroökonomische Sicht fokussiert auf das Verhalten einzelner Akteure, während die makroökonomische Sicht die Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft und Wohlfahrt betrachtet.
- Quote paper
- Mourat Mehmet Ali (Author), 2016, Marktversagen im Gesundheitswesen durch angebotsinduzierte Nachfrage?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354458