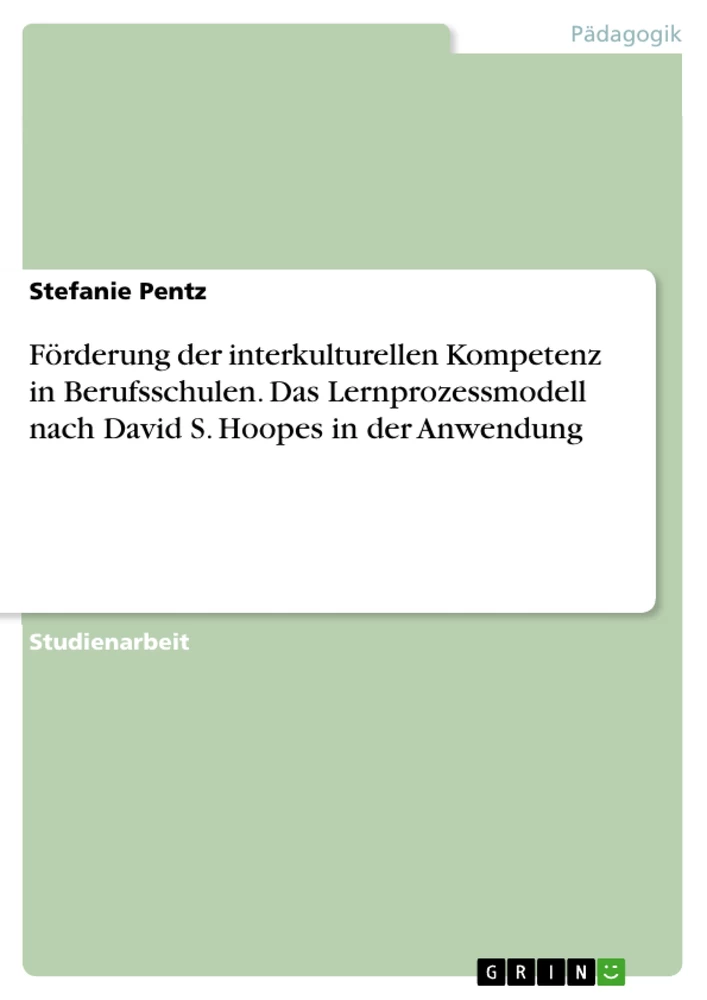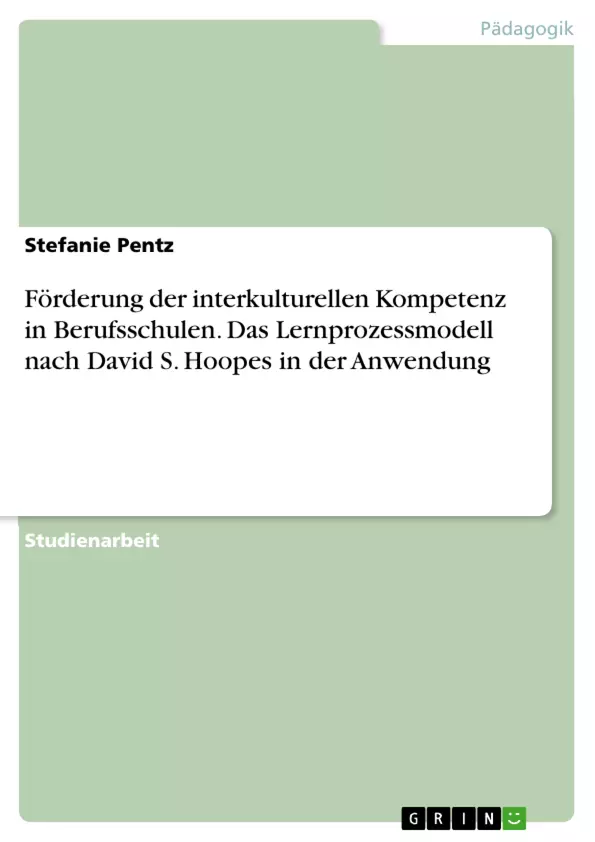Ziel dieser Arbeit ist es, Möglichkeiten einer methodischen Ausgestaltung des Lernprozessmodells von Hoopes hinsichtlich des Erwerbs von interkultureller Kompetenz aufzuzeigen, die innerhalb der berufsschulischen Ausbildung anwendbar sind.
Im ersten Abschnitt erfolgt die terminologische Auseinandersetzung mit der interkulturellen Kompetenz. Da der Begriff ein in der Literatur viel diskutiertes und komplexes System ist, dient dieser Abschnitt zur Eingrenzung für diese Arbeit und soll zum Verständnis von interkultureller Kompetenz beitragen. Die Erklärung des Lernprozessmodells sowie dessen mögliche methodische Ausgestaltung werden im zweiten Abschnitt thematisiert. Dabei wird darauf geachtet, dass die Methoden im Unterricht Anwendung finden können. Abschließend erfolgen eine kritische Reflexion und eine Auseinandersetzung mit Problemen bei der interkulturellen Kompetenzentwicklung bei Berufsschülern.
Im europäischen Vergleich wird Deutschland als das beliebteste Zielland von Flüchtlingen gesehen. Allein im Jahr 2015 suchten 1.091.894 Flüchtlinge Schutz in Deutschland. Dadurch werden Bund und Länder herausgefordert, die Integration von Flüchtlingen verstärkt zu fördern. Einer der wichtigsten Aspekte im Hinblick auf die Integration von Flüchtlingen ist die Bildung. Das Erlernen der deutschen Sprache und die Eingliederung in Schule, Ausbildung und Studium sind wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration in unsere Gesellschaft.
In der beruflichen Schule beträgt der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund oft über 40 %. Dadurch wird der Berufsschulalltag vermehrt durch interkulturelle Situationen geprägt und die Schüler und Schülerinnen müssen Herausforderungen bewältigen, wie das Überwinden von Missverständnissen oder Konflikten, die auf die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe zurückzuführen sind. Um sich in solchen interkulturellen Situationen richtig zu verhalten, benötigen sie Wissen, Fähigkeiten, Verhaltensgrundlagen und -einstellungen, die zusammengefasst als interkulturelle Kompetenz bezeichnet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Interkulturelle Kompetenz als Werkzeug für interkulturelle Herausforderungen
- Interkulturelle Kompetenz
- Kulturbegriff und Interkulturalität
- Kompetenz
- Interkulturelle Kompetenz und ihre Dimensionen
- Das Lernprozessmodell und mögliche Methoden zur Ausgestaltung
- Stufen des Lernprozessmodells nach Hoopes
- Mögliche Methoden zur Ausgestaltung
- Kritische Reflexion
- Probleme der Entwicklung der interkulturellen Kompetenz bei Berufsschülern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Integration von Flüchtlingen in das deutsche Bildungssystem, insbesondere im Kontext der beruflichen Ausbildung. Sie analysiert die Bedeutung interkultureller Kompetenz für die Bewältigung interkultureller Herausforderungen in der Berufsschule und untersucht, wie das Lernprozessmodell nach Hoopes zur Förderung dieser Kompetenz eingesetzt werden kann.
- Interkulturelle Kompetenz als Schlüssel zur erfolgreichen Integration von Flüchtlingen in die Berufsschule
- Das Lernprozessmodell nach Hoopes als Instrument zur Förderung interkultureller Kompetenz
- Methoden zur Anwendung des Lernprozessmodells im berufsschulischen Kontext
- Herausforderungen und Probleme bei der Entwicklung interkultureller Kompetenz bei Berufsschülern
- Mögliche Lösungsansätze zur Optimierung der interkulturellen Kompetenzentwicklung in der Berufsschule
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Bedeutung interkultureller Kompetenz im Kontext der Integration von Flüchtlingen in Deutschland. Es beleuchtet die Herausforderungen, die mit der zunehmenden kulturellen Heterogenität in der Berufsschule einhergehen, und argumentiert, dass interkulturelle Kompetenz eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung dieser Herausforderungen spielt. Das zweite Kapitel definiert den Begriff der interkulturellen Kompetenz und untersucht die verschiedenen Dimensionen dieser Kompetenz. Es geht auf den Kulturbegriff und die Bedeutung von Interkulturalität ein und analysiert die verschiedenen Facetten von Kompetenz. Das dritte Kapitel stellt das Lernprozessmodell nach Hoopes vor und untersucht die einzelnen Stufen dieses Modells. Es werden verschiedene Methoden zur Anwendung des Modells in der beruflichen Ausbildung vorgestellt und deren Eignung für die Förderung interkultureller Kompetenz bewertet.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kompetenz, Integration von Flüchtlingen, Berufsschule, Lernprozessmodell nach Hoopes, Methoden zur Förderung interkultureller Kompetenz, kulturelle Heterogenität, interkulturelle Herausforderungen, Missverständnisse, Konflikte, Bildung, deutsche Sprache, Bildungsangebote, Migrationshintergrund.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist interkulturelle Kompetenz in Berufsschulen so wichtig?
Da der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund oft über 40 % liegt, ist diese Kompetenz entscheidend, um Konflikte zu vermeiden und die Integration zu fördern.
Was ist das Lernprozessmodell nach David S. Hoopes?
Es ist ein Modell, das verschiedene Stufen der kulturellen Sensibilisierung beschreibt, um interkulturelles Lernen methodisch zu strukturieren.
Welche Rolle spielt die Bildung bei der Integration von Flüchtlingen?
Bildung und das Erlernen der deutschen Sprache sind laut Arbeit die wichtigsten Voraussetzungen für die Eingliederung in Schule, Ausbildung und Gesellschaft.
Welche Methoden können im Unterricht angewendet werden?
Die Arbeit zeigt Möglichkeiten auf, wie das Hoopes-Modell methodisch ausgestaltet werden kann, um die interkulturelle Urteilsfähigkeit von Berufsschülern zu stärken.
Welche Probleme gibt es bei der Kompetenzentwicklung?
Herausforderungen liegen oft in tief sitzenden Vorurteilen oder mangelnden Berührungspunkten zwischen verschiedenen kulturellen Gruppen im Schulalltag.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Pentz (Autor:in), 2016, Förderung der interkulturellen Kompetenz in Berufsschulen. Das Lernprozessmodell nach David S. Hoopes in der Anwendung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354470