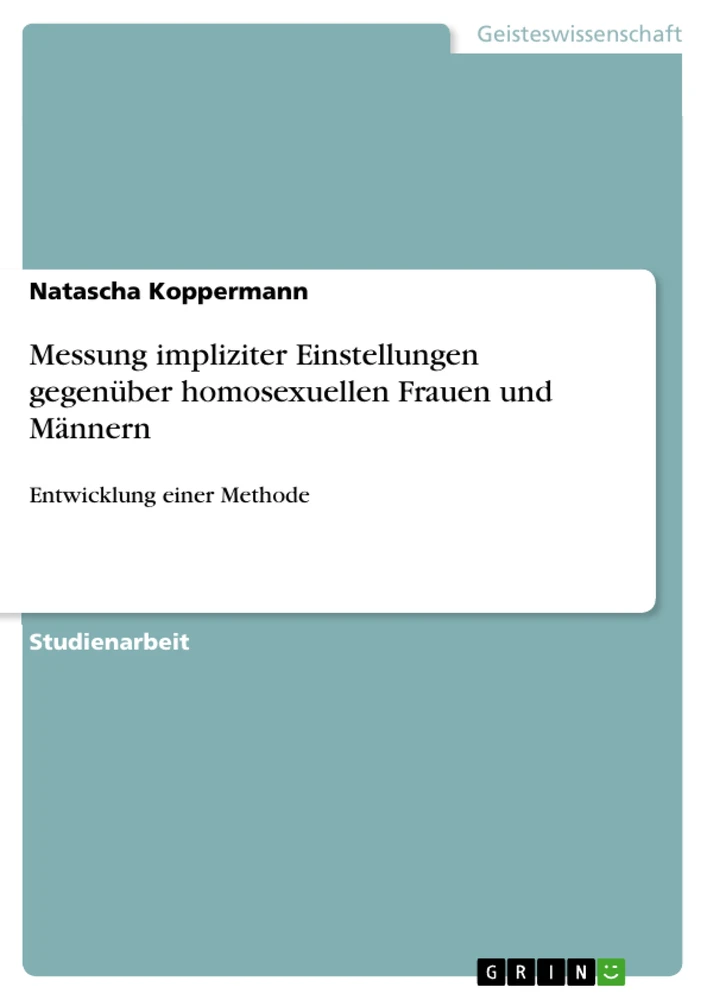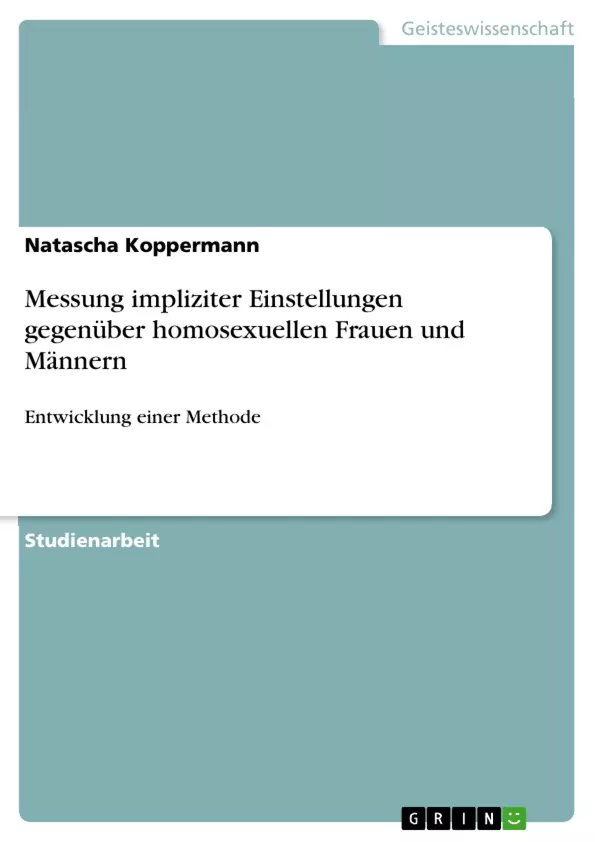In dieser Arbeit wird eine indirekte Messmethode vorgeschlagen, mit der implizite Einstellungen von Heterosexuellen gegenüber homosexuellen Frauen und Männern festgestellt werden können.
Die Akzeptanz von Homosexualität ist ein aktuelles Thema: Der Großteil der deutschen Gesellschaft toleriert gleichgeschlechtliche Liebe – und trotzdem fühlen sich homosexuelle Frauen und Männer nicht akzeptiert. Kann es sein, dass die so gewollte Toleranz tief im Inneren eines Individuums gar nicht vorhanden ist?
Menschen verarbeiten Informationsprozesse auf zwei unterschiedlichen Ebenen: entweder mit geringem kognitiven Aufwand, indem sie automatische Entscheidungsprozesse in Anspruch nehmen oder sie nutzen aktiv vorhandene kognitive Ressourcen und entscheiden bewusst und kontrolliert. Aufgrund dieser Modelle ist anzunehmen, dass Einstellungen von diesen beiden Ebenen Einfluss auf das Verhalten ausüben. Ergebnisse direkter Messverfahren, wie Befragungen, spiegeln in diesem Sinne nur die kontrollierten, sogenannten expliziten Einstellungen wieder. Dem Probanden wird so ermöglicht, kontrolliert zu antworten und Strategien zu entwickeln. Antworttendenzen bzw. Methodeneffekte, wie Soziale Erwünschtheit sind kaum zu vermeiden.
Um automatische Prozesse und sogenannte implizite Einstellungen zu messen, werden indirekte Messverfahren genutzt. Vor allem bei gesellschaftlich sensitiven Themen wie der sexuellen Orientierung oder bei Themen, zu denen eine politisch Korrekte Meinung vorherrscht, ist es wichtig, dass den Probanden keine Möglichkeit zur strategischen Selbstdarstellung gegeben wird. Dies ist mit indirekten Messmethoden möglich.
So lässt sich herausfinden, ob diskriminierende Verhaltensweisen in impliziten Einstellungen begründet sein könnten, auch wenn eine Person scheinbar positiv gegenüber Homosexualität eingestellt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zentrale Erkenntnisse über die indirekte Messung von Einstellungen
- Einstellung gegenüber homosexuellen Frauen und Männern
- Methode zu Messung impliziter Einstellungen gegenüber homosexuellen Frauen und Männern
- Herleitung der Messmethode
- Durchführung
- Auswertung der Ergebnisse
- Einschätzung der Machbarkeit der vorgeschlagenen Messmethode
- Gütekriterien
- Mögliche Probleme und Fehlerquellen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung einer indirekten Messmethode zur Erfassung impliziter Einstellungen gegenüber homosexuellen Frauen und Männern. Die Studie analysiert die Problematik, dass explizite Einstellungen, gemessen durch direkte Verfahren, nur die bewussten und kontrollierten Haltungen widerspiegeln. Durch indirekte Messverfahren sollen hingegen unbewusste, automatische Reaktionen und Einstellungen erfasst werden.
- Indirekte Messung von Einstellungen
- Implizite Einstellungen gegenüber Homosexualität
- Entwicklung einer Messmethode
- Bewertung der Machbarkeit der vorgeschlagenen Methode
- Diskussion der Gütekriterien und möglicher Fehlerquellen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit widmet sich der Einleitung und stellt die Relevanz des Themas Homosexualität in der heutigen Gesellschaft dar. Es wird auf die Diskrepanz zwischen der expliziten Toleranz gegenüber Homosexualität und den Erfahrungen von Diskriminierung durch Homosexuelle hingewiesen. Das zweite Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der indirekten Messung von Einstellungen, die auf automatischen Entscheidungsprozessen und unbewussten Einflüssen basieren. Die verschiedenen Methoden zur Messung impliziter Einstellungen, wie den Impliziten Assoziationstest (IAT) und das affektive Priming, werden vorgestellt und ihre Funktionsweise erläutert. Das dritte Kapitel fokussiert sich auf die spezifischen Herausforderungen bei der Messung von Einstellungen gegenüber Homosexuellen, da diese gesellschaftlich sensitiv sind.
Schlüsselwörter
Implizite Einstellungen, Homosexualität, Indirekte Messmethoden, Impliziter Assoziationstest (IAT), Affektives Priming, Soziale Erwünschtheit, Diskriminierung, Toleranz, Entscheidungsprozesse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen expliziten und impliziten Einstellungen?
Explizite Einstellungen sind bewusst und kontrolliert, während implizite Einstellungen unbewusst und automatisch ablaufen und oft durch direkte Befragungen nicht erfasst werden können.
Warum sind direkte Messverfahren bei Themen wie Homosexualität problematisch?
Aufgrund der sozialen Erwünschtheit neigen Probanden dazu, politisch korrekte Antworten zu geben, was die tatsächlichen (vielleicht tiefer liegenden) Vorurteile verzerrt.
Welche indirekten Messmethoden gibt es?
Zu den bekanntesten Methoden gehören der Implizite Assoziationstest (IAT) und das affektive Priming, die automatische Reaktionszeiten messen.
Können implizite Einstellungen Diskriminierung erklären?
Ja, die Arbeit geht davon aus, dass diskriminierendes Verhalten oft in impliziten Einstellungen begründet liegt, selbst wenn eine Person nach außen hin eine positive Einstellung vorgibt.
Welche Gütekriterien müssen indirekte Messverfahren erfüllen?
Wie alle wissenschaftlichen Tests müssen sie objektiv, reliabel (zuverlässig) und valide (gültig) sein, um verlässliche Aussagen über unbewusste Prozesse treffen zu können.
- Arbeit zitieren
- Natascha Koppermann (Autor:in), 2014, Messung impliziter Einstellungen gegenüber homosexuellen Frauen und Männern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354715