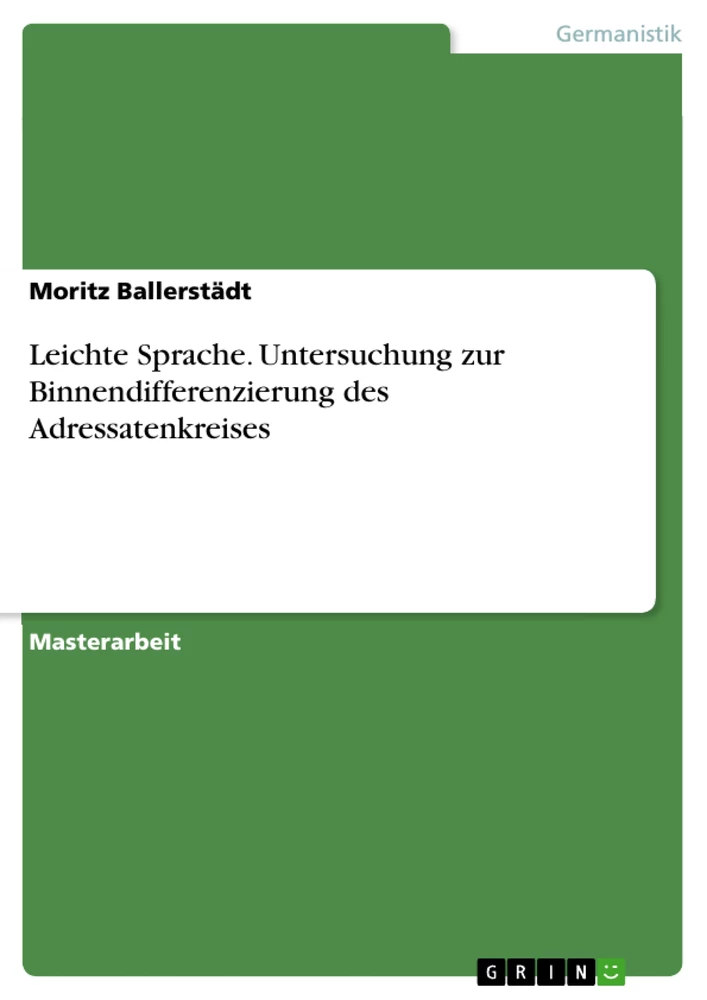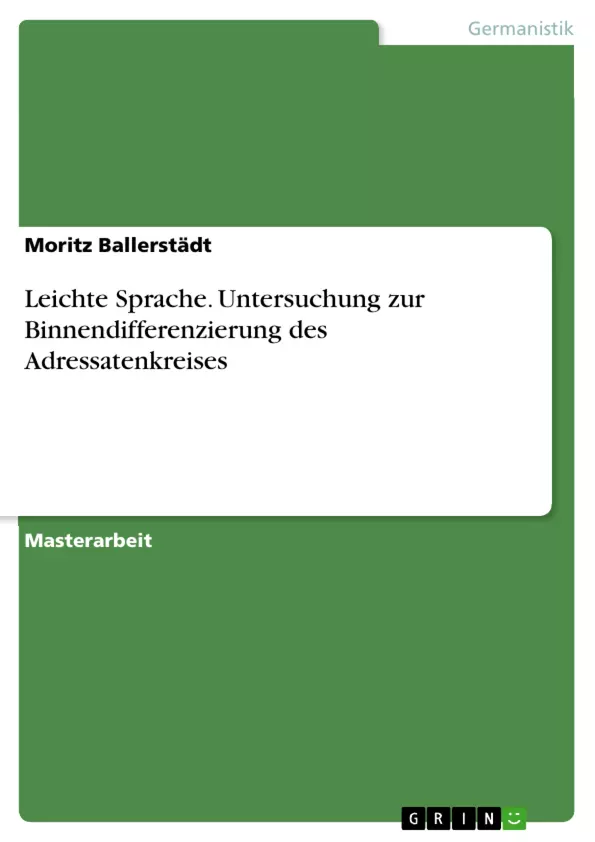Beim Behördengang, bei der Beschaffung von Informationen über das Weltgeschehen, beim Versuch, Recht vor einem Gericht zu bekommen oder sich eben vor jenem zu verteidigen, erweist sich Sprache als unumgänglich. Sprache, mündlich sowie schriftlich, bildet ein essenzielles Fundament unseres alltäglichen Lebens. Doch es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass Akte der Informationsverteilung nicht immer glücken. Die Texte sind zu schwierig zu verstehen. Sprachteilnehmer müssen sich immer öfter bemühen, den Sinn oder die Information, die der Text transportieren soll, zu verstehen. Weil das so ist, setzt sich seit Ende der 1990er Jahre das Konzept „Leichte Sprache“ mehr und mehr durch. Angestrengt durch Menschen mit Lernschwierigkeiten, soll „Leichte Sprache“ das wesentliche Werkzeug für barrierefreie Kommunikation im öffentlichen Raum werden. Die Entwicklungen reichen derart weit, dass nicht nur Menschen mit Lernbehinderungen an „Leichter Sprache“ partizipieren sollen, sondern auch Migranten und Analphabeten. Was allerdings kaum geschieht, das ist die klare Abgrenzung des Adressatenkreises. Die Antwort auf die Frage, wozu „Leichte Sprache“ die genannten Adressaten befähigen soll, steht noch aus.
Um die Sinnhaftigkeit für den Adressatenkreis einschätzen zu können, werden zwei Textsorten beleuchtet, die in ihrer Funktion direkt auf das tägliche Leben der Adressaten abstellen. Gemeint sind Bedienungsanleitungen sowie juristische Texte. Weil die Information bei diesen Texten im Vordergrund steht, sind sie für den Adressatenkreis von besonderer Bedeutung. Anhand der ersten Seite des Sozialhilfeantrages für das Land Berlin werde ich die Erkenntnisse und Regeln zur Vereinfachung selbst anwenden und so versuchen darzustellen, ob so mehr Verständlichkeit hergestellt werden konnte. In dieser Arbeit wird demnach die These vertreten, dass „Leichte Sprache“ nicht für alle Teile des Adressatenkreises dienlich bzw. hilfreich in Bezug auf Verständlichkeit des Deutschen ist. Folglich ergeben sich neben diese Teilziele der Arbeit:
- Das Konzept „Leichte Sprache“ soll dargestellt und – soweit möglich – definiert werden.
- In der Arbeit sollen die unterschiedlichen Positionen zum Adressatenkreis dargestellt und im besten Fall klassifiziert werden.
- Anhand von Praxisbeispielen sollen die Ergebnisse zum Adressatenkreis einer kritischen Prüfung unterzogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangslage und Zielsetzung
- Methodisches Vorgehen
- Stand der Wissenschaft
- Leichte Sprache als Konzept
- Der Begriff „Leichte Sprache“
- Herkunft und Verbreitung
- Regelungen für „Leichte Sprache“
- Das Problem der Verständlichkeit - Indizien für besseres Verstehen
- Für wen ist Leichte Sprache gedacht?
- Menschen mit Lernbehinderung
- Menschen, die das Deutsche als Fremdsprache erlernen
- Funktionale Analphabeten
- Kritische Betrachtung des Adressatenkreises in der Fachliteratur
- Beispiele für Leichte Sprache
- Das Beispiel Bedienungsanleitung
- Interpretation der Arbeitsergebnisse
- Sonderfall Rechtsprechung
- Das Beispiel Gesetzestext in Leichter Sprache aus sprachwissenschaftlicher Sicht
- Das Beispiel Gesetzestext in Leichter Sprache aus Sicht der Bundesministerien
- Einordnung der vorgestellten Textumgestaltungen
- Anwendungsbeispiel: Antrag auf Sozialhilfe
- Diskussion der Arbeitsergebnisse
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht das Konzept der „Leichten Sprache“ und beleuchtet insbesondere die Frage der Binnendifferenzierung im Adressatenkreis. Die Arbeit analysiert, ob und inwiefern „Leichte Sprache“ tatsächlich zu mehr Verständlichkeit für alle Zielgruppen führt, die sie nutzen sollen. Im Fokus stehen dabei Menschen mit Lernbehinderung, Migranten und Funktionale Analphabeten.
- Definition und Abgrenzung des Konzepts „Leichte Sprache“
- Analyse der verschiedenen Zielgruppen von „Leichter Sprache“
- Bewertung der Wirksamkeit von „Leichter Sprache“ im Hinblick auf die Verbesserung der Verständlichkeit
- Untersuchung der Anwendung von „Leichter Sprache“ in verschiedenen Textsorten (Bedienungsanleitungen, Gesetzestexte, Antragsformulare)
- Diskussion der Herausforderungen und Grenzen von „Leichter Sprache“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Masterarbeit vor und erläutert die Ausgangslage sowie die Zielsetzung. Sie führt in das Konzept der „Leichten Sprache“ ein und beleuchtet die verschiedenen Zielgruppen, die von ihr profitieren sollen.
Kapitel 2 gibt einen Überblick über den Stand der Forschung zum Thema „Leichte Sprache“. Es werden verschiedene Ansätze und Perspektiven auf das Konzept vorgestellt, sowie die bisherigen Erkenntnisse zu den Zielgruppen und der Wirksamkeit von „Leichter Sprache“ zusammengefasst.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Konzept der „Leichten Sprache“ selbst. Es werden die sprachlichen Merkmale und die theoretischen Grundlagen von „Leichter Sprache“ erläutert, sowie die verschiedenen Zielgruppen, für die sie konzipiert ist, genauer betrachtet. Die kritische Auseinandersetzung mit dem Adressatenkreis nimmt einen wichtigen Stellenwert ein.
Kapitel 4 untersucht anhand von Beispielen aus der Praxis, wie sich „Leichte Sprache“ in verschiedenen Textsorten, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Gesetzestexten und Antragsformularen, anwenden lässt. Die Analyse der Beispiele soll Aufschluss über die Wirksamkeit von „Leichter Sprache“ in der Praxis geben.
Schlüsselwörter
Leichte Sprache, Binnendifferenzierung, Adressatenkreis, Verständlichkeit, Lernbehinderung, Migranten, Funktionale Analphabeten, Textsorten, Bedienungsanleitungen, Gesetzestexte, Antragsformulare, Barrierefreiheit, Kommunikation, Sprache, Linguistik, Soziologie, Politikwissenschaft, Didaktik.
- Citar trabajo
- Moritz Ballerstädt (Autor), 2015, Leichte Sprache. Untersuchung zur Binnendifferenzierung des Adressatenkreises, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354842