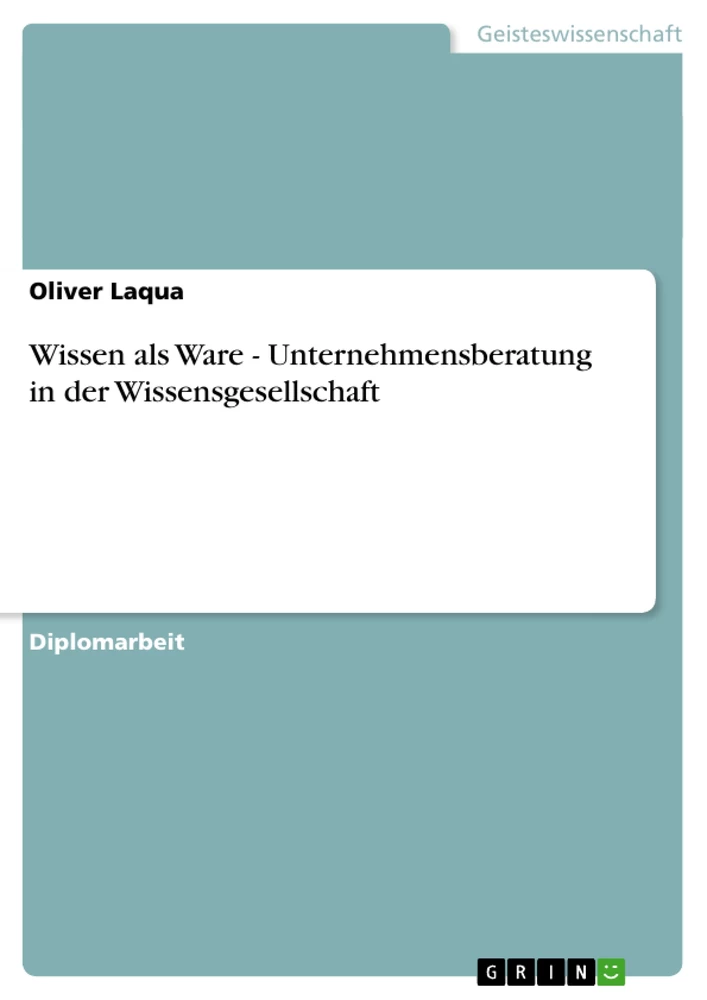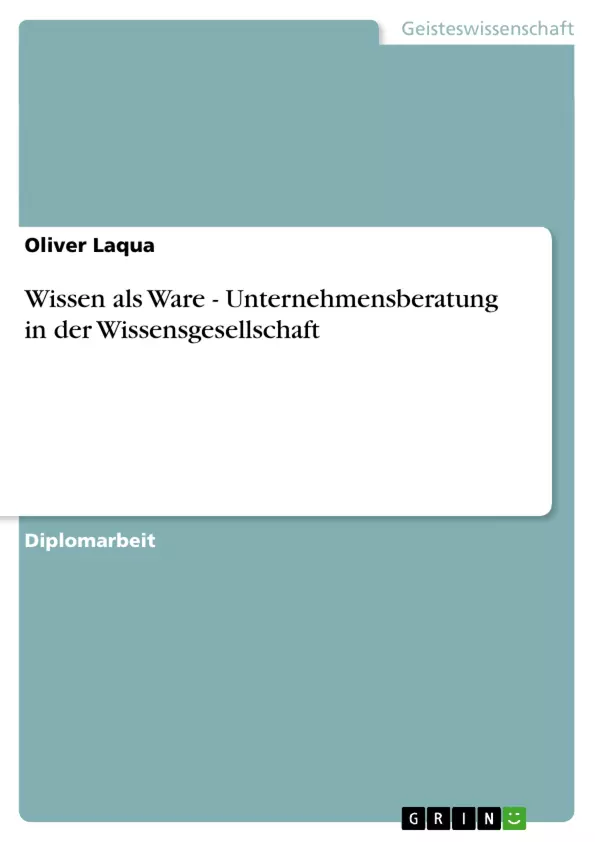Der Diskurs über die Wissensgesellschaft ist kein Produkt der politischen Debatte der 90er Jahre. Auch wenn es den Anschein haben mag, dass die Debatte über den Stellenwert von Wissen für die kapitalistische Produktionsweise erst mit der Popularisierung von Computer und Internet ein Thema für die Politiken der gebildeten Klasse geworden sei, so ist die Problematisierung der Zusammenhänge zwischen Wissen und Gesellschaft, ihrer sozialen und ökonomischen Strukturierung, dennoch deutlich älteren Datums. Ein zentraler Markstein bei der Erfindung der Wissensgesellschaft ist die im Jahr 1973 veröffentlichte Schrift von Daniel Bell über „Die nachindustrielle Gesellschaft“. Ausgehend von der Frage nach der Zukunft der modernen Industriegesellschaft problematisiert Bell den Vermittlungszusammenhang von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen und diagnostiziert das Heraufdämmern einer postindustriellen Gesellschaft durch einen soziotechnischen Strukturwandel. Dieser Struktur-wandel gründet sich vor allem auf die zunehmende Bedeutung des theoretischen Wissens, welches bei Bell die Stellung eines axialen Regulationsprinzips beim Wandel von einer güterproduzierenden zu einer Dienstleistungsgesellschaft einnimmt.
Andre Gorz lässt den „langen Weg zur Wissensgesellschaft“ sogar bei Karl Marx beginnen. 1 Schon Marx habe in den Grundrissen zur politischen Ökonomie die Auffassung vertreten, dass Wissen nicht eine Produktivkraft unter anderen sei, sondern dahin tendiere, sich zur führenden Produktivkraft des Kapitalismus zu entwickeln. Nicht das quantitative Maß der abstrakten Arbeitszeit, sondern die qualitativen Formen des Stands der technischen Entwicklung und des wissenschaftlichen Fortschritts sollten das Prinzip der unternehmerischen Produktion darstellen und den Profit der Unternehmer bestimmen. Die zunehmende Einsparung von Arbeitszeit durch den technischen Fortschritt sollte mit der Vermehrung der freien Zeit zusammenfallen. Am Horizont der Marxschen Theorie konturiert sich das Bild einer Gesellschaft, in der die Menschen sich in Muße befangen den schönen Künsten und hehren Wissenschaften hingeben. Die für die materielle Reproduktion der Gesellschaft notwendige Arbeit steht durch die fortgeschrittene Entwicklung der wissensbasierten Produktivkräfte nicht mehr im Widerspruch mit der allseitigen Entfaltung der Individuen und befreit die Menschen zum Ende dieser Entwicklung aus den Zwängen des kapitalistischen Produktionsverhältnisses.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Diskurs über die Wissensgesellschaft
- Die postindustrielle Wissensgesellschaft (D. Bell)
- Die postkapitalistische Wissensgesellschaft (P.F. Drucker)
- Die informationelle Gesellschaft (M. Castells)
- Wissenswaren und Wissensgesellschaft
- Wissenswaren und Klassenpolitik
- Wissen als Ware
- Unternehmensberatung als Wissensware
- Unternehmensberatung in der erweiterten Kulturindustrie
- Arbeitsbündnisse in der Unternehmensberatung
- Zu Methode und Material
- Wieso überhaupt Unternehmensberatung?
- Der Unternehmensberater als (externe) Fachkraft
- Der Unternehmensberater als Krisenmanager
- Der Unternehmensberater als Guru
- Der Unternehmensberater als Vermittler
- Die Beratungsmotive und Beratertypen
- Das Unternehmensprofil
- Unternehmensgröße
- Personalisierung
- Professionalisierung
- Design
- Selbstdarstellung durch die Profilierung des Unternehmens
- Das Leistungsprofil
- Notwendigkeit
- Qualität
- Exklusivität
- Rentabilität
- Selbstdarstellung durch die Profilierung von Leistungen
- Das Arbeitsbündnis der inszenierten Exklusivität
- Der Diskurs um die Wissensgesellschaft
- Wissen als Ware
- Unternehmensberatung als Wissensware
- Kulturindustrie und Wissensarbeit
- Arbeitsbündnisse in der Unternehmensberatung
- Einleitung: Diese Einleitung stellt den Kontext des Diskurses über die Wissensgesellschaft dar und erläutert die Relevanz des Themas. Sie bezieht sich auf die Schriften von Daniel Bell und André Gorz, die die Entstehung der Wissensgesellschaft in Verbindung mit dem Strukturwandel der modernen Industriegesellschaft analysieren.
- Der Diskurs über die Wissensgesellschaft: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Konzepte der Wissensgesellschaft, darunter die postindustrielle Wissensgesellschaft (D. Bell), die postkapitalistische Wissensgesellschaft (P.F. Drucker) und die informationelle Gesellschaft (M. Castells). Es wird die Bedeutung von Wissen als Ware in diesem Kontext thematisiert.
- Wissenswaren und Klassenpolitik: Dieses Kapitel analysiert die Beziehung zwischen Wissen und Ware und setzt diese in Bezug zur Klassenpolitik. Es wird diskutiert, wie Wissen als Ware fungiert und die Rolle der Unternehmensberatung in diesem Prozess untersucht.
- Arbeitsbündnisse in der Unternehmensberatung: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung und Entwicklung von Arbeitsbündnissen in der Unternehmensberatung. Es werden die unterschiedlichen Rollen von Unternehmensberatern und deren Einfluss auf die Arbeitswelt betrachtet.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Rolle von Wissen in der modernen Gesellschaft, insbesondere im Kontext der Unternehmensberatung. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Diskurses um die Wissensgesellschaft und stellt die These auf, dass Wissen zunehmend als Ware betrachtet wird. Sie untersucht die Bedeutung von Unternehmensberatung als Wissensware und ihren Einfluss auf die Kulturindustrie. Die Arbeit beleuchtet zudem die Arbeitsbündnisse in der Unternehmensberatung und analysiert deren Einfluss auf die Gestaltung der Arbeitswelt.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Wissensgesellschaft, Wissen als Ware, Unternehmensberatung, Kulturindustrie, Arbeitsbündnisse, Klassenpolitik, Strukturwandel und soziale Objektivitäten. Sie untersucht die Beziehung zwischen Wissen, Arbeit und Kapital sowie die Rolle der gebildeten Klasse in der Gestaltung der modernen Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Wissen als Ware“?
Der Begriff beschreibt die Entwicklung, in der theoretisches und technisches Wissen zum zentralen Produktivfaktor und Handelsgut in der modernen Wirtschaft (Wissensgesellschaft) wird.
Welche Rolle spielt Daniel Bell in der Debatte?
Daniel Bell diagnostizierte bereits 1973 in seinem Werk über die „nachindustrielle Gesellschaft“ den Wandel von einer güterproduzierenden zu einer Dienstleistungsgesellschaft, in der Wissen das zentrale Regulationsprinzip ist.
Warum wird Unternehmensberatung als „Wissensware“ bezeichnet?
Unternehmensberater verkaufen spezialisiertes Wissen und Problemlösungskompetenzen als Dienstleistung, wodurch Wissen direkt ökonomisch verwertet und als Ware gehandelt wird.
Welche Typen von Unternehmensberatern werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Rollen: den Berater als externe Fachkraft, als Krisenmanager, als „Guru“ oder als Vermittler.
Hatte Karl Marx bereits Vorstellungen von einer Wissensgesellschaft?
Laut André Gorz vertrat Marx bereits in den „Grundrissen“, dass Wissen zur führenden Produktivkraft des Kapitalismus tendiert und die Bedeutung der bloßen Arbeitszeit verringern würde.
- Quote paper
- Oliver Laqua (Author), 2004, Wissen als Ware - Unternehmensberatung in der Wissensgesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35484