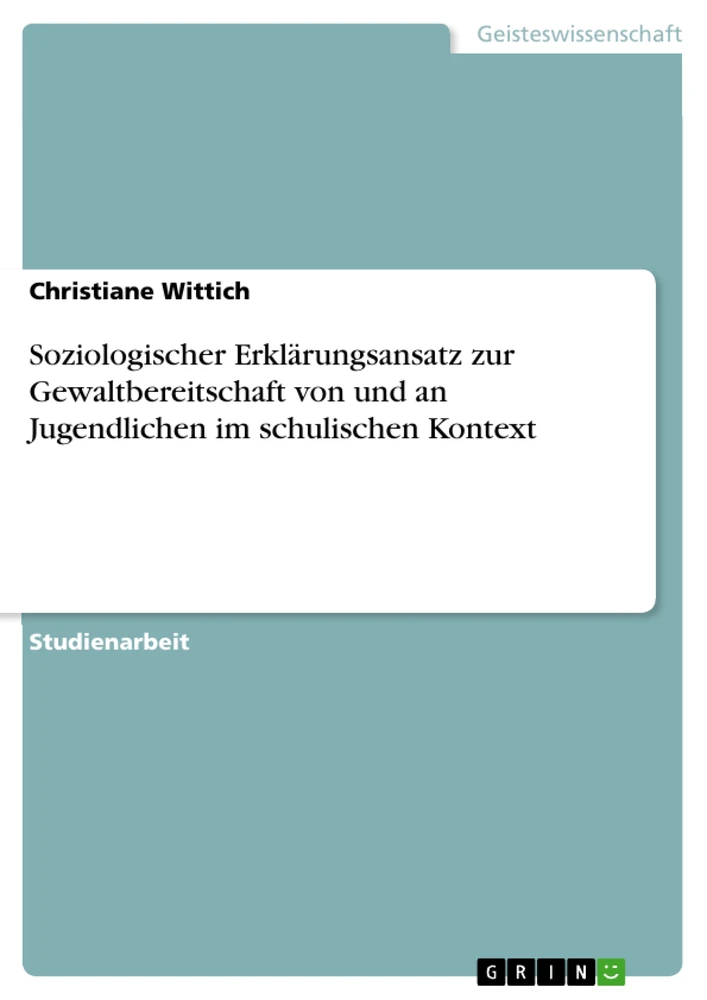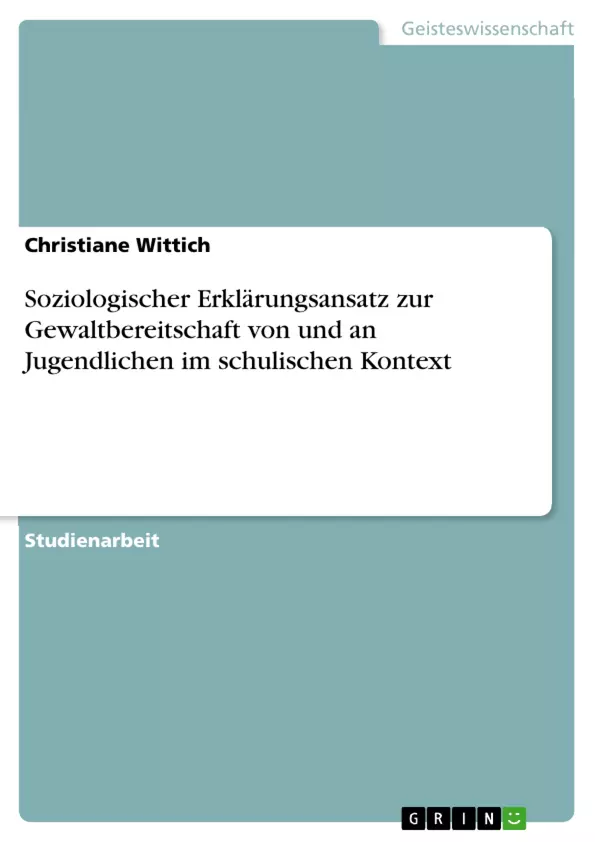Gewalt von und an Jugendlichen ist leider ein bekanntes Phänomen. Schüler bringen viele Probleme mit in die Schule, durch die diese oftmals zum Tatort wird. Es gibt unterschiedliche Arten von Gewalt, wobei die physische Gewalt die „erheblichste Gewaltkategorie“ (Kassis 2004:252) in der Schule ist. Wie kommt es dazu und wie lässt sich dieses Gewaltphänomen soziologisch erfassen?
Zur Beantwortung der Fragen soll in dieser Arbeit das Desintegrations-Verunsicherungs-Gewalt-Konzept von Heitmeyer (1995c:57ff.) als möglicher sozialisationstheoretischer Ansatz vorgestellt werden, der von sich beansprucht, neben dem Rechtsextremismus auch Gewalt von und an Jugendlichen beschreiben und erklären zu können. Dieses Konzept wird anschließend analysiert und es wird kritisch hinterfragt, inwiefern es die empirische Realität im Schulkontext erfassen und erklären kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Der Begriff der Gewalt und seine Dimensionen – im Allgemeinen und Speziellen......……….
- 2.1 Gewalt und ihre Dimensionen – im Allgemeinen.
- 2.2 Gewalt und ihre Dimensionen – im Speziellen.
- 3. Erklärungsansatz: Desintegrations-Verunsicherungs-Gewalt-Konzept
- 3.1 Die Basis: Der Faktor Individualisierung / Herleitung .......
- 3.2 Der Faktor Desintegration .\n
- 3.3 Mögliche Folge der Desintegration: Der Faktor Verunsicherung\n
- 3.4 Die mögliche Folge der Verunsicherung: Gewalt...\n
- 3.5 Einordnung in das Konzept: Auswirkungen auf die soziale Institution Schule und ihre Rolle in der Gesellschaft.\n
- 4. Kritische Reflexion
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem soziologischen Erklärungsansatz zur Gewaltbereitschaft von und an Jugendlichen im schulischen Kontext. Sie untersucht das Desintegrations-Verunsicherungs-Gewalt-Konzept von Heitmeyer und analysiert dessen Anwendbarkeit auf das Phänomen der Gewalt in Schulen.
- Definition des Begriffs Gewalt und seine Dimensionen im Allgemeinen und Speziellen.
- Darstellung des Desintegrations-Verunsicherungs-Gewalt-Konzepts von Heitmeyer.
- Analyse der Auswirkungen des Konzepts auf die soziale Institution Schule.
- Kritische Reflexion der Anwendbarkeit des Konzepts auf die empirische Realität im Schulkontext.
- Zusammenfassung der Erkenntnisse und Schlussfolgerungen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung stellt das Phänomen der Gewalt von Jugendlichen im schulischen Kontext vor und führt in das Desintegrations-Verunsicherungs-Gewalt-Konzept von Heitmeyer ein. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen Sozialisation und Gewaltbereitschaft sowie die Bedeutung des Konzepts für die Analyse des Phänomens.
- Kapitel 2: Der Begriff der Gewalt und seine Dimensionen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs Gewalt und seinen verschiedenen Dimensionen. Es analysiert die Vielschichtigkeit des Phänomens und die unterschiedlichen Ansätze in der soziologischen Gewaltforschung.
- Kapitel 3: Erklärungsansatz: Desintegrations-Verunsicherungs-Gewalt-Konzept: Dieses Kapitel stellt das Desintegrations-Verunsicherungs-Gewalt-Konzept von Heitmeyer vor. Es beschreibt die zentralen Elemente des Konzepts, darunter die Faktoren Individualisierung, Desintegration und Verunsicherung, sowie deren Zusammenhang mit Gewaltbereitschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt das Phänomen der Gewalt von und an Jugendlichen im schulischen Kontext. Die zentralen Themen sind: Gewalt, Sozialisation, Individualisierung, Desintegration, Verunsicherung, Schule, und das Desintegrations-Verunsicherungs-Gewalt-Konzept.
- Quote paper
- Christiane Wittich (Author), 2016, Soziologischer Erklärungsansatz zur Gewaltbereitschaft von und an Jugendlichen im schulischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354855