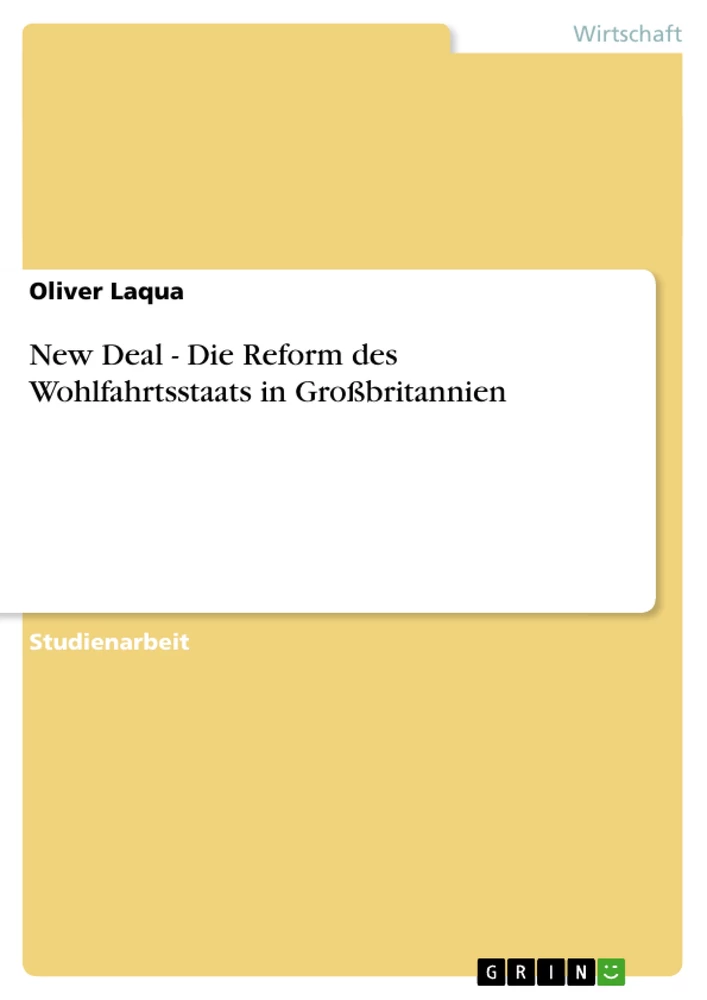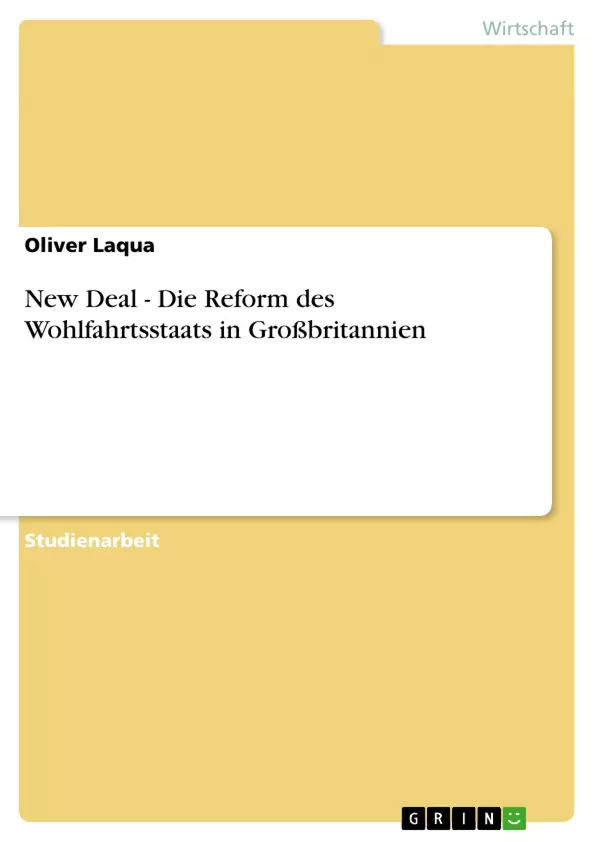Die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der europäischen Wohlfahrtsstaaten unterliegt in den neunziger Jahren einem tiefgreifenden Wandlungsprozess. Dieser Wandlungsprozess gestaltet sich zwar in den einzelnen Nationalstaaten durchaus unterschiedlich, ihm liegt jedoch eine Problemkonstellation zugrunde, deren Tragweite eine europäische Dimension besitzt: Zum einen befinden sich die europäischen Länder in dem Dilemma, dass sich im Zuge der fortschreitenden Globalisierung die ökonomischen Entwicklungsprozesse der Kapitalverwertung zunehmend der nationalstaatlichen Regulierung entziehen, die sozialen Nebenwirkungen dieser Entwicklungsprozesse – wie Armut, Arbeitslosigkeit und Migration – sich aber in den nationalen Systemen der sozialen Sicherung konzentrieren. Zum anderen sieht sich die Arbeits- und Sozialpolitik in Europa mit der Herausforderung konfrontiert, dass die Flexibilisierung der Arbeits- und Lebensformen ohne die Regulierung durch staatliche und zivilgesellschaftliche Institutionen auch das Potential zu einer Vergrößerung der Beschäftigungsrisiken und einer Zunahme sozialer Ungleichheit in sich birgt. Das weder Globalisierung noch Flexibilisierung als sozialökonomische Trends für sich genommen bereits eine erfolgsversprechende Antwort auf die Reform des Wohlfahrtsstaates darstellen, wird sowohl aus der Betrachtung von Ländern deutlich, deren Reformmaßnahmen sich auf die Deregulierung des Arbeitsmarktes und der sozialen Sicherungssysteme beschränken wie auch mit Blick auf die Länder, deren Reformstrategien den Versuch involvieren, für die zunehmend flexibleren Arbeits- und Lebensformen eine angemessene soziale Absicherung zu schaffen. Während erstere (v.a. die USA) sich auf die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit durch eine angebotsorientierte Arbeitsmarktpolitik und den Abbau sozialer Absicherung, unter Inkaufnahme von zunehmender Armut - sogar bei Erwerbstätigkeit im Rahmen von Vollzeitbeschäftigung (working poor) - beschränken, versuchen letztere (z.B. Schweden, Dänemark und die Niederlande) eine sozialverträgliche Strategie der weltmarktorientierten Modernisierung des Wohlfahrtsstaats zu entwickeln, welche eine regulierte Flexibilisierung der Arbeitsbeziehungen mit einer schrittweisen Reorganisation der sozialen Sicherungssysteme verbindet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das britische System der sozialen Sicherung
- 3. Die Reform des britischen Wohlfahrtsstaats unter New Labour - Der New Deal
- 3.1. Work for those who can - Security for those who cannot
- 3.2. Der New Deal
- 4. Die Welfare-to-Work-Programme
- 4.1. Workfare oder Activation?
- 4.2. Der Welfare-to-Work-Ansatz
- 4.3. Die britischen Welfare-to-Work-Programme
- 4.3.1. New Deal for Young People
- 4.3.2. New Deal 25plus
- 5. New Deal - Ein Best Practice-Modell bei der Vermittlung von Flexibilität und sozialer Sicherheit?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Reform des britischen Wohlfahrtsstaates unter New Labour, insbesondere die Einführung des New Deal. Sie untersucht die strukturellen Grundlagen und die sozialpolitische Ausgangslage der Reform, sowie die konkreten Maßnahmen des New Deal, insbesondere die Welfare-to-Work-Programme. Ziel ist es, zu beurteilen, ob das britische Konzept zur Reform des Wohlfahrtsstaates als ein Best Practice-Beispiel bewertet werden kann, welches sowohl durch erfolgreiche Maßnahmen bei der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit als auch durch eine wirksame Strategie der Beseitigung sozialer Ungleichheit gekennzeichnet ist.
- Die strukturellen Grundlagen des britischen Wohlfahrtsstaates und die Herausforderungen durch Globalisierung und Flexibilisierung
- Die sozialpolitische Ausgangslage der Reform unter New Labour
- Die zentralen Elemente des New Deal und die Welfare-to-Work-Programme
- Die Evaluation des New Deal als Best Practice-Modell
- Die Bedeutung von Flexibilität und sozialer Sicherheit im Kontext des britischen Reformversuchs
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Einleitung und stellt den Kontext der Reform des britischen Wohlfahrtsstaates dar. Es wird die Problemkonstellation aus Globalisierung, Flexibilisierung und dem Dilemma der nationalen Regulierung erläutert. Außerdem wird der Reformversuch von New Labour mit seinen Zielen vorgestellt.
Das zweite Kapitel beschreibt das britische System der sozialen Sicherung und seine historischen Entwicklungen. Es werden die zentralen Elemente des Sozialsystems, wie die National Insurance und die verschiedenen Sozialleistungen, erläutert.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Reform des britischen Wohlfahrtsstaates unter New Labour und die Einführung des New Deal. Es werden die Ziele und die zentralen Elemente des New Deal, sowie die wichtigsten Maßnahmen, wie die Welfare-to-Work-Programme, vorgestellt.
Das vierte Kapitel behandelt die Welfare-to-Work-Programme im Detail. Es wird der Ansatz von Workfare und Activation erläutert, und die verschiedenen Programme, wie der New Deal for Young People und der New Deal 25plus, werden beschrieben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Seminararbeit sind: britischer Wohlfahrtsstaat, New Labour, New Deal, Welfare-to-Work-Programme, Globalisierung, Flexibilisierung, Arbeitsmarktpolitik, soziale Sicherung, Arbeitslosigkeit, soziale Ungleichheit, Best Practice-Modell.
Häufig gestellte Fragen
Was war der "New Deal" unter New Labour in Großbritannien?
Es war eine umfassende Reform des Wohlfahrtsstaates mit dem Ziel, Arbeitslosigkeit durch "Welfare-to-Work"-Programme aktiv zu bekämpfen.
Was unterscheidet "Workfare" von "Activation"?
Workfare betont die Arbeitspflicht als Bedingung für Sozialleistungen, während Activation eher auf die aktive Förderung und Befähigung zur Arbeitsaufnahme setzt.
Was ist das Ziel der "Welfare-to-Work"-Programme?
Diese Programme sollen Langzeitarbeitslose und junge Menschen durch gezielte Unterstützung und Sanktionen schneller in den Arbeitsmarkt integrieren.
Gilt der britische New Deal als Best-Practice-Modell?
Die Arbeit evaluiert, ob das Modell erfolgreich Flexibilität am Arbeitsmarkt mit sozialer Sicherheit verbindet oder ob es soziale Ungleichheit verschärft.
Welche Rolle spielt die Globalisierung bei der Reform des Wohlfahrtsstaates?
Die Globalisierung entzieht ökonomische Prozesse der nationalen Regulierung, während soziale Folgen wie Arbeitslosigkeit die nationalen Sicherungssysteme belasten.
- Quote paper
- Oliver Laqua (Author), 2001, New Deal - Die Reform des Wohlfahrtsstaats in Großbritannien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/35488