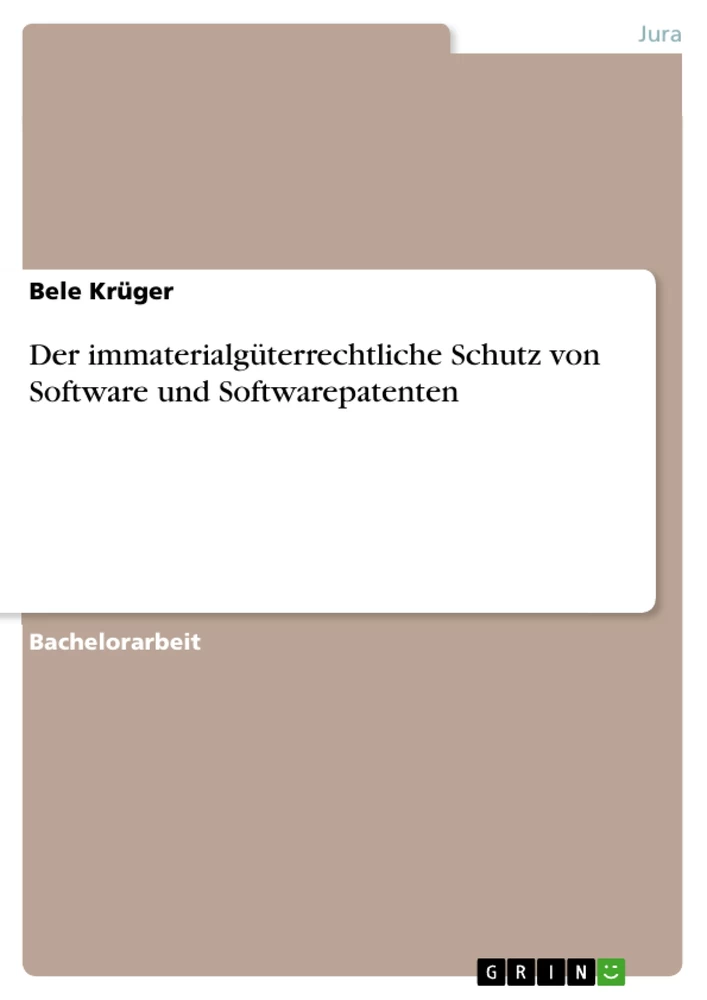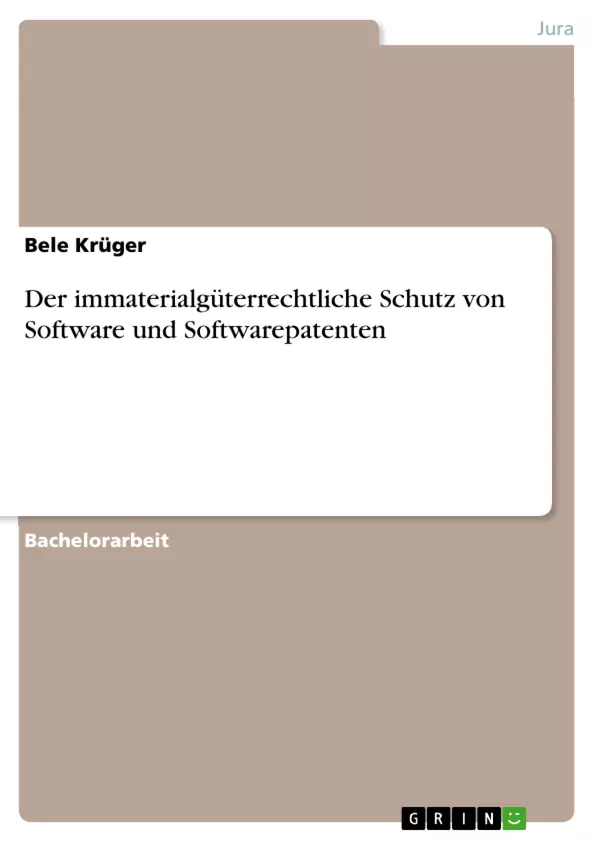Während unser Alltag im letzen Jahrhundert noch durch klassisch-mechanische Maschinen erleichtert wurde, rückte zunehmend die Kategorie des Verhaltens der Maschine ins Zentrum der Diskussion. Unser Alltag wird maßgeblich und zunehmend durch Software bestimmt: Man denke nur an den virtuellen Einkaufswagen, das One-Click-One-Buy Prinzip von Amazon, oder den MP3-Player. Und die Bedeutung von Software wächst stetig, als Wirtschaftsgut und zur Steuerung und Verwaltung von Geschäftsprozessen. Ein hinreichender Schutz ist unerlässlich, in rein technischer Weise aber kaum möglich.
Als einzige Lösung bleibt zum einen der privatrechtliche gewerbliche Rechtsschutz, der das geistig gewerbliche Schaffen fördert und schützt, vor allem das Patentrecht. Zum anderen das dem gewerblichen Rechtsschutz "benachbarte" Urheberrecht, das geistigen Schöpfungen mit persönlichem Charakter Schutz gewährt. Fraglich ist in wie weit und in welcher Weise ein solcher Schutz erfolgt und erfolgen soll.
Diese Arbeit analysiert den gewerblichen Rechtsschutz von Software, mit dem Fokus auf Softwarepatenten. In Kapitel B werden die grundlegenden Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Software erklärt. In Kapitel C erfolgt ein kurzer internationaler Rechtsvergleich mit Fokus auf die USA. Kapitel D enthält die juristische Analyse zur bestehenden Rechtslage in Deutschland, im Zentrum steht das Patentrecht. Kapitel E gewährt eine Zusammenfassung und einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- A. Einführung
- B. Begriffsbestimmung
- I. Computerprogramm
- 1. Quellformat
- 2. Objektformat
- II. Computerimplementierung
- I. Computerprogramm
- C. Internationaler Rechtsvergleich
- I. USA
- 1. Gesetzliche Regelung
- a) § 100 und § 101 Patent Act
- b) Auslegung der Rechtsbegriffe
- 2. Richterliches Patentierungsverbot
- a) O'Reilly vs. Morse
- b) Diamond vs. Chakrabarty
- 3. Rechtsprechung
- a) Restriktive frühere Rechtsprechung
- b) Öffnung
- aa) Parker vs. Flook
- bb) Diehr Fall
- cc) Freeman-Walter-Abele Test
- c) Totalöffnung
- d) Aktuelle Entwicklungen
- aa) Einschränkung der Patentierbarkeit
- bb) Prüfungsverlagerung und Technikkriterium
- II. Weitere Länder
- 1. Gesetzliche Regelung
- D. Schutzmöglichkeiten
- I. Urheberrecht
- 1. Schutzvoraussetzungen des Urheberrechts
- a) Persönliche geistige Schöpfung
- b) Abgrenzung zu Ideen
- 2. Schutzumfang des Urheberrechts
- 1. Schutzvoraussetzungen des Urheberrechts
- II. Patentrecht
- 1. Schutzvoraussetzungen der Patentierbarkeit
- a) Die Technische Erfindung
- aa) Funktion
- bb) Begriffsbestimmung durch die Rechtsprechung
- cc) Negativdefinition kraft gesetzlicher Fiktion
- b) Qualitative Anforderungen
- aa) Neuheit und gewerbliche Anwendbarkeit
- bb) Erfinderische Tätigkeit
- a) Die Technische Erfindung
- 2. Rechtsprechung
- a) Prüfung des Technizitätskriteriums
- aa) Historische Entwicklung
- bb) Differenzierung nach Anspruchsgegenstand
- b) Unterschiedliche Praxis zwischen EPA und BGH
- c) Prüfungsverlagerung auf die erfinderische Tätigkeit
- a) Prüfung des Technizitätskriteriums
- 3. Der Schutzumfang des Patents
- III. Ausdehnung des Patentschutzes durch Softwarepatente
- 1. Konfliktpotenzial zwischen Patent- und Urheberrecht
- 2. Richtlinienvorschlag
- 3. Debatte um Softwarepatente
- a) Argumente für Softwarepatente
- aa) Urheberrechtlicher Schutz unsachgerecht
- bb) Kriminalisierung der Endverbraucher
- cc) Volkswirtschaftliche Argumente
- b) Argumente gegen Softwarepatente
- aa) Open Source Software
- bb) Recherche zum Stand der Technik
- cc) Hohe Kosten, Patentverletzungen und Monopole
- a) Argumente für Softwarepatente
- 4. Umsetzungsvorschläge und Implikationen
- a) Funktionaler Schutz von Softwarepatenten
- b) Reformation des Technikkriteriums
- IV. Weitere Schutzrechte
- 1. Gebrauchsmusterrecht
- a) Allgemeines und Schutzvoraussetzungen
- b) Ausschluss für Computerprogramme und Verfahren
- 2. Markenschutz und Geschmacksmusterschutz
- 3. Know-How-Schutz und wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz
- 1. Gebrauchsmusterrecht
- 1. Schutzvoraussetzungen der Patentierbarkeit
- Schutzmöglichkeiten für Software im Urheber- und Patentrecht
- Herausforderungen der Patentfähigkeit von Software
- Aktueller Stand der Rechtsprechung und Diskussion um Softwarepatente
- Konfliktpotenzial zwischen Urheber- und Patentrecht
- Argumente für und gegen Softwarepatente
- A. Einführung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Relevanz des immaterialgüterrechtlichen Schutzes von Software im Kontext der Digitalisierung.
- B. Begriffsbestimmung: Dieser Abschnitt definiert die zentralen Begriffe "Computerprogramm" und "Computerimplementierung" und legt damit den Grundstein für die weitere Analyse.
- C. Internationaler Rechtsvergleich: Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Rechtsprechung zum Thema Softwarepatente in den USA und in anderen Ländern. Es zeigt die verschiedenen Ansätze und Entwicklungen im internationalen Kontext auf.
- D. Schutzmöglichkeiten: Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Schutzmöglichkeiten für Software im Urheber- und Patentrecht. Es werden die Schutzvoraussetzungen und der Schutzumfang der beiden Rechte erläutert und im Hinblick auf Software diskutiert.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem immateriellen Schutz von Software. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, welche Schutzmöglichkeiten sich im Urheber- und Patentrecht bieten und welche Herausforderungen sich im Rahmen der Patentfähigkeit von Software stellen. Ziel der Arbeit ist es, einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Rechtsprechung und die Diskussion um Softwarepatente zu liefern.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Schlüsselwörter (Keywords)
Software, Immaterialgüterrecht, Urheberrecht, Patentrecht, Softwarepatente, Technizitätskriterium, Patentfähigkeit, Rechtsprechung, Internationaler Rechtsvergleich, Open Source Software, Konfliktpotenzial.
Häufig gestellte Fragen
Kann man Software durch Patente schützen?
Ja, unter bestimmten Voraussetzungen sind computerimplementierte Erfindungen patentierbar, sofern sie einen technischen Charakter aufweisen und die Kriterien Neuheit und erfinderische Tätigkeit erfüllen.
Was ist der Unterschied zwischen Urheberrecht und Patentrecht bei Software?
Das Urheberrecht schützt den konkreten Programmcode (Ausdrucksform), während das Patentrecht die zugrunde liegende technische Lösung oder Funktion (Idee) schützt.
Was versteht man unter dem 'Technizitätskriterium'?
Es ist die Voraussetzung, dass eine Erfindung ein technisches Problem mit technischen Mitteln lösen muss. Rein mathematische Algorithmen oder Geschäftsmethoden ohne technischen Bezug sind nicht patentierbar.
Wie unterscheidet sich die Rechtslage in den USA von Deutschland?
Die USA hatten historisch eine sehr weite Öffnung für Softwarepatente (Business Methods), während die europäische und deutsche Rechtspraxis strenger auf das Erfordernis der Technizität pocht.
Warum sind Softwarepatente umstritten?
Kritiker befürchten eine Behinderung von Open-Source-Entwicklungen, Monopolbildung und hohe Rechtskosten für kleine Entwickler, während Befürworter den Schutz von hohen Investitionskosten betonen.
- I. Urheberrecht
- I. USA
- Quote paper
- Bele Krüger (Author), 2016, Der immaterialgüterrechtliche Schutz von Software und Softwarepatenten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355007