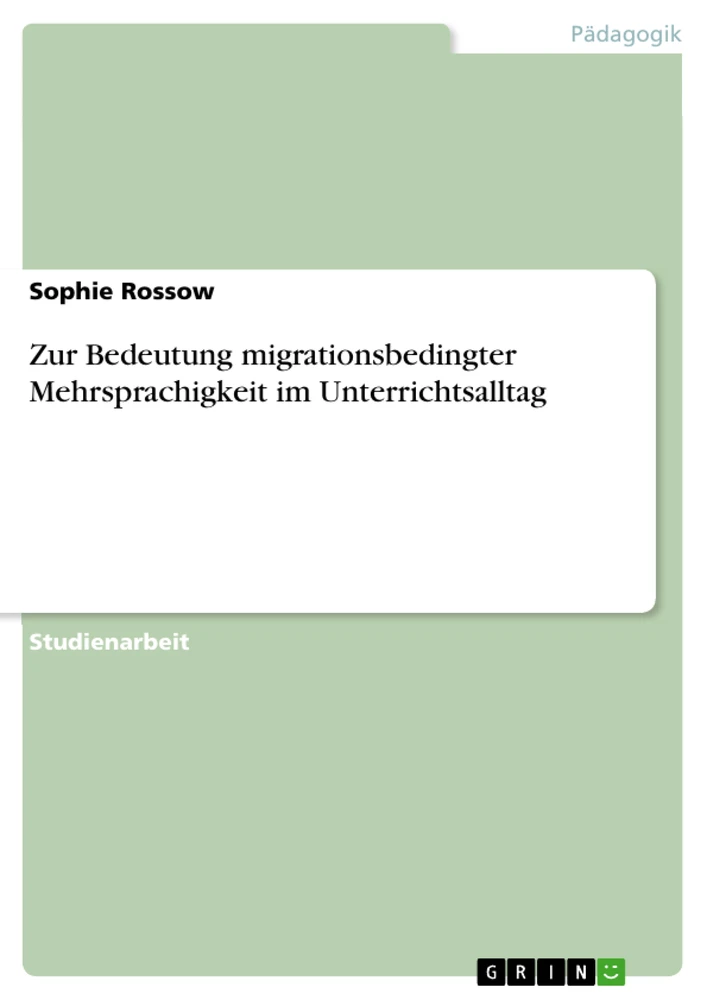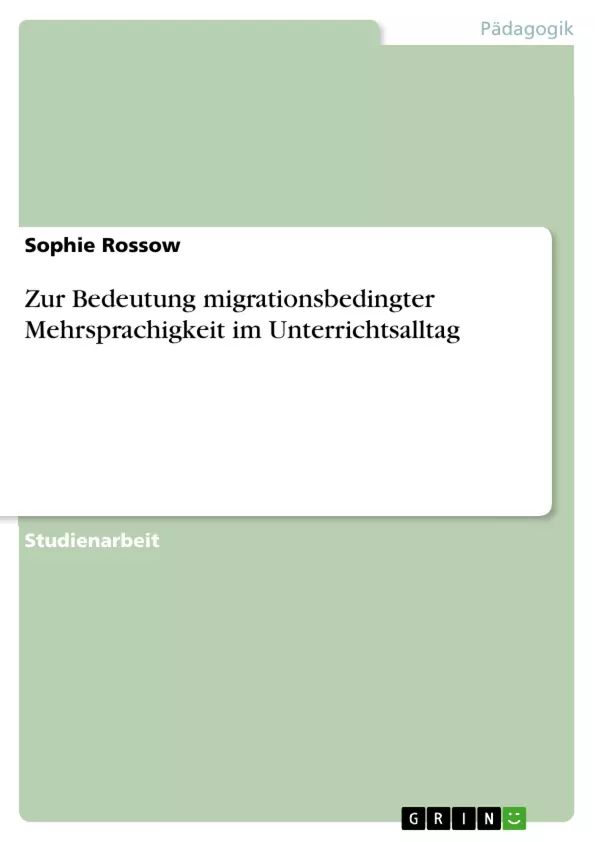Die vorliegende Arbeit thematisiert die Tragweite von Mehrsprachigkeit in der heutigen Zeit, in welcher sich durch die vermehrte Immigration von Flüchtlingen zunehmend einige Kinder im Klassenverband zeitweise nicht oder nur wenig auf Deutsch verständigen können, dafür aber über Kenntnisse einer oder mehrerer anderer Sprachen verfügen. Diesen Sprachen kommt innerhalb der Familien der Migrantenkinder eine besondere Bedeutung zu, da sie auf verbaler Ebene die Grundlage intrafamiliärer Kommunikation darstellen. Nun wird der Erwerb der deutschen Sprache jedoch ebenfalls wichtig, um Integration zu ermöglichen.
Es stellt sich die Frage, inwieweit die Muttersprachen der Kinder beim Spracherwerb weiterer Sprachen eine Rolle spielen und in welchem Ausmaß sie im Unterricht beachtet werden sollten. Sollte eine an Mehrsprachigkeit orientierte Didaktik in den Vordergrund rücken oder ist ein monolingualer Habitus sinnvoll?
Diese Fragestellung wird hierbei vor dem Hintergrund eines inklusiven Unterrichts betrachtet und inkludiert somit auch die Beachtung der Förderung von Kindern, deren Muttersprache Deutsch ist. Im weiteren Verlauf wird der Spracherwerb bei Kindern mit Migrationshintergrund unter verschiedenen Umständen begutachtet und untersucht, inwieweit Sprachförderung und das Lernen von Fremdsprachen für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund sinnvoll sein kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inklusiver Unterricht
- Innere Differenzierung
- Mehrsprachigkeitsdidaktik
- Deutsch als Zweitsprache
- Lernersprache
- Betrachtung der Familie
- Betrachtung des schulischen Umfelds
- Fremdsprachenunterricht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Mehrsprachigkeit im Unterrichtsalltag, insbesondere im Kontext von Migration und Inklusion. Sie analysiert die Herausforderungen und Chancen, die sich aus dem Zusammentreffen verschiedener Sprachen und Kulturen im Schulsystem ergeben.
- Inklusiver Unterricht und die Bedeutung von Heterogenität
- Der Erwerb der deutschen Sprache als Zweitsprache
- Die Rolle der Familie und des schulischen Umfelds im Spracherwerbsprozess
- Die Potenziale der Mehrsprachigkeitsdidaktik
- Der Einfluss des Erstspracherwerbs auf den Zweitspracherwerb
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Mehrsprachigkeit im Kontext der heutigen Migrationsgesellschaft ein. Sie beleuchtet die Bedeutung der Sprachen von Migrantenkindern innerhalb der Familien und die Herausforderungen, die sich aus dem Erwerb der deutschen Sprache als Zweitsprache ergeben.
2. Inklusiver Unterricht
Dieses Kapitel befasst sich mit den Prinzipien des inklusiven Unterrichts und der Notwendigkeit, die Heterogenität der Schüler*innen im Schulsystem zu akzeptieren. Die Bedeutung innerer Differenzierung und der Mehrsprachigkeitsdidaktik wird erläutert.
3. Deutsch als Zweitsprache
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Erwerb der deutschen Sprache als Zweitsprache. Es beleuchtet verschiedene Hypothesen zum Spracherwerb und untersucht die Rolle der Erstsprache, der Familie und des schulischen Umfelds im Zweitspracherwerbsprozess.
4. Fremdsprachenunterricht
Dieses Kapitel befasst sich mit den Chancen und Herausforderungen des Fremdsprachenunterrichts im Kontext von Mehrsprachigkeit. Es werden die Potenziale der Mehrsprachigkeit für den Fremdsprachenunterricht aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Inklusiver Unterricht, Deutsch als Zweitsprache, Migrationshintergrund, Interkulturelle Kompetenz, Sprachförderung, Erstsprache, Familienförderung, Heterogenität, Didaktik, Sprachkompetenz, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat die Muttersprache für Kinder mit Migrationshintergrund?
Die Muttersprache (Erstsprache) ist die Basis der intrafamiliären Kommunikation und bildet das Fundament für die kognitive Entwicklung und den Erwerb weiterer Sprachen.
Was versteht man unter einer Mehrsprachigkeitsdidaktik?
Dies ist ein pädagogischer Ansatz, der die vorhandenen Sprachkenntnisse der Kinder (auch nicht-deutsche Muttersprachen) aktiv in den Unterricht einbezieht, statt sie zu ignorieren.
Ist ein monolingualer Unterricht noch zeitgemäß?
Die Arbeit diskutiert den "monolingualen Habitus" kritisch und stellt die Frage, ob angesichts zunehmender Heterogenität eine Orientierung an der tatsächlichen Mehrsprachigkeit sinnvoller für die Integration ist.
Wie hängen Inklusion und Mehrsprachigkeit zusammen?
Inklusiver Unterricht bedeutet, jedes Kind in seiner Individualität anzunehmen. Dazu gehört auch die Wertschätzung und Förderung seiner sprachlichen Herkunft als Teil seiner Identität.
Was ist "Deutsch als Zweitsprache" (DaZ)?
DaZ bezeichnet den Erwerb der deutschen Sprache durch Menschen, die bereits eine andere Muttersprache sprechen und Deutsch in einem deutschsprachigen Umfeld für den Alltag und die Schule benötigen.
- Citar trabajo
- Sophie Rossow (Autor), 2016, Zur Bedeutung migrationsbedingter Mehrsprachigkeit im Unterrichtsalltag, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355039