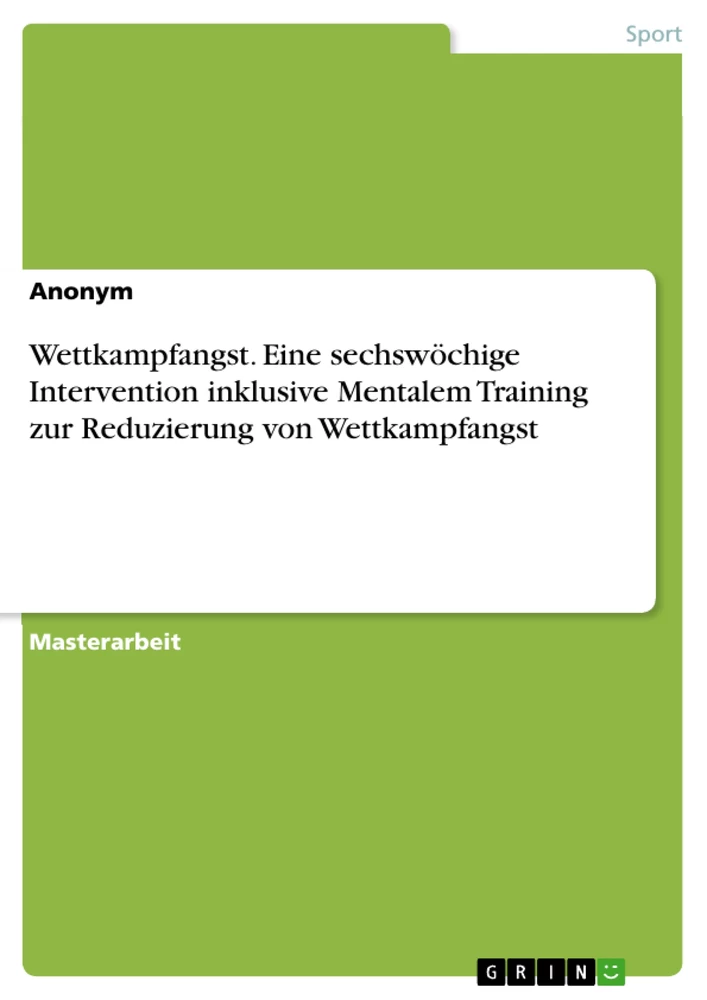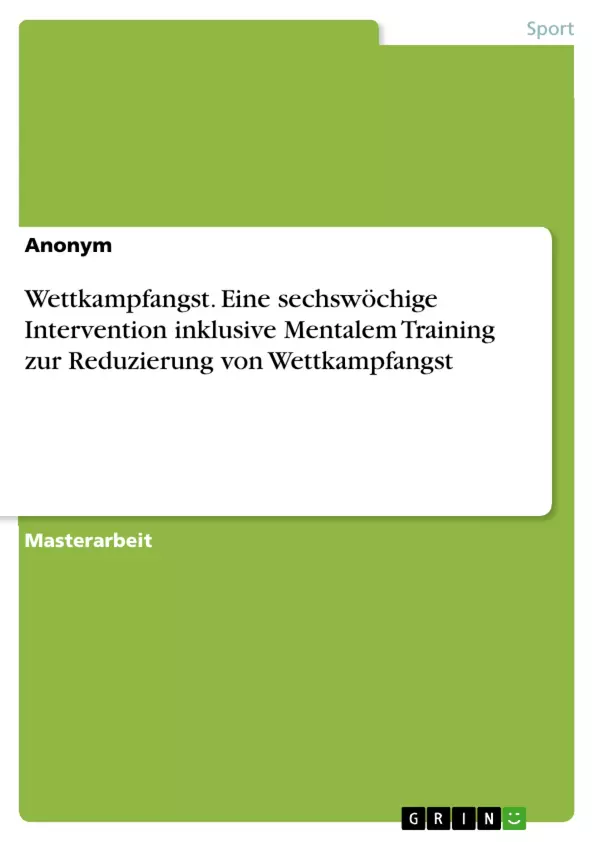Es soll mit Hilfe der vorliegenden Arbeit der Problemstellung nachgegangen werden, welchen Einfluss das MT als singuläre Interventionsmaßnahme auf die Wettkampfangst im Leistungssport „Tennis“ ausübt.
Auf Basis der erläuterten Problemstellung besteht die übergeordnete Zielsetzung darin, mit Hilfe einer Prä-Postmessung und der damit verbundenen Erhebung sportpsychologisch und biometrisch relevanter Daten sowie mittels der Bestimmung sportartspezifischer Kennzahlen im Rahmen einer Einzelfallstudie empirisch zu untersuchen, ob ein Mental Training im Rahmen eines sechswöchigen Interventionsprogramms zu einer Reduzierung der Wettkampfangst beim betrachteten Probanden führt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG
- ZIELSETZUNG
- GEGENWÄRTIGER KENNTNISSTAND
- Emotionen
- Begriffliche Differenzierung zwischen Emotionen und Gefühlen
- Bedeutung von Emotionen und deren Steuerung im Sport
- Angst
- Begriffserläuterung von Angst
- Erklärungsmodelle zur Angstentstehung
- Symptome der Angst
- Wettkampfangst
- Entstehung der Wettkampfangst
- Angstformen im Sport
- Wissenschaftliche Modelle zur Erklärung des Angst-Leistungszusammenhangs
- Bedeutung der Diagnostik in der Sportpsychologie
- Entspannungstraining
- Bedeutung von Spannung und Entspannung im Wettkampfsport
- Ziele und Funktionen von Entspannungsverfahren im Wettkampfsport
- Entspannungsmethoden
- Mentales Training
- Begriffserklärung des Mentalen Trainings
- Ansätze des Mentalen Trainings
- Methoden des Vorstellungstrainings
- Wirkungsweise des Mentalen Trainings
- Voraussetzungen für Mentales Training
- Stufenmodell des Mentalen Trainings nach Eberspächer
- Prozessmodell sportpsychologischer Intervention nach Beckmann und Elbe
- Tennis als Wettkampfsport
- Erklärung der Rückschlagsportart
- Mentale Anforderungen in spezifischen Spielsituationen
- Emotionen
- METHODIK
- Formulierung der Forschungsfrage
- Beschreibung der Stichprobe bzw. des Probanden
- Rekrutierung der Stichprobe
- Zusammensetzung der Stichprobe
- Ort und Zeitpunkt der Untersuchung
- Beschreibung der Messinstrumente
- Beschreibung des Wettkampf-Angst-Inventar State (WAI-S)
- Beschreibung des Wettkampf-Angst-Inventar Trait (WAI-T)
- Beschreibung des Sphygmomanometers
- Beschreibung des Aufschlagmessgerätes
- Erfassung der Zielvariablen vor der Durchführung der Intervention
- Erfassung des Wettkampfangstzustands des Klienten
- Erfassung der Wettkampfängstlichkeit des Klienten
- Erfassung der Aufschlaggeschwindigkeit des Klienten
- Erfassung der Aufschlagquote und der Anzahl der Doppelfehler
- Erfassung relevanter biometrischer Daten des Klienten
- Darstellung des durchgeführten Interventionsprogramms
- Erstgespräch / Vertrag
- Zielbestimmung
- Diagnose
- Ableitung von Interventionsmaßnahmen
- Durchführung der Maßnahme
- Verhaltensoptimierung
- Evaluation
- Erfassung der Zielvariablen nach der Durchführung der Intervention
- Erfassung des Wettkampfangstzustands des Klienten
- Erfassung der Wettkampfängstlichkeit des Klienten
- Erfassung der Aufschlaggeschwindigkeit des Klienten
- Erfassung der Aufschlagquote und der Anzahl der Doppelfehler
- Erfassung relevanter biometrischer Daten des Klienten
- ERGEBNISSE
- DISKUSSION
- Ergebnisinterpretation/Kritische Methodendiskussion
- Ergebnisinterpretation/kritische Methodendiskussion bzgl. der Interventionsergebnisse
- Ergebnisinterpretation bzgl. der übergeordneten Fragestellung der Arbeit
- Erläuterung möglicher Handlungsableitungen und weiterer Forschungsfragen/Problemstellungen
- Erläuterung möglicher Handlungsableitungen für zukünftige Interventionen
- Vorgehensweise während der Rehabilitationsphase
- Mögliche Vorgehensweisen nach Abschluss der Rehabilitationsphase
- Erläuterung möglicher weitere Forschungsfragen bzw. Problemstellungen
- Ergebnisinterpretation/Kritische Methodendiskussion
- ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Thematik der Wettkampfangst im Tennis. Sie hat zum Ziel, den Einfluss von mentalen Trainingsmethoden auf die Reduzierung von Wettkampfangst und die Verbesserung der Leistung im Tennis zu untersuchen. Die Arbeit soll dazu beitragen, ein besseres Verständnis für die Rolle von mentalen Trainingsmethoden in der Sportpsychologie zu entwickeln.
- Die Bedeutung von Emotionen und deren Steuerung im Sport
- Das Phänomen der Wettkampfangst und ihre Auswirkungen auf die Leistung
- Die Wirksamkeit von mentalen Trainingsmethoden zur Reduzierung von Wettkampfangst
- Die Anwendung von mentalen Trainingsmethoden im Tennis
- Der Zusammenhang zwischen mentaler Stärke und sportlicher Leistung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung beleuchtet die Problematik der Wettkampfangst im Sport, insbesondere im Tennis, und führt in die Relevanz der mentalen Stärke und des Mentalen Trainings im Zusammenhang mit sportlicher Leistung ein. Das zweite Kapitel definiert die Zielsetzung der Arbeit und erläutert die Forschungsfrage, welche sich auf den Einfluss von mentalen Trainingsmethoden auf die Wettkampfangst und die Leistung von Tennisspielern konzentriert. Im dritten Kapitel wird der aktuelle Forschungsstand zum Thema Wettkampfangst dargestellt, wobei verschiedene Erklärungsmodelle zur Entstehung der Angst sowie wissenschaftliche Modelle zur Erklärung des Angst-Leistungs-Zusammenhangs beleuchtet werden. Darüber hinaus werden Entspannungstechniken und mentales Training als wichtige Interventionsansätze im Sport erläutert. Das vierte Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit, einschließlich der Stichprobenselektion, der verwendeten Messinstrumente und der Durchführung des Interventionsprogramms. Es geht insbesondere auf die Anwendung des Mentalen Trainings im Rahmen der Intervention ein. Das fünfte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie und analysiert die Daten hinsichtlich des Einflusses des Mentalen Trainings auf die Wettkampfangst und die Leistung der Tennisspieler. Die Diskussion im sechsten Kapitel interpretiert die Ergebnisse, diskutiert die methodische Vorgehensweise und leitet mögliche Handlungsableitungen für zukünftige Interventionen sowie weitere Forschungsfragen ab.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Wettkampfangst, mentales Training, Tennis, Leistung, Sportpsychologie, Intervention, Emotion, Konzentration, Selbstregulation, Bewegungsvorstellung, Interventionsprogramm, Ergebnisinterpretation, Handlungsableitungen und weitere Forschungsfragen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Wettkampfangst. Eine sechswöchige Intervention inklusive Mentalem Training zur Reduzierung von Wettkampfangst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355116