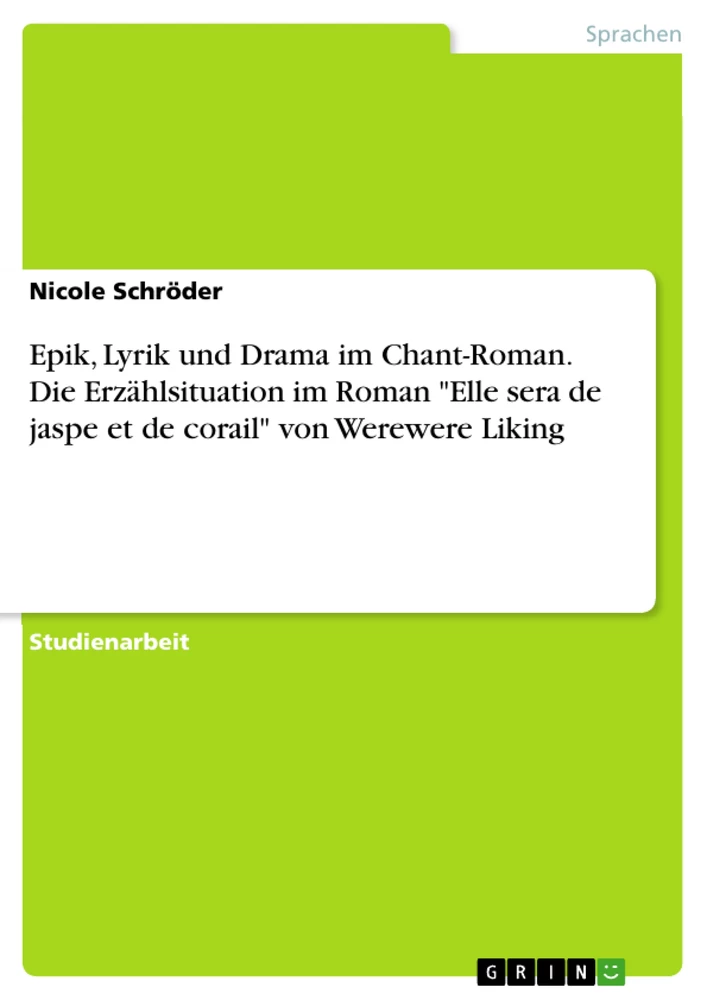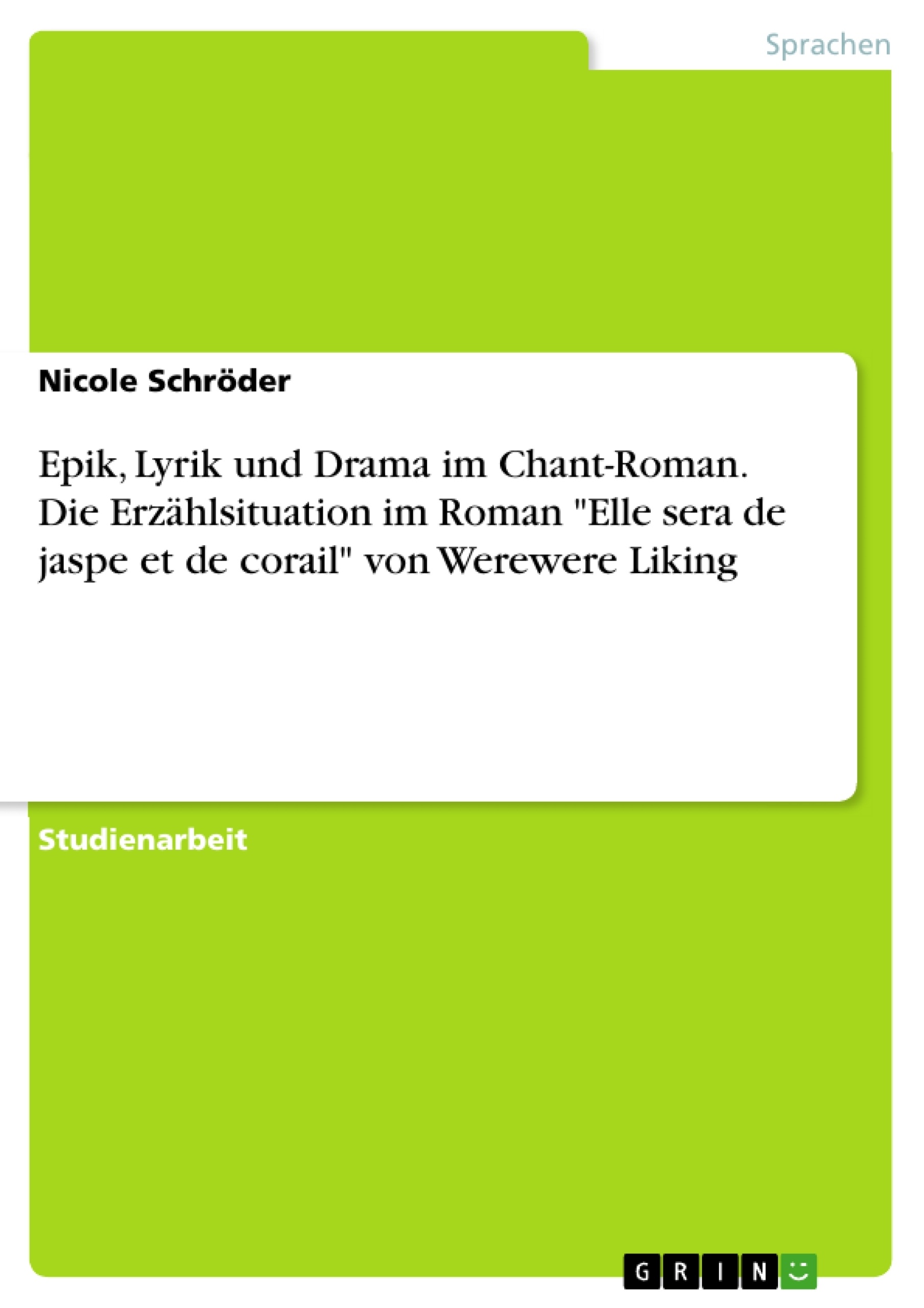In dieser Arbeit wird die Erzählweise des modernen westafrikanischen Romans „Elle sera de Jaspe et de Corail“ aus zwei Sichweisen unter die Lupe genommen: Einmal aus der literaturtheoretischen Perspektive Stanzels, dessen Erzähltheorie zu den grundlegenden Theorien der Literaturwissenschaft gehört. In einem zweiten Ansatz wird die Erzählperspektive kulturtheoretisch definiert und der Schreib- bzw. Erzählprozess selbst wird als Heilungsritual der Bassa ein von der Romanhandlung unabhängiger Prozess der Reinigung und der Initiation.
„Elle sera de Jaspe et de Corail“ ist ein Chant-Roman. Was bedeutet dies genau? Diese Bezeichnung – durch die Autorin selbst gegeben – weist bereits auf der Titelseite des Romans auf den vielschichtigen Charakter des Werkes hin. Es besitzt neben dem erzählenden Text Elemente der Lyrik und dramatisierte Szenen zwischen den beiden Hauptcharakteren Babou und Grozi: Es tauchen folglich alle drei Hauptgattungen in Likings Werk auf; die Epik, die Lyrik und das Drama.
Nicht umsonst bezeichnet Anne Adams sie als nicht nur als Romanautorin, sondern als „dramatist-novelist-poet-painter“ in einem. Trotz seiner vielen verschiedenen Elemente definiert die Autorin ihr Werk als Tagebuch: „Journal d’une Misovire“. Sowohl ein Tagebuch als auch ein Chant-Roman sind wohl beide in ihrer Grundform der erzählenden Literatur – der Epik – unterzuordnen. Neben ihrem Projekt des Tagebuchschreibens übernimmt sie die Rolle des Erzählers.
Die Grenze zwischen ihrem Tagebuch und dem Erzählertext selbst jedoch ist ungenau. Was steht tatsächlich in ihrem Tagebuch, was soll darinstehen? Befasst man sich näher mit ihrer Rolle, so scheint nicht sicher: Auf welcher Ebene steht die Erzählerin innerhalb des Romans? Wo positioniert sie sich? Allein schon der atemporale Charakter der Erzählung macht es schwer, einen Sinn in dem Tagebuch festzustellen, denn man kann ein Tagebuch wohl als eine Beschreibung eines oder mehrerer Prozesse sehen.
Worin also der Sinn des Tagebuchs, wo doch das Leben in Lunaï stillsteht? Wovon erzählt die Erzählfigur, was ist Inhalt und Zweck des Tagebuchs? Kann eine klassische, „westliche“ Theorie wie die Franz K. Stanzels die Erzählsituation in „Elle sera de Jaspe et de Corail“ erklären? Oder bedarf es einer vielschichtigeren Analyse unter verschiedenen, kulturellen und über die klassische Literaturtheorie hinaus bestehenden Aspekten, um die komplexe Erzählsituation des Chant-Romans von Werewere Liking zu erfassen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse und Kategorisierung nach Stanzels Erzähltheorie
- Interpretationsansätze der Erzählsituation
- Die Erzählung als spielerischer Prozess
- Metafiktionalität und Reflexivität der Erzählsituation
- Das Tagebuch als Spiegel des kollektiven Heilungsrituals der Bassa
- Das kollektive Heilungsritual
- Die Rolle der Erzählerfigur als Heiler
- Der ritualisierte Aufbau der Erzählung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Erzählsituation in Werewere Likings Roman „Elle sera de Jaspe et de Corail“. Die Zielsetzung besteht darin, die Komplexität der Erzählstruktur zu untersuchen und zu ergründen, inwieweit klassische Erzähltheorien, wie die von Franz K. Stanzel, diese adäquat erfassen können. Die Arbeit geht über eine rein theoretische Analyse hinaus und betrachtet auch kulturelle und literaturtheoretische Aspekte.
- Analyse der Erzählsituation in „Elle sera de Jaspe et de Corail“ anhand von Stanzels Erzähltheorie
- Untersuchung der Metafiktionalität und Reflexivität der Erzählung
- Interpretation des Tagebuchs als zentrales Element der Erzählung
- Bedeutung des kollektiven Heilungsrituals der Bassa
- Die Rolle der Erzählerfigur als Misovire
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Frage nach der Komplexität der Erzählsituation in Werewere Likings „Elle sera de Jaspe et de Corail“, einem „Chant-Roman“, der Elemente der Epik, Lyrik und des Dramas vereint. Der Roman wird von der Autorin selbst als Tagebuch („Journal d'une Misovire“) bezeichnet. Die Einleitung skizziert die Herausforderungen, die sich aus der Vielschichtigkeit des Werkes für eine klassische Erzählanalyse ergeben und stellt die Forschungsfrage nach der Anwendbarkeit westlicher Erzähltheorien auf afrikanische Literatur.
Analyse und Kategorisierung nach Stanzels Erzähltheorie: Dieses Kapitel analysiert die Erzählsituation anhand von Stanzels Erzähltheorie, die drei Grundoppositionen (Person, Perspektive, Modus) unterscheidet. Die Analyse konzentriert sich auf die Identifizierung der Erzählerfigur als Misovire, die sowohl handelnde Person als auch Erzählerin ist. Die Perspektive wird als ambivalent dargestellt, da sie sowohl Elemente der Innen- als auch der Außenperspektive aufweist. Der Modus wird als komplex betrachtet, mit Elementen sowohl des Erzählers als auch des Reflektors. Die Anwendung von Stanzels Theorie erweist sich als nur bedingt geeignet, die Komplexität der Erzählsituation umfassend zu erfassen.
Interpretationsansätze der Erzählsituation: Dieses Kapitel befasst sich mit weiterführenden Interpretationsansätzen. Es untersucht die Erzählung als einen spielerischen Prozess, der verschiedene Ebenen der Erzählung miteinander verwebt. Der Fokus liegt auf der Metafiktionalität und Reflexivität der Erzählsituation, die sich in der ständigen Selbstreflexion der Erzählerfigur und der Auflösung der Grenzen zwischen Fiktion und Realität zeigt. Die Analyse zeigt die Grenzen einer rein strukturalistischen Erzählanalyse auf und betont die Notwendigkeit, kulturelle und literaturtheoretische Kontexte zu berücksichtigen.
Das Tagebuch als Spiegel des kollektiven Heilungsrituals der Bassa: Dieses Kapitel analysiert das Tagebuch der Misovire als zentrales Element der Erzählung. Es wird als Spiegel eines kollektiven Heilungsrituals der Bassa interpretiert. Die Rolle der Erzählerfigur als Heiler wird untersucht und der ritualisierte Aufbau der Erzählung wird im Detail analysiert. Der Text verdeutlicht die Interdependenz zwischen dem individuellen Heilungsprozess der Misovire und dem kollektiven Ritual, das im Roman dargestellt wird. Der ritualisierte Aufbau der Erzählung wird als Spiegel dieses Prozesses interpretiert.
Schlüsselwörter
Elle sera de Jaspe et de Corail, Werewere Liking, Erzählsituation, Chant-Roman, Tagebuch, Misovire, Franz K. Stanzel, Erzähltheorie, Metafiktionalität, Reflexivität, kollektives Heilungsritual, Bassa, afrikanische Literatur, postkoloniale Literatur.
Häufig gestellte Fragen zu Werewere Likings "Elle sera de Jaspe et de Corail"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Erzählsituation in Werewere Likings Roman „Elle sera de Jaspe et de Corail“. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Komplexität der Erzählstruktur und der Frage, inwieweit klassische Erzähltheorien, wie die von Franz K. Stanzel, diese adäquat erfassen können. Die Analyse geht über eine rein theoretische Betrachtung hinaus und integriert kulturelle und literaturtheoretische Aspekte.
Welche Erzähltheorie wird angewendet?
Die Arbeit wendet primär Franz K. Stanzels Erzähltheorie an, die drei Grundoppositionen (Person, Perspektive, Modus) unterscheidet. Die Analyse untersucht, wie diese Theorie auf die komplexe Erzählsituation in „Elle sera de Jaspe et de Corail“ angewendet werden kann und wo ihre Grenzen liegen.
Welche Aspekte der Erzählsituation werden untersucht?
Die Analyse untersucht verschiedene Aspekte der Erzählsituation, darunter die Identifizierung der Erzählerfigur (Misovire), die Perspektive (Innen- und Außenperspektive), den Modus (Erzähler und Reflektor), die Metafiktionalität und Reflexivität der Erzählung, sowie die Darstellung des Tagebuchs als zentrales Element.
Welche Rolle spielt das Tagebuch in der Erzählung?
Das Tagebuch der Misovire wird als zentrales Element der Erzählung interpretiert und als Spiegel eines kollektiven Heilungsrituals der Bassa verstanden. Die Analyse untersucht die Rolle der Erzählerfigur als Heiler und den ritualisierten Aufbau der Erzählung als Ausdruck dieses Heilungsprozesses.
Welche kulturellen und literaturtheoretischen Aspekte werden berücksichtigt?
Die Arbeit geht über eine rein strukturalistische Erzählanalyse hinaus und berücksichtigt kulturelle und literaturtheoretische Kontexte. Sie betont die Bedeutung des kollektiven Heilungsrituals der Bassa und die Notwendigkeit, westliche Erzähltheorien im Kontext afrikanischer Literatur zu betrachten.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt, dass Stanzels Erzähltheorie nur bedingt geeignet ist, die Komplexität der Erzählsituation in „Elle sera de Jaspe et de Corail“ umfassend zu erfassen. Sie betont die Notwendigkeit, weiterführende Interpretationsansätze zu verwenden und kulturelle und literaturtheoretische Kontexte zu berücksichtigen, um die Vielschichtigkeit des Romans adäquat zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Elle sera de Jaspe et de Corail, Werewere Liking, Erzählsituation, Chant-Roman, Tagebuch, Misovire, Franz K. Stanzel, Erzähltheorie, Metafiktionalität, Reflexivität, kollektives Heilungsritual, Bassa, afrikanische Literatur, postkoloniale Literatur.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine Analyse nach Stanzels Erzähltheorie, eine Diskussion weiterer Interpretationsansätze, eine Analyse des Tagebuchs als Spiegel des kollektiven Heilungsrituals und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen sind enthalten.
- Arbeit zitieren
- Nicole Schröder (Autor:in), 2010, Epik, Lyrik und Drama im Chant-Roman. Die Erzählsituation im Roman "Elle sera de jaspe et de corail" von Werewere Liking, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355236