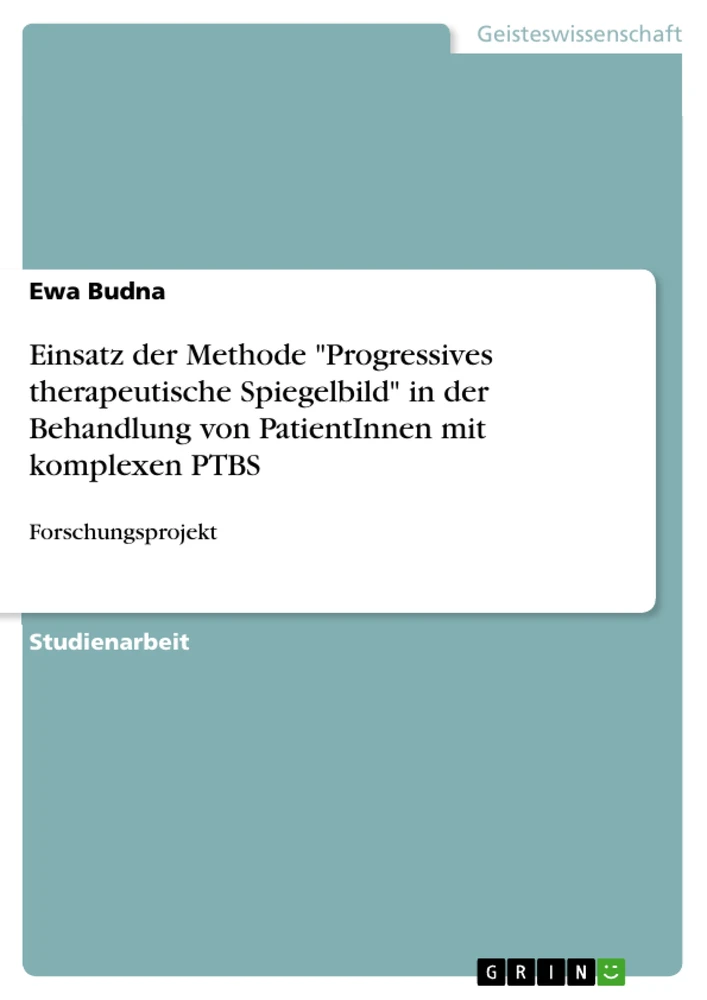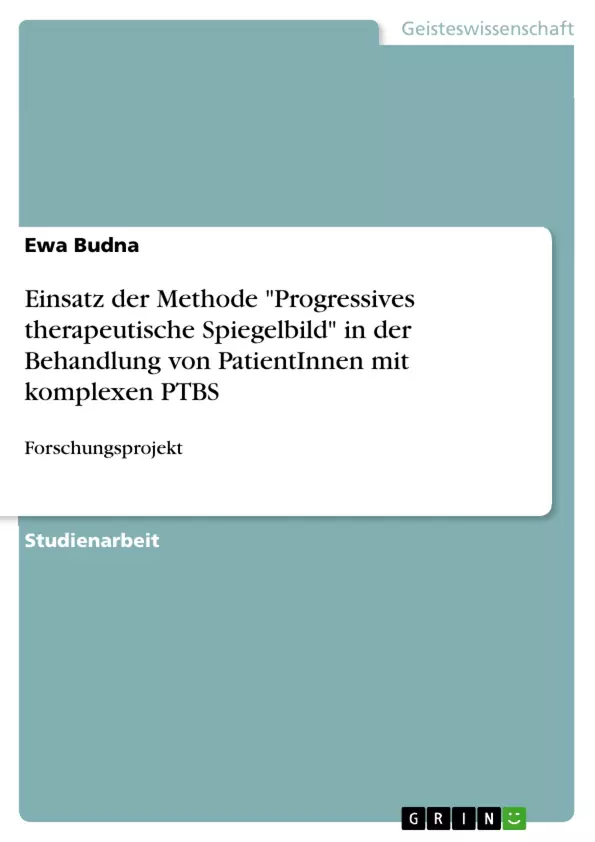Welche Auswirkungen zeigt die Methode Progressives therapeutisches Spiegelbild in der sechswöchigen Behandlung von PatientInnen mit komplexen PTBS bezogen auf die Korrektur der posttraumatischen dysfunktionalen Kognition?
Es soll die Wirkung der Methode Progressives therapeutisches Spiegelbild bei der o. g. Patientengruppe untersucht werden, um im Wesentlichen die Praxis zu verbessern, wovon in erster Linie die Betroffenen (PatientInnen, TherapeutInnen) profitieren sollen. Des Weiteren möchte ich die Aufmerksamkeit auf die klinischen Besonderheiten, Schwierigkeiten und Möglichkeiten einer Behandlung der o. g. Patientengruppe lenken.
Inhaltsverzeichnis
- 1 FORSCHUNGSFRAGE UND -ZIEL
- 1.1 Forschungsfrage
- 1.2 Forschungsziel
- 1.3 Hypothesen/Vorannahmen/Ausgangslage
- 2 FORSCHUNGSANSATZ UND METHODIK
- 3 AUSWAHLVERFAHREN UND REKRUTIERUNGSSTRATEGIE
- 4 DATENERHEBUNGSVERFAHREN UND ANALYTISCHES VERFAHREN
- 4.1 Datenerhebungsmethode
- 4.2 Interview/Problemzentrierte Interview
- 4.2.1 Die Grundpositionen des PZI sind
- 4.2.2 Problemzentrierung
- 4.2.3 Gegenstandsorientierung
- 4.2.4 Prozessorientierung
- 4.3 Ein gut strukturiertes Interviewleitfaden hat eine Einleitung, einen Kern und einen Abschluss
- 4.3.1 Einleitung
- 4.3.2 Kern
- 4.3.3 Schluss
- 4.4 Die Instrumente des PZI
- 4.4.1 Tonträgeraufzeichnung
- 4.4.2 Leitfaden
- 4.4.3 Postskripte
- 4.5 Fragetypen
- 4.5.1 Einleitende Fragen
- 4.5.2 Weiterführende Fragen
- 4.5.3 Vertiefende Fragen
- 4.5.4 Spezifizierende Fragen
- 4.5.5 Direkte Fragen
- 4.5.6 Strukturierende Fragen (oder Anmerkungen)
- 4.5.7 Gesprächspausen
- 4.5.8 Organisation und Berichterstattung
- 5 DAS ANALYTISCHE VERFAHREN
- 5.1 Qualitative Inhaltsanalyse
- 5.2 Die strukturierende Inhaltsanalyse
- 5.3 Daten anhand von Kategorien analysieren – deduktives Vorgehen
- 5.4 Schlussfolgerungen ziehen
- 6 FORSCHUNGSETHIK
- 6.1 Ethische Aspekte der Praxisforschung im Sozial- und Gesundheitswesen
- 6.2 Ethik
- 6.3 Die ethischen Prinzipien der Forschung
- 6.3.1 Das Prinzip der informierten Einwilligung
- 6.3.2 Das Prinzip der Nichtschädigung
- 7 SYSTEMATISCHE FEHLER
- 8 FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Forschungsziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Wirkung der Methode „Das progressive therapeutische Spiegelbild“ bei Patientinnen mit komplexer PTBS. Die Studie zielt darauf ab, die Praxis zu verbessern und neue Behandlungsinstrumente zu entwickeln. Ein besonderer Fokus liegt auf der Korrektur posttraumatischer dysfunktionaler Kognitionen.
- Wirkung des progressiven therapeutischen Spiegelbilds bei komplexer PTBS
- Korrektur posttraumatischer dysfunktionaler Kognitionen
- Entwicklung neuer Behandlungsinstrumente für komplexe PTBS
- Ethische Aspekte der Praxisforschung im Sozial- und Gesundheitswesen
- Methodische Vorgehensweise in der qualitativen Sozialforschung
Zusammenfassung der Kapitel
1 FORSCHUNGSFRAGE UND -ZIEL: Dieses Kapitel definiert die zentrale Forschungsfrage, die sich mit den Auswirkungen der Methode „Das progressive therapeutische Spiegelbild“ auf die Korrektur posttraumatischer dysfunktionaler Kognitionen bei Patientinnen mit komplexer PTBS auseinandersetzt. Es formuliert das Forschungsziel, welches in der Verbesserung der Praxis und der Entwicklung neuer Behandlungsansätze liegt. Zusätzlich werden die Hypothesen und die Ausgangslage der Studie dargelegt, die den Forschungsbedarf aufgrund des bisher fehlenden Wissens über den Einsatz der genannten Methode bei dieser Patientengruppe hervorhebt. Die Bedeutung der komplexen Traumatisierung und deren Auswirkungen auf die psychische Gesundheit wird erläutert, und es werden verschiedene Kategorien von Traumata sowie die diagnostischen Kriterien der PTBS nach ICD-10 vorgestellt.
2 FORSCHUNGSANSATZ UND METHODIK: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext, kann hier ergänzt werden, wenn Informationen zur Methodik vorhanden sind.)
3 AUSWAHLVERFAHREN UND REKRUTIERUNGSSTRATEGIE: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext, kann hier ergänzt werden, wenn Informationen zur Rekrutierung vorhanden sind.)
4 DATENERHEBUNGSVERFAHREN UND ANALYTISCHES VERFAHREN: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Datenerhebungsmethode, das problemzentrierte Interview (PZI), inklusive seiner Grundpositionen (Problemzentrierung, Gegenstandsorientierung, Prozessorientierung). Es erläutert die Struktur eines gut aufgebauten Interviewleitfadens (Einleitung, Kern, Schluss) und die verschiedenen Fragetypen (einleitend, weiterführend, vertiefend, spezifizierend, direkt, strukturierend), sowie die Bedeutung von Gesprächspausen und die Organisation der Berichterstattung. Schließlich wird das analytische Verfahren, die qualitative Inhaltsanalyse, vorgestellt, einschließlich des deduktiven Vorgehens bei der Datenanalyse anhand von Kategorien.
5 DAS ANALYTISCHE VERFAHREN: (Kapitelzusammenfassung fehlt, da der Text zu diesem Kapitel unvollständig ist. Eine Zusammenfassung der qualitativen Inhaltsanalyse und der strukturierenden Inhaltsanalyse sowie des deduktiven Vorgehens bei der Datenanalyse wäre hier angebracht.)
6 FORSCHUNGSETHIK: Dieses Kapitel befasst sich mit den ethischen Aspekten der Praxisforschung im Sozial- und Gesundheitswesen. Es werden ethische Prinzipien der Forschung, wie das Prinzip der informierten Einwilligung und das Prinzip der Nichtschädigung, erörtert. Die Bedeutung ethischen Handelns im Kontext der Forschung mit traumatisierten Personen wird betont.
7 SYSTEMATISCHE FEHLER: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext. Eine Zusammenfassung der potentiellen systematischen Fehler und deren Minimierung wäre hier nötig.)
Schlüsselwörter
Progressive therapeutisches Spiegelbild, komplexe PTBS, posttraumatische dysfunktionale Kognition, qualitative Inhaltsanalyse, problemzentriertes Interview, Forschungsethik, Trauma, Behandlung, Praxisforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Forschungsarbeit zum Progressiven Therapeutischen Spiegelbild bei komplexer PTBS
Was ist das zentrale Thema dieser Forschungsarbeit?
Die Forschungsarbeit untersucht die Wirkung des „Progressiven Therapeutischen Spiegelbilds“ bei Patientinnen mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS). Ein besonderer Fokus liegt auf der Korrektur posttraumatischer dysfunktionaler Kognitionen und der Entwicklung neuer Behandlungsinstrumente.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit den Auswirkungen des „Progressiven Therapeutischen Spiegelbilds“ auf die Korrektur posttraumatischer dysfunktionaler Kognitionen bei Patientinnen mit komplexer PTBS.
Was ist das Forschungsziel?
Das Forschungsziel ist die Verbesserung der Praxis und die Entwicklung neuer Behandlungsansätze für komplexe PTBS.
Welche Methode wird zur Datenerhebung verwendet?
Es wird ein problemzentriertes Interview (PZI) eingesetzt. Das Kapitel beschreibt detailliert die Struktur des Interviews (Einleitung, Kern, Schluss), verschiedene Fragetypen und die Bedeutung von Gesprächspausen.
Welche Methode wird zur Datenanalyse verwendet?
Die Datenanalyse erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse, inklusive eines deduktiven Vorgehens mit vordefinierten Kategorien.
Welche ethischen Aspekte werden berücksichtigt?
Die Arbeit behandelt die ethischen Aspekte der Praxisforschung im Sozial- und Gesundheitswesen, insbesondere das Prinzip der informierten Einwilligung und das Prinzip der Nichtschädigung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Forschungsfrage und -ziel, Forschungsansatz und Methodik, Auswahlverfahren und Rekrutierungsstrategie, Datenerhebungsverfahren und analytisches Verfahren, Das analytische Verfahren, Forschungsethik, Systematische Fehler und Fazit. Einige Kapitelzusammenfassungen fehlen im Ausgangsdokument.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Progressives therapeutisches Spiegelbild, komplexe PTBS, posttraumatische dysfunktionale Kognition, qualitative Inhaltsanalyse, problemzentriertes Interview, Forschungsethik, Trauma, Behandlung, Praxisforschung.
Wie ist der Aufbau des problemzentrierten Interviews (PZI)?
Ein gut strukturierter Interviewleitfaden umfasst eine Einleitung, einen Kern und einen Abschluss. Es werden verschiedene Fragetypen eingesetzt (einleitende, weiterführende, vertiefende, spezifizierende, direkte, strukturierende Fragen) sowie Gesprächspausen berücksichtigt.
Welche Arten von Fragen werden im PZI verwendet?
Im PZI werden verschiedene Fragetypen verwendet: einleitende, weiterführende, vertiefende, spezifizierende, direkte, strukturierende Fragen. Die Bedeutung von Gesprächspausen wird ebenfalls hervorgehoben.
- Quote paper
- Ewa Budna (Author), 2016, Einsatz der Methode "Progressives therapeutische Spiegelbild" in der Behandlung von PatientInnen mit komplexen PTBS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/355469